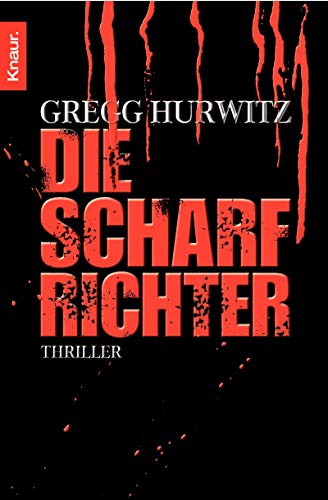Selbstjustiz ist gerade in den USA, wo schon so mancher Waffennarr das Recht, einen Einbrecher zu erschießen, für sich beansprucht hat, ein sensibles Thema. So gesehen packt Gregg Hurwitz mit seinem Thriller „Die Scharfrichter“ ein mehr oder minder heißes Eisen an.
Tim Rackley ist US Marshal in Los Angeles. Auch seine Frau Andrea arbeitet bei der Polizei. Tim ist ein rechtsgläubiger Mensch, der an die Gesetze glaubt. Das ändert sich, als seine sechsjährige Tochter Virginia brutal ermordet und der Täter aufgrund eines juristischen Formfehlers freigesprochen wird. Tim sieht plötzliche, wie die Rechtsprechung auch mal im Unrecht sein kann, und das will und kann er nicht so stehen lassen.
Wie es der Zufall so will, klopft just in dem Moment aufkeimender Rachegelüste ein Mann an seine Tür, der sich als Vertreter einer Kommission vorstellt, die es sich zum Ziel gemacht hat, solche Fehlurteile der Rechtsprechung geradezubiegen – auf eigene Faust, versteht sich, und auf nicht ganz legale Weise obendrein. Nach einigem Grübeln schließt Tim sich dieser Kommission an, die sich daraufhin trifft, um sieben Fälle neu aufzurollen, zu verhandeln, Urteile zu sprechen und zu vollstrecken. Der siebte Fall soll der Mörder von Tims Tochter sein.
Zunächst verläuft alles planmäßig, als dann jedoch einige skrupellose Mitglieder der Kommission bei einer Urteilsvollstreckung ein Blutbad anrichten, läuft die Sache aus dem Ruder. Tim muss schon bald erkennen, dass er sich auf ein Spiel eingelassen hat, von dem er besser die Finger gelassen hätte und bei dem am Ende nicht nur sein eigenes Leben in Gefahr ist …
Auf den ersten Blick klingt das alles nach einem spannenden Thriller um Justiz und Rache. Diesen Eindruck will offensichtlich auch der auffällige gelbe Sticker auf dem Buchdeckel erwecken, der „Hochspannung!“ verspricht. Solche Sticker machen mich mittlerweile aber immer misstrauisch, denn schon zu oft entpuppte sich ein solcher „hochspannender“ Thriller oder gar „Thriller des Monats“ als Pleite oder höchstens mittelklassiges Werk.
„Die Scharfrichter“ ergeht es da leider nicht viel anders – zumindest scheint sich der Sticker auf dem Buchdeckel lediglich auf das letzte Buchdrittel zu beziehen. Mag die Thematik im ersten Moment auch noch spannend klingen und auch Hurwitz‘ Einstieg in die Geschichte noch recht vielversprechend erscheinen, so folgt dem mit zunehmender Seitenzahl dann doch immer häufiger ein Stirnrunzeln. Die Geschichte entwickelt so einige Ecken und Kanten, die ein wenig den Lesegenuss trüben.
Und das, obwohl Hurwitz am Anfang noch einen recht guten Eindruck hinterlässt. Die Trauer und Ohnmacht der Eltern wird einigermaßen gut greifbar und steht in den ersten Kapiteln noch im Mittelpunkt der Handlung. Das erste Stirnrunzeln folgt dann mit dem Freispruch des Kindermörders wenig später. Der Täter wird freigesprochen, nachdem die Verteidigung mehrere Gutachten vorlegt, die belegen, dass der Angeklagte taub ist, also nicht hören konnte, wie ihm seine Rechte vorgelesen wurden, als die Polizei ihn mitsamt aller erdrückenden Beweise in seinem Haus vorfand. Dass daher alle in diesem Zusammenhang sichergestellten (und absolut eindeutigen) Beweise und das Geständnis des Täters vor Gericht nicht anerkannt werden, führt zum Freispruch. Dass aber vorher niemand gemerkt haben will, dass der Täter taub ist, wird nicht sonderlich glaubwürdig verdeutlicht.
Auch andere Fehlurteile, die die Kommission später intern noch einmal neu aufrollt, bleiben ähnlich fragwürdig. Warum z. B. die Gerichte einen Mann, der erwiesener Maßen ein Massenmörder ist, freisprechen, weil das Sondereinsatzkommando drei Minuten zu spät seine Wohnung stürmt, wird nicht ganz deutlich. Dafür, dass die USA sich beispielsweise in Guantanamo einen Dreck um die Rechte Verdächtiger scheren, lässt die US-Justiz hier einfach zu freizügig Massenmörder laufen, als dass es glaubhaft wäre.
Und so lässt das Ganze Hurwitz‘ Realitätsbezug ein wenig zu zweifelhaft erscheinen. Mag sein, dass das Rechtssystem einige haarsträubende Schlupflöcher hat, aber dass eine dreiminütige Verspätung der Polizei schwerer wiegen soll als ein 86-facher Mord, erscheint einfach zu unglaubwürdig. Wenn Hurwitz‘ Recherchen wirklich so haarsträubende Probleme in der US-Justiz ergeben hätten, hätte ich mir einen entsprechenden Kommentar im Nachwort gewünscht, um dem irgendwie Glauben schenken zu können, aber ohne einen weiteren Kommentar klingt das für meine Ohren einfach zu fantastisch.
Der Thrillerplot, den Hurwitz aber aus diesem etwas fragwürdigen Stoff spinnt, lässt mit der Zeit zumindest die Spannungskurve ordentlich steigen. Damit lässt er sich zwar auch ein wenig Zeit (in der ersten Hälfte des Buches gibt es immer wieder Phasen, die weniger spannend sind), dafür ist gerade das letzte Drittel des Buches dann doch wirklich spannend. Es entbrennt ein fesselndes Katz-und-Maus-Spiel zwischen Tim, den anderen Mitgliedern der Kommission und der Polizei, bei dem es um alles geht.
Bei der Schilderung der Vorgehensweise der Kommission, bei allen Aspekten, die sich um Waffen und Technik sowie deren Handhabung drehen, geht Hurwitz äußerst präzise vor. Er schildert solche Dinge geradezu detailverliebt und lässt immer wieder Daten und Fakten einfließen, wie die Stärke des Rückschlag einer Waffe oder die Vorgehensweise zur Ausschaltung eines Bewegungsmelders. Dem gegenüber stehen aber hier und da kleine Flüchtigkeitsfehler in der Kontinuität der Geschichte. So beträgt der Zeitraum zwischen dem Mord an Tims Tochter und den aktuellen Ereignissen des Romans erst 14 Tage, später dann nur noch 11 Tage, und eine Sprengstofftasche, die erst oliv war, ist plötzlich schwarz. Aber das sind sicherlich eher Kleinigkeiten, die man als nicht ganz so schwerwiegend betrachten kann.
Nicht ganz überzeugend finde ich dagegen die Auflösung. Ich hatte befürchtet, dass die Geschichte auf das hinauslaufen würde, was dann zum Ende hin kommt, denn irgendwie liegt das im Laufe des Buches schon in der Luft – überzeugend gelöst finde ich es dennoch nicht. Auch das Ende erscheint mir ein wenig zu typisch amerikanisch. Der strahlende Held bleibt der strahlende Held, trotz all der Dinge, die er tut und erlebt. Das Ende passt zwar zur Geschichte, hinterlässt aber dennoch einen etwas fahlen Nachgeschmack.
Überhaupt wirken die Figuren etwas klischeebehaftet: Tim der Superpolizist auf Abwegen, der nie den Überblick zu verlieren scheint und dessen Heldenaura nur selten Kratzer erleidet. Auch die Kommissionsmitglieder wirken teils sehr klischeeüberfrachtet. Die muskulösen Zwillingsbrüder Masterson, die ihre Aggressionen nicht immer im Zaum halten können. Storch, der hässliche, kränkliche Technikfreak, der ein gesellschaftlicher Außenseiter ist, aber in Sachen Technik ein brillantes Genie. Das sieht alles ein wenig zu sehr nach Hollywoodfilm aus.
Bleiben unterm Strich also gemischte Gefühle zurück. Einerseits baut Hurwitz den Plot spannend auf und gibt der Geschichte gerade zum Ende hin viel Tempo, dennoch bleiben viele Aspekte in Erinnerung, die wenig überzeugend sind. Gerade mit Blick auf die Entscheidungen der Justiz bleibt vieles fragwürdig. Zwar sind die USA ein Land, wo Gerichte auch schon mal den Ausgang einer demokratischen Wahl festlegen (was für sich genommen so haarsträubend ist, dass man all die krassen Fehlurteile, die Hurwitz schildert, sofort glauben möchte), dennoch erscheint mir in dieser Hinsicht manches zu fantastisch. Auch die wenig befriedigende Auflösung und die klischeebehafteten Figuren trüben ein wenig die Freude. Fazit: Spannende Kost zwar, aber dennoch nicht auf ganzer Linie überzeugend.
http://www.knaur.de