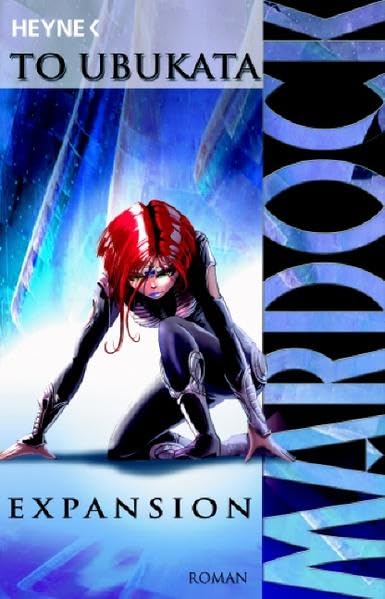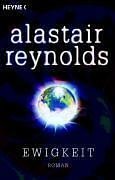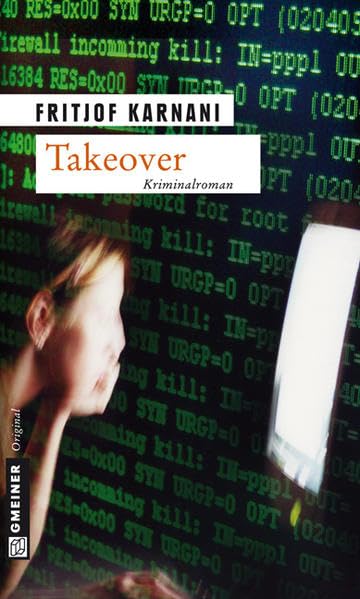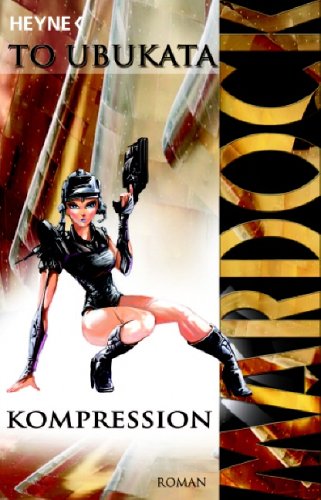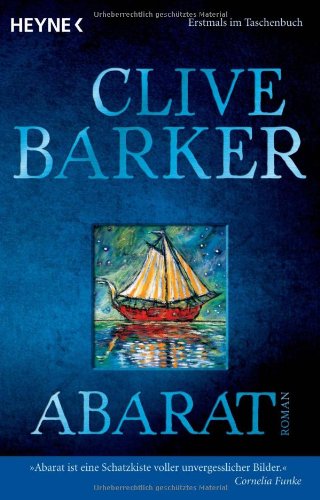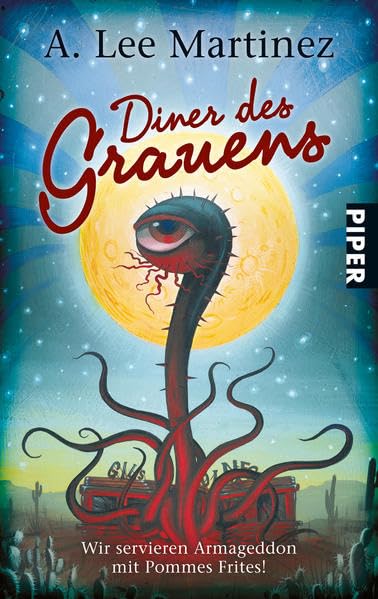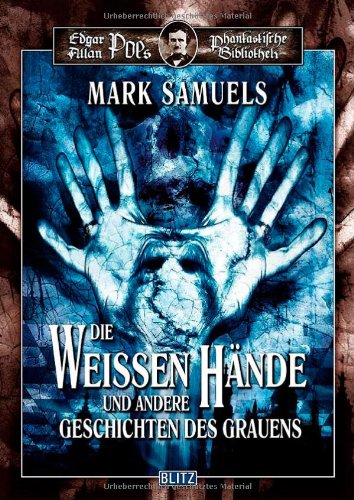_Ambitioniertes Projekt mit Multimedia-Unterstützung._
Jeder Tropfen Herzblut ist spürbar, wenn man auf Marion Feilers Homepage pilgert, um sich weitere Informationen zu verschaffen, über ihren aktuellen Fantasy-Zyklus „Faron“. So wird dort der interessierte Neuling ebenso wie der „alte Hase“ über die Welt Soramenis aufgeklärt: Der Stadtschreiber Xandos führt durch die einzelnen Seiten, gewährt dem Neugierigen einen genauen Blick auf die virtuelle Landkarte und zeigt ihm sehr ansprechende Grafik-Designs, die so gut wie alle Handlungsschauplätze zeigen (!!!), Szenen aus „König von Callador“ und auch Faron selbst, zusammen mit seinem Wolf Bargo und seinem Pferd Charr.
Die Autorin selbst beschreibt ihren Zyklus um den Antihelden Faron als „mittelalterliches Kriegsepos mit Fantasyelementen“, darüber hinaus als „(hobby-)psychologische[n] Versuch, den Leser mit Herz und Seele an einen Charakter zu binden, der vom üblichen Heldentyp dahingehend abweicht, dass er im Grunde abgrundtief böse, unberechenbar und grausam ist.“ Der Zyklus wird vier Doppelbände umfassen, von denen bisher dieser erste erschienen ist:
_Der Kriegsgott ruft zur Schlacht._
Trauer herrscht im Reiche Callador, hat es doch seinen König verloren und seinen rechtmäßigen Thronfolger ebenfalls, wie es scheint. Der nächste in der Thronfolge ist Faron, aber das Volk ist voller Zweifel, da er dem Kriegsgott Ashtor huldigt und das auch von seinen Untergebenen verlangt. Faron allerdings verdampft alle Zauderei mit seinem Charme, und bald weiß er ganz Callador in seinem Rücken, obwohl er grausame Opfer darbringt, um Gott Ashtor zu huldigen.
Es lassen sich jedoch nicht alle von Faron blenden: Andos, der beste Feldherr von Callador, legt sein Schwert nieder, Farons Mutter Sanida gibt nicht auf, den vermissten, rechtmäßigen Thronfolger finden zu wollen, und Farons Berater Hanár schließt sich dem an, weil er der Friedensgöttin Jishta huldigt und die Verehrung des Kriegsgottes für schändlich hält.
Faron lässt sich nicht aufhalten, er erobert andere Länder von Soramenis, mit Ashtors Hilfe, mit Hilfe des magischen Schwertes Naxan, dem Wolf Bargo und Charr, einem König unter den Rössern. Damit weitet er seine Macht aus und sichert sich die Loyalität seiner Bürger, die das Ränkespiel hinter seinem Charisma nicht erkennen. Dann allerdings wird Faron mit etwas konfrontiert, das er noch nicht kannte: Freundschaft. Zu seinem Knappen Flin und sogar zu seinem einstigen Gegner, dem Feldherren Andos, entwickelt er eine Bindung, die Kriegsgott Ashtor ganz und gar missfallen dürfte. Als dann auch noch die quirlige Naira in sein Leben tritt, ist es beinahe völlig um Farons kühle, egoistische Distanz geschehen …
Gerade in diesem Augenblick taucht der vermisste Garwin auf, meldet seinen Anspruch auf den Thron an und möchte, dass die Tempel von Ashtor verschwinden, auf dass die Friedensgöttin Jishta wieder über Callador wachen kann. Das ist aber nur ein Konflikt, der sich anbahnt; das Reich Sul lässt sich nicht so einfach einnehmen, wie Faron das gedacht hat, und gerade, als er die Hilfe seines Gottes am nötigsten hat, verscherzt er es sich vollends mit ihm und findet die Hauptstadt seines eigenen Landes als Schauplatz für einen Krieg zwischen den Göttern vor …
_Von Schlaglöchern und Autorendiktatur._
Ich bin ehrlich, ich habe diese Rezension lange vor mich hergeschoben. Wie gesagt, man spürt das Herzblut, das darin steckt, und die Grundvoraussetzungen, auf denen die Handlung fußt, sind gut ausgearbeitet: der Antiheld Faron zum Beispiel, ein manipulativer, charismatischer Volksverhetzer mit einem überaus grausamen Herzen. Aus seinem Plan, das Land Soramenis zu unterwandern, hätte man eine wirklich großartige Geschichte zaubern können! Die leidet aber leider an ein paar gewaltigen Schwächen.
Anfangs hat Faron einfach keinen würdigen Gegner; nicht nur, dass er mit seinem Charisma jeden um den Finger wickeln kann (und das in Lichtgeschwindigkeit), er hat noch sein magisches Schwert und den Gott, der ihm Wichtiges einflüstert. Zu all dieser Macht kommt noch des Fantasyromans schlimmster Dämon: die „kostenlose Magie“. Immer wenn sich dann doch echte Gefahr für Faron ankündigt – ein ebenbürtiger Gegner, ein kitzliger Konflikt –, wendet Faron das Blatt zu seinen Gunsten, indem er einen Zauberspruch aus dem Ärmel schüttelt, der allem eben einen Schritt voraus ist.
Leider ist auch das Universum nicht besonders tief gezeichnet: Es gibt einige wenige Reiche in Soramenis und jedes zeichnet sich durch ein recht begrenztes Spektrum aus: Thargonath etwa ist ein „armes Reich“: In dessen Hauptstadt gibt es keinen Schmuck und alles sieht trostlos aus. In Callador ist alles prunkvoll, jeder ist wohlhabend, so scheint es – Nuancen finden sich kaum. Das gilt auch für die Figuren. Manchmal sind sie einfach furchtbar naiv, Konflikte entwickeln sich oft dergestalt, als ob jede Partei nur um einen Zug voraus denken würde (König Chintos kommt Faron besuchen, lässt sich von ihm den unsicheren König vorspielen und entscheidet aufgrund dieses knappen Besuches, dass man Callador angreifen und unterwerfen kann, obwohl man sich vorher jahrelang vor der Macht dieses Reiches gefürchtet hat). Die Götter nicht zu vergessen. Es gibt eine Göttin des Friedens und einen Gott des Krieges. Punkt.
Dabei hat Marion Feiler gute Ideen, was ihre Figuren angeht, hält sie aber nicht durch! Faron ist ein Antiheld, der Sympathie und Grausamkeit vereinigt, aber er ist nicht glaubwürdig. Das liegt einfach daran, dass die Autorin manchmal unter der Brutalität ihrer Schöpfung zusammenzubrechen scheint, den Radiergummi herausholt und dem Fast-Sohn eines blutdürstigen Rachegottes plötzlich alle Fangzähne wegretouchiert – superscharfe Konflikte verlieren so ihren Biss, weil sie von der Autorin in zahmere Regionen geschubst werden. Das ist aber verdammt schade, denn Spannung aufbauen kann Marion Feiler vorzüglich! |[Vorsicht Spoiler]| Das nutzt aber nichts, wenn man sich denkt: Ach was. XY passiert doch eh wieder nix, ist viel zu sympathisch/wichtig, um zu sterben. So zeigt Faron seine Grausamkeit eben nur an (weitgehend) unwichtigen Nebenfiguren, und brutaler kann man Spannung und Glaubwürdigkeit einer Geschichte nicht meucheln. |[Spoiler Ende]|
Noch einmal: Die Geschichte um den zwiespältigen Faron hat Potenzial und Marion Feiler einen flüssigen, bildhaften Stil, der sich schön liest. Auch die Eckpunkte der Geschichte sind sorgfältig überlegt, aber der Weg dorthin leidet eben unter melodramatischen und naiven Schlaglöchern, folgt dabei häufig sehr deutlich dem Willen der Autorin und nicht dem der Figuren. Freunde figurenorientierter Fantasy sollten also die Finger von „Faron“ lassen. Das Experiment, Leser an eine zwiespältige und grausame Figur zu binden, ist George R. R. Martin mit Jaime Lannister um Welten besser geglückt, auch wenn ein Vergleich mit DEM Fantasy-Referenzwerk der aktuellen Stunde zugegebenermaßen etwas unfair ist.
Wer sich daran aber nicht stört oder Gefallen an der Gewissheit findet, dass superharte Konflikte nicht eskalieren, der wird von Farons rauem Charme sicherlich unterhalten, kann sich vor seinen Grausamkeiten gruseln, aber gleichzeitig in gefälligen Wendungen dahinschmelzen und in den Konventionen historisch angehauchter Fantasy schwelgen, die Marion Feiler tadellos umgesetzt und angewendet hat. Unter dem Strich bleibt also ein junges Werk einer jungen Autorin, über dessen Schwächen der beinharte Genre-Leser sicher hinwegsehen kann. Auch Zweifelnde brauchen sich nicht auf mein Wort zu verlassen und können sich einen eigenen Eindruck verschaffen, dank der zahlreichen Leseproben, die man auf der Homepage der Autorin abrufen kann.
_Ein Leben neben Callador._
Neben den drei Folgebänden des „Faron“-Zyklus arbeitet die Autorin übrigens an einem Gemeinschaftsprojekt mit vier Co-Autoren, das im „Ambra-Gem“-Universum spielen wird, jenem Universum, in dem Marion Feiler mit „Der Fluch der Zoderkas“ ihr Roman-Debüt gegeben hat. „Säule des Bösen“ wird das Werk heißen und laut der Autorin Folgendes enthalten: „Fünf Protagonisten, fünf Abenteuer und ein Ziel, nämlich die Säule des Bösen im düsteren Land der Tenebras.“ Ansonsten dürfen sich alle Faron-Verfallenen auf den nächsten Doppelband freuen: „Faron – König und Gott“ müsste laut Vorschau demnächst zu erstehen sein.
http://www.marion-feiler.de/