
Die drei ??? und der sprechende Totenkopf (Band 5) weiterlesen

Die drei ??? und der sprechende Totenkopf (Band 5) weiterlesen
Die Riege der Unterwasserforschungs- und Wrack-Publikationen des Titanic-Entdeckers Robert D. Ballard wäre alles andere als komplett, wenn ich nicht auch seinen Bestseller und zugleich sein Erstlingswerk unter die Lupe nähme, das ihm seinen heutigen Ruf erst verpasst hat. Das Objekt seiner damaligen Begierde hingegen brauche ich ich wohl nicht näher vorstellen: Die RMS Titanic (RMS steht für „Royal Mail Ship“) manchmal in alten Quellen auch als SS Titanic bezeichnet (für „Steam Ship“, also Dampfschiff). Kaum ein Schiff und die es umwabernden Legenden hat die menschliche Phantasie in Sachen tragischer Unglücke so beflügelt wie diese eine Katastrophe. Mich fasziniert die Geschichte bereits seit meinen frühen Kindertagen. Bis heute ist das Interesse daran ungebrochen – und nicht nur meines.
_Der Autor_
Robert Dwayne Ballard ist eine feste Größe geworden, der besagte Fund hat den Grundstein gelegt für den umtriebigen Doktor der Woodshole Oceanographic Institution. Dabei ist er eigentlich Meeresgeologe, der einst das Terrain der Unterwasserlandschaften kartographierte und erforschte. Zum ruhmreichen Titel des Godfathers unter den heutigen Wrackfindern kam er wie die Jungfrau zum Kind. Seine Tätigkeit für die US-Navy und die Entwicklung damals revolutionärer Tiefsee-Forschungs-U-Boote brachte ihm die Anfrage ein, ob er sich – gesponsort vom amerikanischen Militär und einigen anderen – mit seinem hierfür zweckentfremdeten Equipment statt doofe Steine, sturzlangweilige Felsen und an Ödnis kaum zu übertreffende Unterwassergräben zu erforschen, nicht lieber auf die Suche nach dem berühmten Liner machen wolle. Zuvor war 1983/84 schon der Milliardär Jack Grimm zweimal mit seinen privat finanzierten, medienwirksamen Expeditionen gescheitert, wie Ballard später nicht müde wird hämisch zu sticheln.
Er hat es grade nötig. Ballard ist nicht unumstritten, vor allem die Franzosen werfen ihm vor, sie bei der Titanic-Expedition (die man gemeinsam unternahm, der Ruhm jedoch ging alleine an ihn) herzlichst über den Löffel barbiert zu haben. Zumindest waren sie die ersten, die es wagten, seinem neu erworbenen Hochglanzimage ein paar fiese Dellen zu verpassen. Übersteigerte, mediale Geltungssucht ist das Schlagwort. Wer dieses und seine anderen Bücher mehr oder weniger aufmerksam liest, wird feststellen, dass dies gar nicht so weit hergeholt ist. In der Tat ist Ballard ein tüchtiger und fähiger Wissenschaftler, doch der stetige Erfolg seines gepriesenen Suchsystems ist ihm seit damals irgendwie zu Kopf gestiegen. Und wie das so ist, dreht sich die Spirale seither munter weiter: Mit jedem weiteren Wrack wächst sein Ego näher heran an den schmalen Grat des Größenwahns. Kein Wunder, dass er von vielen einer Kollegen mittlerweile geschnitten wird. Derzeit sucht er übrigens die Arche Noah … Petri Heil.
_Unsinkbar – Das Schiff und seine Geschichten_
Eine Menge Mythen ranken sich um das berühmteste Passagierschiff seiner Zeit, das seine Jungfernfahrt von Liverpool nach New York am 14./15. April 1912 denkbar außerplanmäßig beendete. Die unsanfte Begegnung mit dem Eisberg und die darauf folgende Tragödie ist hinlänglich bekannt. Ihre Berühmtheit hat sich bis heute gehalten, zudem kann der Untergang als sicheres Ende des „vergoldeten Zeitalters“ angesehen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Technikgläubigkeit gerade in England schier grenzenlos. Beinahe täglich neue Erfindungen, die das Leben einfacher und komfortabler gestalteten. Der Mensch im sicheren Glauben, die Natur mit Ingenieurskunst auf ewig besiegen zu können – das musste ja irgendwann schief gehen. Ihre Erbauer haben sich eine Menge pfiffiger und bahnbrechender Details einfallen lassen und doch hat es nicht gereicht, um alle Eventualitäten auszuschließen.
Die Titanic war das ikonische Sinnbild dieser euphorischen Ära: Gebaut nach dem letzten Schrei der Technik, mit viel Wert auf pompösen Luxus – weniger jedoch auf Geschwindigkeit und (wie sich in der schicksalsträchtigen Nacht überdeutlich zeigt) auch weniger sicher respektive „unsinkbar“, als man glaubte. Dieses oft bemühte Adjektiv stammt übrigens aus der Presse seinerzeit, die Reederei widersprach dem Superlativ aus Werbegründen natürlich absichtlich nicht. Im Nachhinein konnten sie mit Fug und Recht behaupten, so etwas nie gesagt zu haben. Der Legendenbildung ist das fehlende Dementi aber vollkommen wurscht. Die Realität hat den Nimbus, dass „nicht mal Gott persönlich dieses Schiff versenken“ könne, zerstört. Quid ad est demonstrandum. Gott war dazu nicht nötig, ein popeliger Eisberg reichte vollkommen. Eine ganze Epoche ging nicht nur metaphorisch mit der Titanic baden und beendete die bedingungslose Technikgläubigkeit.
Eine ganze Latte Falschinformationen und Halbwahrheiten hat sich hartnäckig gehalten; so wird sogar heute noch vielenorts unterstellt, Captain E. J. Smith und der Vertreter der White-Star-Reederei Bruce Ismay wären auf das Blaue Band (die Auszeichnung für die schnellste Atlantiküberquerung) aus gewesen. Das ist mit Blick auf die vergleichsweise schwachen Triebwerke der Titanic ausgekochter Dummfug. Dazu wäre sie niemals in der Lage gewesen – wenngleich Ismay nachweislich wohl mehr als einmal gedrängt haben soll, etwas mehr Tempo zu machen, um früher als geplant in NY anzukommen. Das kann man nachvollziehen, bedeutete es doch eine gute Werbung im hart umkämpften Markt, wenn der prachtvollste Pott aller Zeiten das Manko, dafür aber eine eine lahme Schnecke zu sein, ein wenig ablegen könnte. Das Blaue Band jedoch war niemals ein Thema oder auch nur annähernd in Gefahr. Das hielt die Cunard Line mit ihren viel stärker motorisierten Schiffen „Mauretania“ und „Lusitania“ jahrzehntelang.
Klassendenken, zu wenige Rettungsboote (kurios, aber mehr als der Gesetzgeber damals forderte), ein zu nördlicher Kurs, ein fataler Denkfehler in der Konstruktion, fehlende Ferngläser im Ausguck, spiegelglatte See, ein Fahrfehler des Ersten Offiziers, ein Schiff, das nicht zur Rettung erschien – die oft strapazierte „unglückliche Verkettung von Ereignissen“-Liste ließe sich fast beliebig fortführen, um diese Tragödie zu erklären, die vor allem in den Reihen der Zweite- und Dritte-Klasse-Passagieren dem Sensenmann eine große Ernte bescherten, ja ganze Familien auslöschte. Geschichten von Heldenmut, Tragödien, „Be British!“-Gedröhn und eine Band, die bis zum allerletzten Vorhang spielte, sind durch Zeugenaussagen überliefert und haben die Zeit überdauert. Der eigentlichen Grund für das rasche Absaufen konnte nie befriedigend geklärt werden.
Die Untersuchungskommission kurz nach dem Desaster konnte kein Licht ins Dunkel bringen oder wollte es zum Teil auch gar nicht. Mochten sich Zeugen auch noch so widersprechen, man ignorierte es. Man hing einem sehr falschen Schadensbild nach, doch man konnte es in diesem speziellen Punkt wirklich nicht besser wissen. Woher auch? Zu guter Letzt beschuldigte man sogar den Kapitän eines offensichtlich in der Nähe befindlichen Schiffes der unterlassenen Hilfeleistung. Beweisen konnte man Captain Lord sein vermeintliches Fehlverhalten nie so recht. Aber man hatte immerhin schon mal einen publikumswirksamen Sündenbock, den man zumindest für einen Teil der Opfer verantwortlich machen konnte. Man beeilte sich seinerzeit auffällig, die Untersuchung zu einem schnellen Abschluss zu bringen, es ging aus wie das Hornberger Schießen.
Heute weiß man mehr. Der Schaden war eigentlich gar nicht so riesig. Kein 90 Meter langer Riss im Rumpf, sondern „nur“ viele kleine. Diese dafür an besonders prekären Stellen. Das reichte, um den Titanen zu Fall zu bringen. Der Rumpf ist entzwei gerissen, dessen Teile stehen 600 Meter voneinander entfernt auf Grund. Ballard rekonstruierte anhand der Fundlage und Schäden den Ablauf des Untergangs zum ersten Mal schlüssig. Eine ausgefeilte Theorie, die aufgrund ihres sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrades weiterhin Gültigkeit hat. Es kommt nach Bergung einiger Stahlproben vom Wrack (durchgeführt Mitte der 90er vom Discovery Channel – ohne Ballard) sogar eine neue Komponente hinzu: Der Werkstoff soll minderwertig und kältespröde sein, dass heißt bei Temperaturen unter 0° C besonders zum Bersten neigen. Ein weiterer Sargnagel für das Ende des Schiffes in jener kalten Nacht mit Wassertemperaturen um -2° C.
Wie man es dreht und wendet, lange Zeit gab die sagenumwobene Titanic massig Stoff für Spekulationen und ungelöste Rätsel her. Je weiter die Zeit voranschritt, desto wilder wurden die Phantasien. Clive Cussler hebt die Titanic in seinem gleichnamigen Roman gar und lässt sie – logischerweise „etwas“ verspätet, aber immerhin – gesteuert von seinem Lieblingshelden Dirk Pitt in New York einlaufen. In seinem Kielwasser hatten Hebe-Hypothesen Konjunktur, das „Wie?!“ reichte hier vom klassischen Ponton bis hin zu äußerst schrägen Lösungen. Die Japaner kamen auf die Idee, das Wrack mit Tischtennisbällen zu füllen und ihm dadurch Auftrieb zu verleihen. Das ist schon mal schräg. Getoppt wird dieser Plan aber davon, das gesamte Schiff mittels flüssigem Stickstoff in einen künstlichen Eisberg zu verwandeln und diesen dann nach dem Auftauchen in einen Hafen zu schleppen. Das ist zwar kreativ, aber schon nicht mehr schräg, sondern höchst skurril. Einen kleinen Schönheitsfehler hat diese ganze Vorschuss-Kreativität allerdings: Zu diesem Zeitpunkt ist das Wrack noch immer verschollen.
Finden wollte man sie seit langem, doch erst nach 77 Jahren wird der zerschmetterte Leib der Königin der Meere am 1.9.1985 aufgespürt – auch Ballard braucht zwei Anläufe, bis er das dunkle Massengrab in fast 4000 Metern Tiefe fast auf den letzen Drücker seiner Expedition ortet. Endlich ein paar greifbare und belastbare Fakten, die aus dem Schlick des Meeresbodens ans Tageslicht gelangen. Man könnte nun annehmen, dass jetzt mit der Gewissheit endlich Ruhe im Gerüchte-Karton herrschen würde. Weit gefehlt. Robin Gardiner und Dan van der Vat gossen zum Beispiel auch lange nach dem Fund noch viel Atlantik-Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker und fabulierten von einem gewaltigen Versicherungsbetrug der Reederei. Statt der Titanic soll ihr Schwesterschiff Olympic vor Neufundland liegen. Absichtlich versenkt. Klar. Man sieht, Unmengen an Publikationen und Ideen. Manches gut recherchiert, anderes purer Humbug.
Mit der Totenruhe des Wracks ist es seit Ballards erstem Besuch Essig. Unvorsichtigerweise posaunte er gleich nach dem Fund die tatsächliche Sinkposition gegenüber einem seiner Sponsoren aus, was diese nicht für sich behielten. Dank moderner Technik hat sich das Wrack seitdem zu einem ziemlichen Touri-Magneten entwickelt – sofern man die Kohle dafür hat. Telly Savallas moderierte eine Fernsehshow von dort aus und James Cameron tauchte hinab, um an authentisches Filmmaterial für seinen verkitschten Streifen zu kommen. (Die Untergangssequenz stützt sich aber zu hundert Prozent auf Ballards Theorie, was ihn alleine deswegen sehenswert macht.) Russen sowie die Franzosen haben sich auch schon mehrfach dort unten getummelt; obwohl die Wissenschaft gerne vorgeschoben wurde, nicht immer zum Besten der alten Lady. Die Schatzjäger haben Teile gehoben und durch schiere Unachtsamkeit vermeidbare Schäden verursacht. Die oft postulierten Schätze hat man trotzdem nie gefunden.
Dabei haben sie sich den Zorn der internationalen Gemeinschaft zugezogen, die der Meinung ist, dass die Grabschänderei ein Ende haben muss. Hier muss man Ballard zugute halten, dass er von Anfang an gegen eine kommerzielle Ausschlachtung des Schiffes war. Denn um nichts anderes handelt es sich. Mal abgesehen davon, dass solche Plünderungen auch immer gefährlicher werden. So ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Wrack begünstigt durch den starken Rostbefall unter seinem Eigengewicht zusammenbrechen wird. Schätzungen zufolge verwandelt sich die bis jetzt noch halbwegs ansehnliche Bugsektion in einigen Jahren in einen unförmigen Trümmerhaufen. Der Zerfallsprozess hat ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Das infolge einer Implosion beim Untergang schon arg gebeutelte (und dadurch wesentlich schlechter erhaltene) Heck gleicht jetzt bereits einem Schlachtfeld aus verdrehtem, rostigem Metall.
Noch reckt die Titanic stolz und trotzig ihren steilen Bug aus dem Schlamm, in welchem sie in aufrechter Lage ihre vorletzte Ruhe gefunden hat. Ein gespenstisches Bild. Irgendwann wird sie auch den allerletzten Kampf verlieren: den gegen die omnipräsente Korrosion. Die Natur lässt sich nicht nur nicht besiegen, sie fordert unerbittlich auch alles wieder zurück, was man ihr entnommen hat. In diesem Fall vielleicht sogar mit einem ironischen, siegessicheren Lächeln. Der Kreis hat sich dann geschlossen, und nur noch ein riesiger Rostfleck in der ewigen Dunkelheit der Tiefsee wird zurückbleiben. Doch solange es eine Geschichtsschreibung gibt, existiert die gefallene Titanin in den Köpfen weiter und wird immer wieder zu ihrer schicksalsträchtigen Jungfernfahrt aufbrechen, von der es keine Wiederkehr gibt – als sinnbildliche Mahnung gegen menschliche Überheblichkeit und überkommenes Klassendenken.
_Das Buch_
Selbstverständlich rekapituliert ein solches Werk die Vorgänge von der Kiellegung über markante Wegmarken in ihrem recht kurzen Leben bis hin zum Untergang. Bis man allerdings bis zum fraglichen Teil des Fundes vorstößt, dauert es eine Weile und man muss Ballards Schwadroniererei hinsichtlich der Vorbereitung der Expedition und seines von ihm entwickelten Suchsystems über sich ergehen lassen. Inklusive einer ganzen Reihe technischer Defekte und der ersten fehlgeschlagenen Expedition unter seinem Kommando. Der Leser wird dröge in die hohe Kunst des „Rasenmähens“ eingeführt, ein guter Vergleich, wie ich finde. Hierbei wird der Meeresgrund tatsächlich streifenweise mit Sonar abgegrast. Ausgebrachte Transponder erlauben eine exakte Positionierung des eigenen Schiffes innerhalb dieses Sonar-Netzwerks, zusätzlich vertraut man auf GPS. Das hätte man aber getrost kürzen können und/oder stattdessen dem Wrack mehr Aufmerksamkeit widmen können. 252 Seiten sind für eine so umfangreiche Thematik, allein zur Titanic selbst, knapp bemessen.
Zugute halten muss man Ballard, dass diese ersten Suchfahrten zwar das Wrack zutage brachten, jedoch aufgrund widriger Umstände eine ausgiebige Begutachtung nicht zuließen. Erst 1989 kehrte er mit besserem Equipment noch einmal zurück und konnte zusätzliche Untersuchungen durchführen. Drucklegung der Erstveröffentlichung war aber schon 1987, also gut zwei Jahre nach dem spektakulären Fund und Auswertung der bisherigen Ergebnisse. Spätere Auflagen wurden mit den neueren Erkenntnissen bereichert und aktualisiert. Viel war das nicht, fügte aber weitere Puzzlesteinchen ins Bild, über die man vorher nur spekulieren konnte, die nun aber beweisbar wurden. Legendär ist Ballards Ausflug mit dem Tauchroboter „Jason“ in den großen Ballsaal, der erstmals faszinierende Einblicke ins Innere des Wracks gewährte. Vorher waren ihm nur Außenaufnahmen möglich gewesen.
Das Buch ist reichhaltig bebildert und lebt zum Teil alleine davon. Dies ist Ballards erste (und bis heute andauernde) Zusammenarbeit mit Illustrator Ken Marschall. Ein Glücksgriff. Niemand sonst versteht es, Wrack-Panoramen so akribisch-detailreich und stimmungsvoll mit dem Airbrush auf Leinwand zu bannen. Und das nur anhand von Beschreibungen und Bildausschnitten, denn man darf nicht vergessen, dass die Sichtweite des Lichtkegels in dieser Tiefe mit dem damaligen Equipment nur rund 15 Meter betrug. Zwei ausklappbare Panoramabilder zeigen seine eindrucksvolle Arbeit und auf den Rückseiten die Schnittzeichnung bzw. den Originalaufriss des Schiffes und eine Fotomontage des Ist-Zustandes aus der Draufsicht. Neben Marschalls zahlreichen Illustrationen sicher ein Highlight der Publikation. Der Text beinhaltet eine Menge interessanter Informationen und zeitgenössischer Darstellungen, hat aber einen leicht hochnäsigen und selbstdarstellerischen Unterton.
_Fazit_
Sieht man von der typisch Ballardschen Selbstbeweihräucherung mal ab, ist dies ein lohnenswertes Buch für alle, die sich für das berühmte Schiff und insbesondere das Wrack interessieren. Ballards Stil ist gewöhnungsbedürftig, das ändert sich mit erst mit späteren Projekten, bei denen er Rick Archbold als Redakteur, historischen Berater und Co-Autor stärker einbindet. Dieses Werk hier ist noch ziemlich Ballard pur, ohne Archbolds Feinschliff, mit allen seinen schon damals erkennbaren Schrullen – wenngleich der Vorfall mit den düpierten Franzosen immerhin Erwähnung findet und teilweise von ihm entschuldigt wird. Das muss man anerkennen, obwohl es sich aus seiner Feder naturgegeben anders darstellt. Bleibt zu erwähnen, dass die wertigere Hardcover-Ausgabe wegen der größeren Bilder vorzuziehen ist – beide Versionen sind mittlerweile out of print, jedoch sowohl als Hardcover als auch Taschenbuch immer noch recht problemlos erhältlich. Ein Dauerbrenner, wie das Thema an sich und Pflichtlektüre für Freunde („Fans“ erscheint mir in diesem Zusammenhang doch etwas pietätlos) der alten Lady.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Originaltitel: „The Discovery Of The Titanic“
Ersterscheinung: 1987 – Madison Publishing Inc. / NY
Deutsche Ersterscheinung: 1987 – Ullstein / Berlin
Übersetzung: Ralf Friese und Jutta Wannenmacher
Zugrundeliegende Version: Hardcover / 7. Auflage 1993
Derzeit letzte Drucklegung: November 2000
Seiten: 252 / durchgängig bebildert + 2 ausklappbare Panoramen
ISBN: 3-550-07653-3 (HC) – out of print
ISBN: 3-548-23280-9 (TB) – out of print
Vielleicht eine mögliche Erklärung, warum das vorliegende Buch erst 22 Jahre nach der englischen Fassung auch bei uns erschien, ist wohl der Hype, den Peter Jackson dank seiner Verfilmung der „Herr der Ringe“-Trilogie losgetreten hat. Mittelerde ist aber viel mehr als nur der Ringkrieg, was sich in den vielen auf den Markt geschwemmten Publikationen zum Film nur zum Teil widerspiegelt. Fosters „Das große Mittelerde-Lexikon“ befasst sich jedoch nicht nur mit diesem kleinen Ausschnitt, sondern liefert interessante Backgrounds in Stichwortform über die gesamte Bandbreite von Tolkiens faszinierender Welt. Bemerkenswerterweise stammt das Werk diesmal nicht von |Klett-Cotta|, dem angestammten Tolkien’schen Haus- und Hof-Verlag in Deutschland, der sich sonst für die Publikationen hierzulande (fast) exklusiv verantwortlich zeichnet, sondern von |Bastei Lübbe|.
_Zum Inhalt_
Für diese aktuell gültige Fassung des Lexikons aus dem Jahre 1978 sind die Informationen aus vielen Quellen auch außerhalb des Herrn der Ringe zusammengetragen worden. Unter anderem: „Letters“ (dt.: „Briefe“), „Lost Tales of Middle-Earth“ (dt.: „Das Buch der verlorenen Geschichten Mittelerdes Band 1 und 2“), „The Silmaril“ (dt.: „Das Silmarillion“) und aus „The Hobbit“ sowie anderen Publikationen, wie „The History of Middle-Earth“ (dt.: „Nachrichten aus Mittelerde“) oder „The Adventures of Tom Bombadil“, um nur die Wichtigsten zu nennen. Zumindest letzteres Werk dürfte hierzulande kaum bekannt sein, da es auf Deutsch bislang noch nicht veröffentlicht wurde.
Bereits im Vorwort weist der Autor darauf hin, dass er lediglich „hofft“, ein vollständiges Werk abgeliefert zu haben, das frei von Fehlern ist – hierzu muss man wissen, dass die Geschichten von Tolkien (da über einen Zeitraum von Jahrzehnten verfasst und zusammengetragen) selbst immer wieder von ihm redigiert und angepasst wurden. Somit sind durchaus erkennbare Inkonsistenzen in der Logik oder Doppeldeutungen unausweichlich, für die Foster nichts kann und die in der Natur der Sache liegen. Wann immer Begriffe nicht eindeutig zuzuordnen sind, wird jedoch gesondert darauf hingewiesen.
Für die deutsche Version zeichnet sich Helmut W. Pesch verantwortlich, dem es oblag, sogar noch mehr Arbeit investieren zu müssen, da die deutschen Versionen, Nomenklaturen, Eigennamen etc. nicht nur teils stark von den Originalen Tolkiens abweichen, sondern zudem zwei verschiedene Übersetzungen in deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurden. Die Neueste stammt von Wolfgang Krege (2000) und gilt gegenüber der von Margaret Carroux und E. M. von Freymann (letzte Überarbeitung 1991) als die exaktere – wenn auch viele die Ur-Übersetzung für die stimmungsvollere halten. Dementsprechend musste für die Eindeutschung des Lexikons wesentlich mehr Aufwand betrieben werden.
Neben dem etwa 750 Seiten starken Hauptteil des alphabetisch sortierten Lexikons finden sich am Anfang das Vorwort des Autors, das Vorwort des deutschen Überarbeiters und Übersetzers und eine kurze Einführung, wie dieses Buch zu verwenden ist. So erhält der interessierte Leser einen kurzen Einblick hinter die Kulissen der wichtigsten Sprachen und Zeitrechnungen Mittelerdes, ihre Grammatik und Unterschiede der Deutungen. Im Anhang stehen noch einige Ahnentafeln und Zeitleisten zur Verfügung, an denen man ablesen kann, wann welche Kultur innerhalb der vier Zeitalter mit welcher Sprache gesprochen hat oder noch „heute“ (will heißen: zur Zeit des Ringkriegs) spricht.
Die meisten Begriffe, die uns in Tolkiens Werken begegnen, sind auf „Quenya“ (der Sprache der Hochelben, „Eldar“ genannt) oder auf „Sindarin“ (der Sprache der Grauelben, der „Sirdar“ und „Noldor“) basierend. Hinzu kommt die Gemeinsprache, der sich alle verschiedenen Völker untereinander bedienen: das „Westron“ (die Sprache der Westernis „Númenor“, die einen Teil von allem enthält), sowie spezielle lokale Dialekte, beispielsweise etwa die Sprachen der Hobbits, Rohirrim oder auch Mordors. Wann immer ein ethymologischer Zusammenhang besteht oder Mehrfachbedeutungen vorhanden sind, so ist meist ein Querverweis dazu vorhanden oder die Begriffe stehen (mehrfach) direkt untereinander mit unterschiedlichen Erklärungen nebst Quellenangaben.
_Meinung_
Der Stoff dürfte den meisten viel zu trocken daherkommen und richtet sich ausschließich an Hardcore-Fans und wirklich Interessierte, die tiefer in die komplexe Materie von Tolkiens Welt einzutauchen gedenken. Zwar sind die Querverweise und Erklärungen zu den Begriffen ganz nett zu lesen, verraten aber demjenigen, der nicht oder nur wenig mit der Geschichte Mittelerdes vertraut ist, sicherlich nicht viel. Um das Buch wirklich schätzen zu können, bedarf es der Kenntnis nicht nur der Filme und des Romans zum Herrn der Ringe und dem Hobbit. Die meisten, die sich dieses Buch eventuell zulegen möchten, werden sicherlich zumindest diese Teile der Story kennen und deshalb mehr erfahren wollen.
Leider setzt das Lexikon in einigen Passagen die Print-Versionen der Romanvorlagen und auch des Silmarillions voraus („leider“ ist hier als Relativ zu verstehen – diese Bücher gehören eh in jede Bibliothek). Auf das ihnen beigelegte Kartenmaterial wird oftmals verwiesen, doch dem Lexikon selbst hat man weder Illustrationen noch eigene Karten spendiert, was ich bedauerlich finde, denn „Fremde“ bekommen hier Orte um die Ohren gehauen, die als böhmische Dörfer gelten, wenn man zum Beispiel nur die Filme kennt oder aber den Herrn der Ringe zwar irgendwann mal gelesen, jedoch die Bücher nicht (mehr) zur Hand hat.
Über die Vollständigkeit der behandelten Begriffe kann man nicht meckern, bislang habe ich zu jedem Komplex, zu dem ich weitere Informationen suchte, auch tatsächlich Auskunft erhalten, wenn auch manchmal über Umwege, weil das entsprechende Wort zwar gelistet, aber eben an anderer Stelle erläutert wird. So springt man zuweilen von Querverweis zu Querverweis, bis man schlussendlich die gewünschte Information gefunden hat. Das ist bei Lexika aber nun wirklich nichts bahnbrechend Neues – schließlich ist es kein Roman, der eine Geschichte chronologisch erzählt, sondern ein Nachschlagewerk.
Ein interessanter Aspekt ist, dass man im Vorbeilesen ganz andere Dinge findet, als man explizit gesucht hat, und sich dann immer weiter festliest. Auf seiner Suche nach anderen Informationen stolpert man über diese fast automatisch, weil sie einem per Zufall ins Auge springen, wenn man sich von Schlagwort zu Schlagwort hangelt. Das Nachschlagewerk ist bestimmt kein Buch, das man von vorne nach hinten (quasi buchstäblich von A bis Z) durchackert und hinterher die Weisheit Mittelerdes mit Löffeln gefressen hat, vielmehr greift man dazu, wenn man bestimmte Namen, Orte oder Begebenheiten wieder in Erinnerung rufen und die Zusammenhänge besser verstehen lernen will. Nebenher nimmt man eine Menge der von Tolkien eigens für Mittelerde erfundenen Sprache(n) auf.
_Fazit_
Wer alleine nur die bisher erschienenen Verfilmungen gesehen hat, mag sich das fette Nachschlagewerk für recht günstige zehn Euro gerne zulegen. Es ist ein guter Anfang, um weiter ins faszinierende Thema Mittelerde einzudringen, wird aber dem Betreffenden höchstwahrscheinlich nicht sehr hilfreich sein, denn die Filme reißen das Gesamtbild allenfalls leicht an. Leser der Romane Mittelerdes kommen da schon etwas besser weg und werden eine ganze Menge bekannter Gestalten, Mythen und Begebenheiten wiederfinden, doch auch hier gibt es zu bedenken, dass der Ringkrieg zwar das umfassendste Werk ist und auch den Löwenanteil in diesem Lexikon einnimmt, doch nicht wenige der Begriffe und Personen sind aus den früheren Zeitaltern entlehnt.
Die Kenntnis (mindestens) des Silmarillions ist somit schon fast absolute Bürgerpflicht, von der restlichen als Quellen angegebenen Literatur mal ganz zu schweigen. Man muss schon den Willen mitbringen, sich auch auf eine vollkommen ausgestaltete, fiktive Sprache einzulassen, will man das Lexikon effektiv nutzen und vor allem verstehen. Trotzdem muss auch ich, als recht beschlagener Fan, das Fehlen von Kartenmaterial oder Illustrationen bemängeln. Neueinsteigern verwehrt das den Zugang zum ansonsten exzellenten Nachschlagewerk enorm. Im Gegensatz zu manch unnötigen 08/15-Publikationen, die im Kielwasser der Filme rausgehauen wurden, gehört das große Mittelerde-Lexikon fraglos zu den wirklich empfehlenswerten Veröffentlichungen aus dem Bereich der Sekundärliteratur über Mittelerde.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Originaltitel: „The Complete Guide to Middle-Earth“
– Ein alphabetischer Führer zur Fantasy-Welt von JRR Tolkien –
Genre: Sekundärliteratur / Quellenliteratur
Ersterscheinung: 1971, überarbeitet 1978 – Ballantine / Random House
Deutsche Erstveröffentlichung: Dezember 2002 – Bastei Lübbe
Übersetzung und Überarbeitung: Helmut W. Pesch
Titelillustration: Arndt Drechsler
Seiten: 810 / Paperback
ISBN: 3-404-20453-0
In David Hewsons Thriller „Semana Santa“ dreht sich die Handlung um eine mysteriöse Mordserie während der Karwochen-Feierlichkeiten in der spanischen Hafenstadt Cadíz. Verfilmt wurde das Ganze auch schon, allerdings sollen Bücher ja grundsätzlich besser sein – ob das so stimmt, wollen wir nun einmal am Exempel prüfen.
_Hasta la vista, Baby – Zur Story_
Mit „Semana Santa“ bezeichnet man in Spanien die feierlichen Massenumzüge in der gesamten Karwoche vor Ostern, bei dem jede Gemeinde einer Stadt mit ihrer eigenen Madonnenfigur an der Kathedrale vorbeidefiliert und die ihren Abschluss (Gründonnerstag) in einer „Corrida“ findet, dem traditionellen Stierkampf. Wir befinden uns im Cadíz der Jetztzeit, der berühmten südspanischen Hafenstadt, wo eine ganze Woche lang pseudoreligiöses Highlife herrscht, was die örtliche Polizei jedes Jahr aufs Neue vor schier unlösbare Probleme stellt. Im Schutze des quasi unbeherrschbaren Trubels dieser Woche finden seltsame und bestialische Morde statt.
Als Erstes erwischt es ein verschrobenes Bruderpaar, das augenscheinlich neben seiner provokanten künstlerischen Arbeit und ebenso schrägen Lebensart auch Kontakte zur Homosexuellenszene hatte. Man hat die Leichen der beiden schön barock herausgeputzt und nach Art eines alten Bildes von Leál drapiert. Gespickt sind die Leichen der Angel-Brüder mit bebänderten Pfeilen, wie sie auch beim Stierkampf verwendet werden, um den Stier zu triezen. Auch die eigentliche Mordwaffe passt ins Bild: Ein Degen, der für den finalen Tötungsakt in der Arena benutzt wird. Ist der Killer also ein durchgeknallter Torrero?
Zentrale Figur der Geschichte ist Maria Guitterrez, die eigentlich nichts mit Kriminalistik am Hut hat, doch mit ihren 33 Jahren schon einen Universitäts-Professorentitel aufweisen kann. Sie wurde vom Innenministerium nach Cadíz geschickt, um sich die Polizeiarbeit näher anzuschauen und eventuell Optimierungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Eher widerwillig schleppen die Beamten sie zunächst mit an die Tatorte, sie halten sie für einen berichteschreibenden Spitzel und eine Belastung bei den Ermittlungen, doch gelingt es ihr nach und nach, einige wichtige Puzzleteile zusammenzufügen und den „Kollegen“ des eingesetzten, männlichen Ermittlerteams Respekt abzuringen.
Doch auch der Killer ist von ihr sehr angetan, was sie unweigerlich in sein Fadenkreuz und somit in Gefahr bringt. Doch was sind die Motive des – eine rote Büßerkutte tragenden – Kapuzen-Mörders? Religiös verbrämte Rache? Oder einfach nur Spaß daran, zu töten wie ein Torrero und dabei die Polizei durch geschickte Winkelzüge zum Narren zu halten? Der Schlüssel zur Lösung liegt weit in der Vergangenheit, genauer gesagt in den Wirren des frankofaschistischen, spanischen Bürgerkriegs im Jahre 1936 und dem gefürchteten Gefangenenlager „La Soledad“ … Wer in der Gegenwart überleben will, muss die Vergangenheit aufarbeiten und sich auch seinen persönlichen Teufeln stellen.
_Olé! – Meinung_
Klerikal angehauchte Kriminalgeschichten haben Hochkonjunktur. Hewson („Das Blut der Märtyrer“) zu unterstellen, er würde auf der Welle mitschwimmen, zieht in diesem Falle nicht, denn als das Buch 1996 veröffentlicht wurde, war man von dem heutigen Hype, der dieses Genre umweht, noch weit entfernt. Zudem ist der religiöse Touch auch nur vordergründig und dient als Kulisse für die Geschichte, die Wahrheit liegt tiefer verborgen. Bis die Tarnung auffliegt, fabriziert er einige recht unerwartete Wendungen, was den Spannungsbogen generell nicht abflachen lässt.
Lediglich die oft verwendeten Flashbacks in die Vergangenheit sind mir mitunter etwas zu langatmig, selbst wenn sie dazu dienen, das Motiv langsam herauszukristallisieren und am Ende Licht ins Dunkel zu bringen. Das hätte Hewson ein wenig straffen können, doch ist dies nur ein eher schwacher Kritikpunkt, erfüllt diese Vorgehensweise doch den Zweck, die Pro- und Antagonisten besser auszuarbeiten. Die haben es zum Teil auch echt nötig, aufgepeppt zu werden.
Die Charakterzeichnung leidet nämlich ein wenig unter dem Wechselspiel zwischen Rasanz und den eher ruhigen Ermittlungspassagen, sodass die verwendeten Figuren häufig etwas klischeehaft daherkommen. Da wäre die fähige, intelligente aber zunächst geschnittene Provinz-Polizistin, die sich innerhalb der von Männern dominierten Welt der spanischen Polizei erst ihre Sporen und den Respekt ihrer chauvinistischen Macho-Kollegen verdienen muss. Die entsprechen im Endeffekt auch großteils dem typischen Bild: harte Schale, weicher Keks … Verzeihung: Kern. Stilistisch nicht gerade berauschend neu und in etlichen anderen Romanen auch schon so – oder so ähnlich – praktiziert. Kalter Kaffee.
Dass die Protagonistin dann schlussendlich auch in den sexuellen Fokus des Serienkillers (und somit in Lebensgefahr) gerät, konnte man sich schon fast denken – den Ausgang im Groben auch. Interessant, dass gerade (in den von mir oben leicht bekrittelten) Flashbacks und ihren Personen dieses Stereotyp nicht gepflegt wird und literarische Vielschichtigkeit durchblitzt. Ob dieser Gegensatz gar beabsichtigt ist, sei dahingestellt, er ist in jedem Falle ausgesprochen augenfällig.
Wie es sich für einen Vertreter der Serial-Killer-Fraktion geziemt, kommt diesem Part natürlich ein besonderes Augenmerk zu. Detailliert beschreibt Hewson die vermeintlichen Ritualmorde und aufgefundenen Leichen am Tatort. Zeitweise vermeint man den Verwesungsgeruch in der Nase zu haben. Ab und zu darf der Leser auch „live“ dabei sein, wenn der große Unbekannte auf die Jagd geht, was einen Einblick in seine Psyche gewährt, jedoch dankenswerterweise seine Identität zunächst nicht enthüllt.
Erst gegen Ende des Katz-und-Maus-Spiels lichtet sich der Schleier um die Person des Täters und Hewson gibt dann offener etwas mehr über ihn preis. Alles Finte? Viele der Spuren erweisen sich tatsächlich als Sackgassen und Tricksereien seitens des Autors. Selbst wenn man meint, jetzt wäre es gelaufen, fehlen immer noch einige Puzzleteilchen, die das Motiv vollständig erklären. Und dingfest gemacht ist der Schuft damit erst recht noch nicht. Das behält Hewson sich für den fulminanten Showdown vor, wenn aus dem Psychothriller eine hektische Hetzjagd wird. Bis es dazu jedoch kommt, erlebt der Leser eine Menge spanischer Kultur, extremen Katholizismus, Pädophilie und soziologische Ränkeschmiede in blutiger Form.
_Psychoanalyse – Fazit_
Psychothriller mit Serienmördern stammen aus Amerika und spielen auch dort. Ein Trugschluss. Auch in Europa ist es durchaus möglich, einen guten Thriller zu schreiben und ihn auch dort stattfinden zu lassen – dachte sich Hewson und liefert einen atmosphärisch dichten Roman mit leichten Schwächen ab. Trotz seiner versuchten Verschleierungstaktik ist die Handlung oft vorauszusehen bzw. zumindest zu erahnen. Die Idee, das Motiv so weit in der Zeit zurückzuverlegen, ist nicht übel, hat aber streckenweise einige Längen. Langweilig ist das Buch indes nicht, hätte an einigen Punkten aber weniger Belanglosigkeiten gut vertragen können.
Der Plot an sich ist schlüssig, logische Lücken finden sich keine, obwohl es sicher nicht einfach war, die Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart vernünftig und nachvollziehbar miteinander zu verknüpfen. Wären nur die Figuren und deren Handeln nicht so berechenbar und genretypisch ausgefallen, hätt’s durchaus auch für eine bessere Beurteilung meinerseits gelangt. So bleibt ein solider Roman mit ordentlichem Unterhaltungswert. Trotz blutigem Verwirrspiel aber ziemlich leichte Kost für eingefleischte Krimi- und Thrillerfreunde, die den Schinken innerhalb kürzester Zeit durch haben dürften. Lesenswert, aber ohne Chance auf Kultstatus. Übrigens ist das Buch um Klassen besser als die Verfilmung.
Amis haben für gewöhnlich ein ziemlich seltsames Bild von uns Europäern und wehe sie ziehen dauerhaft hierher, dann kann es eigentlich nur Komplikationen und Verwicklungen geben. Sogar solche, die bis ins 16 Jh. zurückreichen. So ergeht es Tracy Chevaliers Protagonistin, als sie mit ihrem Mann berufsbedingt nach Frankreich übersiedelt. Dem Text auf dem Buchrücken nach bietet es sich an, die Geschichte spontan als einen der derzeit höchst beliebten klerikalen Thriller einzustufen. Ein Irrtum. So viel zur Erwartungshaltung. Ob und inwieweit der Eindruck des Teasers beabsichtigt ist, um auf der Welle mitzuschwimmen, soll einmal dahingestellt sein. Doch worum handelt es sich bei dem Roman „Das dunkelste Blau“ nun eigentlich wirklich?
_Die Autorin_
Tracy Chevalier ist gebürtige Amerikanerin des Jahrgangs 1962, wuchs in Washington D.C. auf und lebt heute in London. Vor ihrem Creative-Writing-Studium an der East Anglia University, das sie 1994 abschloss, arbeitete die Quereinsteigerin als Lektorin für Nachschlagewerke. Weitere von ihr erschienene Romane: „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ (List, TB 06/2001), „Wenn Engel fallen“ (List, TB 10/2003) und „Der Kuss des Einhorns“ (List, HC 02/2004). [Quellen: Verlagsinfo und amazon.de]
_Zur Story_
Ella Turner und ihren Mann Rick zieht es nach Frankreich. Er ist ein gefragter Architekt und arbeitet an einem Projekt in Toulouse, das sicher mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Somit ist der Umzug nach Frankreich in ein verschlafenes Nest in den französischen Chevennen ein recht dauerhaftes Unterfangen. Ausgesucht hat das neue, abseitige Domizil jedoch Ella, deren Familie vor Generationen aus Frankreich nach Amerika übersiedelte und ihren Namen von Tournier in Turner änderte. Seit ihrer Ankunft in Land des Weichkäses und ihrer Ahnen wird sie von immer wieder dem gleichen Albtraum heimgesucht, in welchem die Farbe Blau eine immens wichtige und traurige Rolle spielt. Zugleich üben die beiden, Nachwuchs zu bekommen, doch gerade der Sex macht die Albträume nur noch schlimmer und intensiver. Ihrem Mann offenbart sie sich jedoch nicht.
Da sie als Hebamme im Gastland nicht praktizieren darf, weil ihr dafür die Zulassung fehlt, und Rick sehr mit seinem Job beschäftigt ist, sucht sie sich Ablenkung. Sie fühlt sich als Fremdkörper im Dorf – man schneidet sie gepflegt in der Nachbarschaft, obwohl sie sich redlich Mühe gibt, ihr verschüttetes Französisch stetig aufzubessern und sich anzupassen. Sie fühlt sich hier auch irgendwie „zuhause“. Es hilft nichts. Kurzum, sie hat niemanden, mit dem sie sich austauschen könnte. Keine Freunde, keine Verwandten. Lediglich ein Cousin in der relativ nahen Schweiz, den sie bislang noch nicht persönlich kennen gelernt hat. Getrieben von innerer Unruhe – vorerst als selbst auferlegte Beschäftigungstherapie – fängt sie enthusiastisch an, ihre Familiengeschichte zu recherchieren und herauszufinden, warum sie im Traum in blitzsauberem Französisch Bibelzitate von sich geben kann.
Ella spürt, dass die Geschichte ihrer Ahnen mit dem stets wiederkehrenden Traum in direktem Zusammenhang steht. Ihre Intuition gibt ihr Recht, doch stellen sich Erfolge beim Wühlen nach alten Dokumenten nur schleppend ein. Dafür findet sie im hiesigen Bibliothekaren Jean-Paul einen zunächst widerwilligen und abweisenden Mitstreiter, der ihr dann aber immer tatkräftiger unter die Arme (und später auch unter den Rock) greift. Das Auffinden einer alten Familienbibel aus dem Besitz der Tourniers bringt sie endgültig auf die Spur eines schrecklichen Verbrechens, das Jahrhunderte zurückliegt. Genauer gesagt aus der Zeit, als die Protestanten Frankreichs – die Hugenotten – unter dem immer mehr um sich greifenden Katholizismus zu leiden hatten und vertrieben wurden. Mitten in dieser Welt des (Aber-)Glaubens spielte sich eine Tragödie in der Familie ab, die Ella in der Jetztzeit so viel Kopfzerbrechen bereitet …
_Meinung_
Schon zu Beginn des Romans erhält der Leser einen Einblick in die Vergangenheit. Genauer gesagt in die Familiengeschichte derer von Tournier, von denen Ella abstammt. Zunächst kann man sich auf die recht wirren und in schneller Zeitrafferfolge präsentierten Fetzen aus der Familienhistorie allerdings keinen klaren Reim machen. Das legt den Grundstein für später immer deutlicher zu Tage tretende Analogien und Parallelen zwischen Ella und ihrem Pendant aus dem 16. Jahrhundert: Isabelle de Moulin. Anfänglich sind diese Flashbacks noch sauber durch Kapitel von der Geschichte in der Gegenwart getrennt, später überschneiden sich die Stränge in schnellerer Abfolge und mogeln sich gegen Ende sogar absatzweise in den Plot. Als weitere Unterscheidung erzählt Chevalier Ellas Geschichte in der Ich-Form, Isabelles Part hingegen beobachtend in der dritten Person.
Man hat den Eindruck, dass besonders Isabelle rudimentäre übersinnliche Fähigkeiten besitzt – zumindest was ihre Connection zu Ella angeht, stimmt das auch irgendwo. Chevalier deutet vermeintlich vorhandene Hexenkünste in diesem Zusammenhang allenfalls nur an. Zum Teil auch recht deutlich, wie beim Bild des immer wieder auftauchenden Wolfes, den Isabelle ganz selbstverständlich als Reinkarnation und Sinnbild ihrer toten Mutter versteht, die helfend in ihr Leben eingreifen will. Leider werden einige dieser vielversprechenden Ansätze in letzter Konsequenz nicht genügend genutzt, um dem Plot mehr Substanz zu verleihen. Solche Festlegungen, ob hier nun tatsächlich paranormale Mächte am Werk sind, oder doch alles nur Aberglaube ist, bleiben dem Leser überlassen. Der kleine Schuss Mystery verpufft ziemlich wirkungslos.
Die wichtige (wie ich finde) Frage, warum die beiden Frauen auf irgendeine Weise miteinander verbunden sind, bleibt auch am Ende der Geschichte nur vage angedeutet. Wie so vieles. Das gilt auch und speziell für die Personenzeichnung. Die Figuren sind bis auf Ella sehr zweidimensional beschrieben und vegetieren als gesichtslos und vorhersehbar agierende Schablonen vor sich hin. Selten lässt sich Chevalier mal zu detaillierteren Beschreibungen ihrer Charaktere und deren Motive hinreißen. Überraschungen in deren Handeln braucht man demzufolge auch nicht zu erwarten, auch von der Protagonistin nicht. Vollkommen linear entwickelt sich die Geschichte genau in die Richtung fort, wie man es sich beim Lesen gedacht hat. Mit Ausnahme der vielen „toten Links“, d. h. Nebenhandlungen, die aus unerfindlichen Gründen einfach nicht weiterverfolgt werden und frei schwebend irgendwo in der Luft enden.
Man ist versucht, „Das dunkelste Blau“ ziemlich schnell als „Frauenroman“ abzustempeln, und tatsächlich bedient der Roman einige der beliebten Klischees, die diesem häufig zu Unrecht negativ konnotierten Begriff andichtet werden. Eine Dreiecksbeziehung gefällig? Geht klar! Die alte In-der-Fremde-doch-noch-ne-beste-Freundin-gefunden-Leier? Biddeschön, kommt sofort! Sex? Verkauft sich immer gut und ist im Doppelpack auch billiger. Okay, wollen wir mal nicht so ungerecht sein und einräumen, dass sich der Schnulzfaktor in erträglichem Rahmen bewegt. Natürlich landet die von ihrem Mann unverstandene und vernachlässigte (Die Klischees bitte nacheinander eintreten – Danke!) Ella mit dem Nebenbuhler – nebst einem ganzen Sack voller Gewissensbisse – in der Kiste. Beinahe zufällig. Vollkommen ungewollt und unerwartet. Hust. Die Beschreibungen der horizontalen Vergnüglichkeiten fallen harmlos aus, da gibt’s Deftigeres – erotisch sind sie aber auch nicht.
Den Leser dürstet es natürlich, das Kuddelmuddel am Ende aufgelöst zu wissen. Wer mit wem und wie und warum überhaupt. Nach den ganzen Sackgassen in der Handlung wähnt man sich im Recht, die Auflösung des Rätsels zu erfahren. Das gelingt Chevalier aber nur zum Teil, die Geschichte und der damit verbundene tragische Mordfall in der Familie Tournier während der Hugenotten-Vertreibung im Jahre Fuffzehnhundertpiependeckel bleibt ungesühnt. Die Schuldigen werden nicht bestraft, de facto erfährt man eigentlich gar nichts weiter. All die kleinen eingearbeiteten Hinweise sind für die Katz bzw. für den Wolf. Den Reißwolf. Dass das letzte Drittel ganz besonders mit der heißen Nadel geklöppelt wurde, bemerkt man an einigen Inkonsistenzen, stellvertretend etwa das plötzliche Auftauchen der Figur Lucien, den Chevalier schlichtweg vergessen hat, zuvor in irgendeiner Form vorzustellen.
Die mühselig aufgebaute und konstruierte Handlung in der Vergangenheit ist historisch ganz gut recherchiert, doch vergeudet Chevalier hier um des lauen Finales in der Gegenwart Willen jede Menge Potenzial, mehr in die Tiefe zu gehen. Die böse Schwiegermutter, der patriarchische Ehemann (Volle Deckung – schon wieder tief fliegende Klischees!), ja, selbst Isabelle, der man so arg und übel mitgespielt hat – immerhin eine wichtige Schlüsselfigur – verschwinden in bester Cliffhanger-Manier schlussendlich im Vakuum der Story. Absolut unbefriedigend. Stattdessen gibt’s ein versöhnliches (aber wenig überraschendes) Schlag-auf-Schlag-Ende für Ellas Albträume, den Beziehungsstress und die Akklimatisierungsprobleme in der neuen Heimat. Und verständnisvolle Verwandte hat sie auf einmal auch gefunden, zusätzlich zur neuen besten Freundin – versteht sich.
_Fazit_
Würde man die ganzen Platitüden streichen, die in losen Enden münden, wär’s eine schöne und übersinnlich angehauchte Novelle geworden. Alternativ dazu wäre eine detailliertere Ausarbeitung der vorhandenen guten Ansätze dazu angetan gewesen, aus dem Roman viel mehr heraus zu kitzeln. So jedoch überwiegt das recht uninteressante Füllwerk, um als recht plattes Transportmedium für die sich anbahnende Romanze zu dienen. Wischiwaschi. Wer aufgrund des Covertextes mit einem sakralen Thriller vom Schlage eines Eco oder Brown rechnet, sei gewarnt.
„Das dunkelste Blau“ ist eine – im wahrsten Sinne des Wortes – triviale Criminal-Love-Story mit einem kleinen Touch von Mystery, den Tracy Chevalier aber leider nur oberflächlich streift. Dank der unscharfen Figurenzeichnung und der vorhersehbaren Handlung sicherlich keine schwere Kost und zwischen Suppe und Kartoffeln schnell durchgelesen. Empfehlenswert höchstens als seichte Bettlektüre für schlaflose Genre-Liebhaber. Wer Gehaltvolleres mag, macht einen Bogen um diese künstlich aufgepumpte und dadurch recht unausgegoren wirkende Kurzgeschichte.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Originaltitel: „The Virgin Blue“
Penguin, London 1996
Deutsche Erstveröffentlichung: dtv München 1999
Übersetzung: Agnes C. Müller
ISBN: 3-423-20702-7 (2. ungekürzte TB Neuauflage 05/2004)
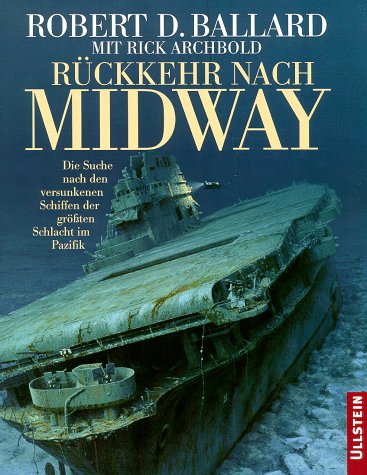
Ein Schauplatz erbitterter Kämpfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sind die Pazifik-Insel Guadalcanal und der darauf befindliche Flughafen „Henderson Field“ von Japan und Amerika während des WK II heiß umkämpft, doch in der Konsequenz ziemlich unwichtig gewesen – Als eine tragische Ironie des Krieges lieferten diese taktisch eigentlich unsinnigen Kämpfe den größten bekannten Schiffsfriedhof, der dem Meeresgrund dort auch den treffenden Namen „Eisen-Sund“ einbrachte, weil unzählige Wracks sich dicht an dicht in der Tiefe quasi aneinander reihen. Die dort abgehaltenen Seeschlachten standen seit jeher im Schatten der Land- und Luftkämpfe, die dieses idyllische Eiland immer wieder heimsuchten.
Bekannt geworden ist Guadalcanal daher auch eher durch Serien wie „Pazifik-Geschwader 214 – Die schwarzen Schafe“ oder neuerlich mit dem Anti-Kriegs-Streifen „Der schmale Grat“. Dass sich dort ganze Kriegsschiff-Flotten unerbittlich beharkt haben, ist dagegen zumindest hierzulande fast in Vergessenheit geraten. Robert D. Ballard hat sich 1993 wieder einmal mit seinem beispiellosen Tiefsee-Equipment aufgemacht, um den dort liegenden stummen Zeugen des Wahnsinns einen Besuch abzustatten … Ganze 13 gespenstische Wracks wurden von seinem Team gefunden und erforscht, was der vorliegende Bildband „Versenkt im Pazifik – Schiffsfriedhof Guadalcanal“ eindrucksvoll illustriert.
_Historischer Hintergrund_
Die Schlachten um die Salomonen-Insel Guadalcanal im süd-östlichsten Ende des von Japan kontrollierten Pazifiks fanden über mehr als drei Monate hinweg statt (August – November 1941). Primär war dabei die Kontrolle des auf der Insel befindlichen „Henderson Airfield“, den man als Ausgangsbasis für den gesamten südlichen Raum gut nutzen konnte. Sowohl die Japaner als auch die Amerikaner sahen in der unscheinbaren Insel den Schlüssel zur Nierderringung des Gegners, da beide davon ausgingen, dass eine jeweilige Invasion nicht durch den Zentral-Pazifik, sondern über die bewohnten Inselgruppen erfolgen müsse. Wenn man so will, ein kriegerisches Island-Hopping, das sich in der Nachlese der Geschichte aber als falsch erwies, da die wirklich elementaren Gefechte beispielsweise genau dort erfolgten, wo keiner der beiden Kontrahenten (aufgrund der bescheidenen Versorgungslage) sich mit dem anderen duellieren wollte.
Waren die Gefechte bei Midway und Truk noch zeitlich auf wenige Stunden oder Tage ziemlich begrenzte Einzelgefechte zwischen Marineverbänden, die den Krieg letztendlich entscheiden sollten, handelte es sich beim Konflikt um die Salomonen-Insel laut einem Zeitzeugen eher um eine „blutige Kaschemmen-Prügelei“, bei der keine Seite trotz sämtlicher aufgebotener Truppengattungen (nicht nur Schiffe, sondern auch Flugzeuge, Panzer und Infanterie) wirklich einen Sieg erringen konnte. Dementsprechend häufig wechselte Guadalcanal dann auch immer wieder den „Besitzer“. Trafen Flottenverbände mal auf keine maritimen Gegner oder gegnerischen Frachter, feuerten die Schlachtschiffe auch gern auf Landziele und unterstützten somit ihre Bodentruppen mit der Schiffs-Artillerie oder deckten mit ihren FLAK-Kanonen den Luftraum ab, während man wieder mal versuchte, die Insel einzunehmen und/oder zu verteidigen.
Der Schiffsfriedhof von Guadalcanal ist die direkte Konsequenz dieses Hin und Hers und verdeutlicht wie kaum ein zweiter Ort die Sinnlosigkeit, einen völlig unwichtigen Flecken Erde mit allerhand Menschen und Technik zu umkämpfen, nur um anschließend festzustellen, dass die wirklich entscheidenden Schlachten ganz woanders geschlagen werden. So war das Gerangel um Guadalcanal, gemessen am taktischen Nutzen, reine Verschwendung von Mensch und Material auf beiden Seiten, dem nicht wenige Schiffe, Flugzeuge, Panzer und Fußtruppen zum Opfer fielen. „Gewonnen“ haben diesen Konflikt die Amerikaner; nach der Versenkung des japanischen Superschlachtschiffes |Kirishima| war der Widerstandswille der japanischen Invasionsflotte ziemlich gebrochen und es begann nunmehr die Zeit der Bodentruppen, versprengte und verschanzte Nester des Gegners auszuheben … Bei den erlittenen Verlusten der Amerikaner kann man aber wahrlich nicht von einem „Sieg“ reden.
_Die Mitwirkenden_
Dr. Robert D(uane) Ballard ist Meeresgeologe an der |Woods Hole Oceanographic Institiution|, Mitglied der |National Geographic Society| und seit seiner Entdeckung der |Titanic| schon eine Berühmtheit unter den Tiefseeforschern, wenn auch nicht überall wohl gelitten. Sein zweiter Geniestreich war das Auffinden des deutschen Schlachtschiffes |Bismarck| und dessen Erforschung. Ballard steht in dem Ruf, viel Wert auf Publicity zu legen – einige seiner Wissenschaftskollegen mögen ihn dafür nicht sonderlich. Auf der anderen Seite ist eine solche Expedition mit einem immensen Kostenaufwand verbunden, also was Wunder, wenn er seine Funde entsprechend vermarktet und die Werbetrommel für die US Navy rührt, auf Basis deren Technik er seine Forschungen durchführt. Man kann über ihn denken, was man will – er ist und bleibt der Shooting-Star unter den heutigen Unterwasser-Archäologen, der mit seinem System schon so manches verschollene Wrack aufspüren konnte.
Rick Archbold, ein angesehener Historiker, dessen berühmtestes eigenes Werk „Hindenburg“ ist, eine minutiös geschriebene Recherche über die Tragödie des deutschen, gleichnamigen Luftschiff-Stolzes LZ119, welches in den 30er Jahren bei Lake Hurst verunglückte. Auch in diesem Band sorgt Archbold wieder dafür, dass sich Ballard ganz auf die Schilderung der eigentlichen Suche in den Tiefen des Pazifiks beschränken kann, den historischen Part setzt er gewohnt neutral in Text- und Bildform um, was sich allerdings auf alle Waffengattungen und die politischen Hintergründe bezieht und nicht nur auf die Seeschlachten (diese nehmen aber den größten Teil ein). Dabei kommen auch wieder unzählige Geschichten zusammen, die das Ausmaß der Sinnlosigkeit der Zerstörung rund um Guadalcanal verdeutlichen und illustrieren.
Ken Marshall ist der Illustrator, der auch schon einen ganzen Bildband mit Titanic-Motiven herausbrachte – Ich kenne niemanden, der gerade diese Art bedrückender Wrackbilder so plastisch per Airbrush und Pinsel darstellen kann. Auch er ist seit dem Titanic-Band für Ballard in jedem seiner Bücher für die Illustration der Wracks zuständig und hat auch hier (wieder einmal) das Titelbild erschaffen, wobei er bei „Versenkt im Pazifik“ einen Teil des Wracks des australischen Kreuzers |Quincy| zusammen mit dem Tauchboot „Sea Cliff“ verwendet hat. Sehr düster und bedrohlich, ein Bild, das mir wieder mal eine Gänsehaut über den Rücken jagt.
_Das Buch_
Ballards dritte große Expedition zu gesunkenen Schiffen führte ihn also 1992 nach Guadalcanal; diesmal bedient er sich wieder seiner gerühmten „Rasenmäher“-Such-Technik, wobei er mittels GPRS seine Position ständig auf den Meter genau feststellen kann und dabei einen Sonarschlitten im Schlepp knapp über dem Meeresboden hinter sich herzieht. Dieser liefert Bilder und Sonarreliefs der Umgebung in die Leitzentrale des Forschungsschiffes. Ballard wird nie müde, den Lesern dieses Suchmuster unter die Nase zu reiben, allerdings sind die Wracks im Suchgebiet diesmal so dicht gedrängt und auch der „Eisen-Sund“ längst nicht so tief wie die Fundstellen der Titanic und der Bismarck, daher ist ein Auffinden irgendwelcher Wracks diesmal wahrlich nicht das Problem. Die Exkursion bleibt Wunder-Oh-Wunder weitgehend von den sonst Ballard-üblichen Pannen verschont.
Auch hier, wie bei der Titanic, greift Ballard nicht nur zu seinen ferngesteuerten Video-Augen, sondern begibt sich selbst in seinem tiefseefesten Minitauchboot „Sea Cliff“ (dem Nachfolger seines legendären „Alvin“) zu einigen der interessanteren Wracks hinunter – das hat den Vorteil, dass er dort sein ferngesteuertes Tauchboot „Scorpio“ zusätzlich in Winkel schicken kann, die sonst nicht bildtechnisch zu erfassen oder für das bemannte Boot zu gefährlich sind. Dementsprechend detailliert kann dann auch hernach Ken Marshall seine Arbeit aufnehmen und die einzelnen Schiffe sehr stimmungsvoll und genau darstellen. Glücklicherweise finden sich in diesem Bildband wieder die ausklappbaren Seiten, welche die perfekten Illustrationen auf ein dreifaches Panorama ausbreiten – meist sind noch markante Fakten darauf verzeichnet, die in der Bild-Legende erklärt werden, d.h. hier wird auf besonders interessante Fundstellen hingewiesen.
Rick Archbold ist für die Aufbereitung der geschichtlichen Hintergründe zuständig. So besteht das Buch zwar aus einem großen Teil Wrackbildern und den Tauchgängen, die Hintergründe werden aber dennoch ausführlich von ihm dargestellt. Zu beinahe jedem Wrack gibt Archbold Augenzeugenberichte oder andere Quellen betreffend des Schicksals zum Besten. Er beschränkt sich aber nicht nur auf die Seeschlachten selbst, sondern liefert gleichzeitig noch interessante Nebeninformationen; sei es der Kampf an Land oder in der Luft, wenn’s geht sogar mit genauem Datum und Uhrzeit, damit man sich vom zeitlichen Zusammenhang der Ereignisse ein gutes Bild machen kann. Archbold heroisiert keine Seite und verhält sich bei seinen Recherchen sehr neutral, Ballard setzt dagegen manchmal etwas mehr auf Showmanship und Pathos, weswegen er wohl auch wieder Überlebende der Schlachten an Bord seines Forschungsschiffs eingeladen hat.
_Fazit_
Reich an verschiedenen Schiffen und die Sinnlosigkeit dieses Krieges durch die gut präsentierten geschichtlichen Hintergründe verdeutlichend, kann man dieses Buch als eines der besten Ballards bezeichnen, vor allem durch das Fehlen größerer Pannen und deren sonst so melodramatische Beschreibung, konzentriert sich „Versenkt im Pazifik“ auf die Geschichte der einzelnen Wracks. Der Leser bleibt diesmal von ausladenen Erklärungen, wie, wo und warum man genau |so| nach versunkenen Schiffen sucht (und nicht anders) verschont, die sonst Ballards Werke schmücken. Das zeigt, dass Ballards Bücher am besten sind, wenn der notorische Selbstdarsteller mal ein wenig zurücksteht und sich sein Co-Team hauptsächlich um den Inhalt kümmert.
Archbold liefert erneut einen akkuraten historischen Hintergrund ohne Pathos und sehr neutral, während der einfach geniale Ken Marshall wieder einmal seine Klasse beweist, die Unterwasserszenen bildlich darzustellen. Einen besseren Illustrator für die Unterwasser-Stilleben wird man heutzutage kaum finden. Daher kann mein Urteil sowohl für den mittlerweile schwer erhältlichen |out of print|-Bildband als auch das immer wieder neu aufgelegte Taschenbuch (wobei der großformatige Bildband mir wesentlich lieber ist) auf „absolut lesenswert“ lauten.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Originaltitel: „The Lost Ships of Guadalcanal“
Erscheinungsjahr: 1993 Madison Press, New York
Deutsche Ausgabe: 1993 Ullstein
Übersetzung: Uwe D. Minge
ISBN: 3-550-06384-4 (HC)
ISBN: 3-548-24695-2 (TB)
Illustrationen: Ken Marshall
Ausführungen: HC (OOP) und TB; 228 bzw. 232 Seiten
zahlreiche S/W- und (ausklappbare) Farbbilder
Wir schreiben das Jahr 1260 in Köln, der Kölner Dom befindet sich noch im Bau unter der Leitung des genialen, visionären Baumeisters Gerhard Mortat. Doch eine dunkle Verschwörung, von der Gerhard Kenntnis haben muss, wird ihm zum Verhängnis. Schon zu Beginn der Geschichte werden wir Zeuge, wie ein gewisser Mathias und ein gewisser Heinrich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den gedungenen Killer Uruqhart anheuern, der den Baumeister erledigen und eine weitere – bislang unbekannte – Aufgabe übernehmen soll. Uruqhart tut, wie ihm geheißen, kauft sich zwei Zeugen, die den Mord später als einen Unfall bekunden, und als sich die Gelegenheit bietet, schubst er Gerhard dezent vom Baugerüst des Doms.
Allerdings hat er nicht mit einem richtigen Zeugen gerechnet, der sich gerade an bzw. in den erzbischöflichen Apfelbäumen gütlich tut: Jacop, genannt „Der Fuchs“, seines Zeichens ein kleiner, unbedeutender Dieb. Eigentlich wollte Jacop nur (illegal) seinen Hunger stillen, fällt aber vor lauter Schreck über die schattenhafte Gestalt und die Tat aus dem Baum – mehr noch: Da der Baumeister sich noch bewegt, überkommt ihn der irrige Gedanke, ihm vielleicht helfen zu können. Alle Vorsicht vergessend, setzt Jacop im Schweinsgalopp herüber zum Gestürzten und dieser lebt tatsächlich noch lang genug, um dem Tagedieb ein paar Worte ins Ohr zu flüstern, bevor er sich endgültig aufmacht, vor seinen Schöpfer zu treten.
Jetzt heißt es: nichts wie weg! Jacop hockt hier mitten auf dem Domplatz wie auf dem Präsentierteller, der Mörder hat ihn unter Garantie gesehen, sodass ein Rückzug mehr als angebracht erscheint – keine leichte Aufgabe für jemanden, der mit seinem leuchtenden Rotschopf auffällt wie eine Knackwurst in der Maibowle. Dennoch schafft er es dank der unerwarteten Hilfe der (soeben kennen gelernten) Färberstochter Richmodis und eigener Pfiffigkeit, den kaltblütigen Attentäter abzuschütteln. Denkt er. Doch als er seine unglaubliche Story zweien seiner engsten Freunde erzählt, werden diese etwas später von ungewöhnlichen Armbrustbolzen durchbohrt von ihm aufgefunden.
Der Killer hat seine Witterung also doch nicht verloren und beseitigt nun alle, die das Geheimnis kennen könnten. In seiner Not und auch leicht verletzt sucht Jacop Richmodis nochmals auf – ihr Onkel Jaspar Rodenkirchen ist Physikus (Arzt), hatte sie beiläufig erwähnt. Der ist von Jacops Geschichte derart fasziniert, dass er beschließt weiterzuforschen, was den Stein erst richtig ins Rollen bringt. Jacop ist nämlich unfreiwillig in eine Fehde zwischen dem Erzbischof und einigen reichen Patrizierfamilien geschlittert, und die dulden bei ihrem Komplott nun mal keine Mitwisser. Jetzt befinden sich außer Jacop zu allem Überfluss auch noch seine neu gewonnenen Freunde und Helfer Richmodis, ihr Vater Goddert von Weiden und ihr Onkel Jaspar in höchster Todesgefahr und somit auf der Abschussliste des Killers …
_Meinung_
Die Basis des Plots steht auf wahren Begebenheiten, tatsächlich ist Gerhard Mortat in besagtem Jahr unter ungeklärten und mysteriösen Umständen vom Baugerüst des Kölner Doms zu Tode gestürzt. Desweiteren sind auch die Patrizier, wie die Overstolzens, die Weisens und die Kohns historisch korrekt, Gleiches gilt natürlich auch für Erzbischof Konrad. Auch wenn Schätzing behauptet: „die Hälfte der Figuren spielt sich selbst“, so ist die Handlung als solche frei erfunden und bedient sich lediglich der Personen, um diesen mittelalterlichen Kriminalfall realistischer erscheinen zu lassen.
Mystery sucht man vergebens, denn schon auf den ersten Seiten wird klar, dass es sich um ein Komplott handelt und mindestens drei (Mit-)Täter sind dem Leser sogar schon mal namentlich bekannt, peu à peu zieht die Verschwörung dann immer weitere Kreise, wobei man sich schon bald denken kann, worauf das Ganze im Endeffekt hinausläuft. Hauptaugenmerk liegt demnach darauf, wie es Jacop und seine Freunde schaffen, die Verschwörung aufzudecken und von dem eiskalten Profi-Meuchler Uruqhart dabei nicht abgemurkst zu werden.
Der Schreibstil Schätzings ist locker und flockig, auch wenn er gerne auf archaische Begriffe zurückgreift, die man damals nun einmal benutzte; so mischt er immer wieder kleinere moderne Worte mit hinein, um ein wenig Witz in die Sache zu bringen. Witzig ist das Werk stellenweise wirklich, gerade die Wortgefechte zwischen Jaspar und Goddert sind herzerfrischend komisch – doch auch sonst spielt der Autor geschickt mit Sprache und Figuren. Leider gibt es, wo Licht ist, auch Schatten. So fallen die ausholenden und dozierenden Erklärungen Jaspars zur Geschichte Kölns und der politischen Situation manchmal etwas arg lang und unrealistisch aus. Wenn man Zeit genug hat zu philosophieren, kann die Gefahr, in der man grade schwebt, doch nicht allzu groß sein.
Trotzdem ist das Bild, das Schätzing vom mittelalterlichen Köln und seinen Akteuren zeichnet, lebendig und recht glaubhaft, allerdings ein wenig mit Klischee behaftet und überzeichnet. Die Atmosphäre an sich ist jedoch stimmig und weiß zu gefallen und mitzureißen, da kann ich über minimale Schwächen generös hinwegschauen.
Waren die Erklär-Passagen Jaspars noch sehr weit ausholend, so kommt die Action dennoch nicht zu kurz. Wenngleich manche Ereignisse durchaus vorhersehbar sind, gelingt Schätzing doch die eine oder andere interessante Überraschung. Sehr zu meinem Bedauern geht es am Schluss zu sehr hopplahop dem Ende der Geschichte zu. Hat sich Schätzing vorher noch beinahe akribisch seinen Figuren und der Handlung gewidmet, so geht’s nun einen Tick zu rasant zu, um die Handlung zu einem logischen und befriedigenden Abschluss zu bringen.
Meiner bescheidenen Meinung nach hätte er entweder im Mittelteil die ellenlangen Geschichtsstunden etwas einkürzen und dafür das Ende pfiffiger und ausführlicher gestalten können (wenn er schon eine bestimmte Seitenzahl erreichen musste/sollte) oder er hätte gleich weitere zwanzig bis dreißig Seiten für einen anständigen Showdown drangehängt. Das Ende jedenfalls ist ein ziemlich abrupter Stilbruch und zudem ein veritabler Cliffhanger – Wozu macht er sich die Mühe, die Beziehungen der Charaktere untereinander zunächst tief auszubauen, um dann mit aller Macht auf die Bremse zu treten?
Spekuliert(e) Schätzing gar auf eine eventuelle Fortsetzung und wollte den Erfolg seines ersten Buches erstmal abwarten? Ich bin versucht, genau das anzunehmen, ohne etwas unterstellen zu wollen, doch irgendwie ist mir der Stimmungswechsel am Ende |zu| augenfällig. Bislang jedoch hat sich in diese Richtung nichts entwickelt, keine Fortsetzung in Sicht – vielleicht kommt ja doch noch eine, wenn der Hype um [„Der Schwarm“ 731 ein wenig abgeebbt ist.
_Fazit_
Die Idee, ein Komplott bzw. eine Mordserie ins finstere Mittelalter zu verfrachten, ist auch nicht besonders neu, da hat Umberto Eco mit „Der Name der Rose“ einen Meilenstein geschaffen, der schwerlich zu toppen ist. Eine empfehlenswerte Lektüre für Zwischendurch ohne großen Anspruch; wer mit dem vielen Latein und einigen Begriffen des Mittelalters Probleme hat, bekommt sogar im Anhang ein kleines, nützliches Lexikon geboten. Bis auf die unfreiwilligen, aber trotzdem recht interessanten Geschichtsstunden ein sehr kurzweiliges Buch mit Witz und Charme. Freunde des mysteriösen Thrillers werden wohl ein wenig enttäuscht sein, denn es ist ein Krimi – nicht mehr, nicht weniger -, bei dem die Täter zu Beginn bekannt sind und auch das Motiv selbst dem weniger aufmerksamen Leser relativ schnell klar wird.
Wurde er ruchlos im zarten Alter von 20 Jahren von opportunen, machtgierigen Mitgliedern seines Hofes dahingemeuchelt? Wer war der wohl bekannteste Pharao überhaupt, und warum wurde er so berühmt, obwohl sich jemand offensichtlich sehr viel Mühe gab, seine Person aus den Annalen der Geschichte zu tilgen? Die Gründlichkeit, mit der dies versucht wurde, erwies sich für uns – die Nachwelt – als Segen, denn das prachtvolle Grab des vergessenen Pharaos aus der auslaufenden 18. Dynastie ist 3000 Jahre lang von Grabschändern unberührt geblieben, weswegen Entdecker Howard Carter 1922 quasi eine Zeitkapsel öffnete, die sehr viel Aufschlussreiches über die damalige Zeit verriet – aber nur vergleichsweise wenig über den dort Bestatteten selbst. Zumindest auf den ersten Blick.
In den offiziellen Königslisten von Sethos I taucht sein Name nicht auf und erst nach und nach wird seine Identität enthüllt: Tutenchamun (auch |Tutankhamen|, |Tutankhamun| oder |Tutanchamun|, je nach verwendeter Schreibweise). Er erweist sich, ebenso wie seine Familie, für die Forscher als weißer Fleck in der ägyptischen Geschichte. Sohn (manche mutmaßen gleichzeitig Neffe) von Echnaton, dem Ketzer. Mysteriöser Kindkönig. Quell sämtlicher Gerüchte über den Fluch der Pharaonen. Doch wieso wurde er verfemt? Die Hinweise verdichten sich, dass ein beispielloser Staatsstreich stattfand. Das alte Reich war danach belegbar jedenfalls nie mehr wie zuvor. Paläo-Pathologe Professor Bob Brier spricht gar von einem Mord und er verrät uns in diesem Buch auch, warum er ein Komplott nicht ausschließt …
_Ein Blick ins Album der Familie König – Zum Inhalt_
Tutenchamun wurde unter dem Namen Tutench|aton| als Sohn des später als „Ketzerkönig“ gebrandmarkten Pharaos Echnaton in Acheaton (heute Amarna genannt) geboren. Die Umstände, warum Echnaton (den übrigens nicht wenige mit der biblischen Gestalt des Moses gleichsetzen) die Staatsreligion des Amun-Kultes und Vielgötterei in eine monotheistische Religion um den Gott Aton zu wandeln versuchte, sind mysteriös und nicht restlos geklärt. Fakt jedoch ist, dass es der Amun-Priesterschaft, dem Adel und dem Militär in Theben (der eigentlichen Hauptstadt des alten Ägypten) sicher nicht geschmeckt hat. Die Verlegung der Hauptstadt von Theben nach Tell el-Amarna wohl ebensowenig – die Stadt wurde komplett neu aus dem Boden gestampft, mit einer für Ägypten vollkommen neuen Kunstrichtung und einzig und allein auf die neue Staatsgottheit Aton ausgerichtet.
An dieser Stelle ändert Amenophis IV auch seinen Namen in Echnaton („Der Aton Gefällige“). Etwas Vergleichbares hat es in der gesamten Geschichte Ägyptens noch nie gegeben und wiederholte sich auch nie wieder. Seinen isolatorischen Lebensmittelpunkt verlegt er ebenfalls in die neu gegründete Stadt, zusammen mit seiner Erst-Frau Nofretete und seinen sechs Töchtern, die er mit ihr hat. Er gelobt, die Stadt fürderhin nicht mehr zu verlassen. Das ehemals mächtige Reich beginnt unter seiner Ägide böse zu wanken und büßt wirtschaftlich sowie militärisch viel von seinem Glanz ein.
Tutenchaton jedoch ist nicht der Sohn Nofretetes, sondern der Zweit-Frau Kija, die bereits Tutenchatons älteren Bruder Semenchkare zuvor gebar. Sie verstirbt – höchstwahrscheinlich – auf dem Kindsbett bei der Geburt Tutenchatons, jedenfalls verschwindet sie abrupt aus den Aufzeichnungen und einige Indizien und Grab-Malereien belegen, dass Kija tatsächlich die Niederkunft nicht überlebte. Echnaton hat zwei potenzielle Thronfolger aus dieser Verbindung, Nofretete kann offensichtlich nur Töchter gebären. Die beiden Prinzen wachsen recht behütet und wohl auch abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf, jedenfalls zeigen die gefundenen Szenen aus dem Leben derer von Echnaton stets nur ihn und Nofretete mitsamt Töchtern als liebevolle Familie, auch das ist ein Bruch mit der traditionellen Darstellungsweise in der ägyptischen Kunst.
Echnaton ernennt in der Tat den zehn Jahre älteren Bruder Tutenchatons – Semenchkare – zu seinem Mitregenten (und dieser wird somit offiziell zum designierten Nachfolger erhoben), doch etwa zwei Jahre später verstirbt der älteste Sohn – woran oder warum konnte bis heute nie ganz geklärt werden. Tutenchaton rückt somit automatisch nach, doch ist er erst vier und wohl grade erst dabei, das Schreiben und die anderen Pflichten eines Prinzen zu erlernen.
Es dauert weitere fünf Jahre, bis ihn das Schicksal zum jüngsten König machen soll: In seinem 17. Regierungsjahr und zwei Jahre nach dem Tode Nofretetes und mittlerweile aller Töchter – bis auf Anchesepaaton – stirbt auch Echnaton. (Das heißt, manche glauben, er sei nicht gestorben, sondern als Moses mit den Semiten nach Judäa gezogen … Doch das ist eine andere Geschichte.) Tutenchaton und Anchesepaaton werden von General Haremhab und Wesir Eje zur Krönung nach Theben geleitet. Als engster Berater des jungen Prinzen und Mittler zwischen der Priesterschaft managt Eje die Inthronierung des unmündigen Tutenchaton, wobei es ein paar Hürden zu bewältigen gibt: Als Erstes muss der junge König mit Anchesepaaton vermählt werden, denn er ist als Kind der Zweit-Frau Echnatons ein „Halbblut“ und nicht berechtigt, ohne weiteres den Thron zu besteigen, erst die Heirat mit seiner Halbschwester verleiht ihm die Königswürde, denn sie ist die Tochter Nofretetes und somit „reinen Blutes“.
Um die Rückkehr zum alten Pantheon zu verdeutlichen, werden selbst die Namen der beiden geändert: in Tutenchamun und Anchesenamun – nichts soll mehr an ihren ketzerischen Vater erinnern. Doch das reicht offensichtlich nicht. In kurzer Folge werden Echnatons Stadt Amarna und sämtliche kulturelle Andenken ausgemerzt – glücklicherweise jedoch nicht zu hundert Prozent, denn einige Teile der Bauwerke und Reliefs wurden nur halbherzig umgebaut oder zum Bau anderer (Amun-)Kultstätten wiederverwertet, sodass sie 3000 Jahre später aufgrund ihres frappant anderen Stils von Archäologen entdeckt wurden und uns Zeugnis von einigen Vorgängen ablegen können. Vieles davon befindet sich im heutigen Luxor und kann sogar besichtigt werden.
In seinen letzten neun Jahren, die er nominell das Reich regiert, erstarkt Ägypten wieder und läuft unter General Haremhab auch zur gewohnten militärischen Stärke auf. Hinter den Kulissen ziehen jedoch aus nachvollziehbaren Gründen ganz andere die Fäden als Tutenchamun, nämlich das Triumvirat seiner Berater: Haremhab, Eje und der „königliche Schreiber“ Maja (quasi der Finanzminister). Sie vergrößern ihren Einfluss stetig. Das persönliche Glück des jungen Pharaonenpaares steht ebenfalls unter einem schlechten Stern, denn obwohl die beiden ein scheinbar inniges Verhältnis zueinander haben, gestaltet sich die Geschichte mit der Thronfolge als sehr schwierig. Anchesenamun erleidet eine Totgeburt (es wäre ein Mädchen gewesen) und beim zweiten Versuch kommt die neuerliche Tochter vier Monate zu früh und stirbt. Der letzte Pharao der 18. Dynastie bleibt weiterhin ohne erbberechtigte Nachkommen.
Der Pharao ist nunmehr 19 Jahre alt und wird aller Wahrscheinlichkeit nach so langsam in seine Rolle gewachsen sein und seinen eigenen Kopf zu entwickeln beginnen. Offenbar ist es nun höchste Zeit, dass ihm selbiger eines Nachts eingeschlagen wird und zwar auf äußerst subtile Weise. Das vermutet Brier jedenfalls. Sein Wesir Eje ergreift erstaunlich schnell die Regierungsgeschäfte, lässt sich zum Pharao krönen und nimmt zu allem Überfluss die Witwe Anchesunamun zur Frau, kann sich aber nicht lange halten. Er stirbt vier Jahre nach der Machtübernahme, hat aber zuvor versucht, seinen Vorgänger ebenso aus den Annalen der Geschichte zu löschen wie dessen Vater Echnaton. Sein Nachfolger wird – man ahnt es bereits – General Haremhab und begründet so als Erster die Reihe der „Soldatenkönige“ in Ägypten. Erst 3000 Jahre später soll man die Puzzleteile dieses altertümlichen Krimis zusammenfügen können, als das Grab des „Unbekannten Pharaos“ 1922 entdeckt und Jahrzehnte später (1968) die Mumie zum ersten Mal geröntgt wird.
_Beweisaufnahme – Pharao Jürgens Meinung_
Briers Theorie wirft ein sehr menschelndes und lebendiges Licht auf buchstäblich tote Geschichte; es liegt in der Natur der Sache, dass hier viel hineininterpretiert werden kann. Er macht davon auch regen Gebrauch, wobei er stets versucht, seine angeführten Punkte soweit es geht mit Fakten zu untermauern, was freilich nicht immer gelingt. Das äußert sich schon darin, dass er einen sehr großen Teil des Buches darauf verwendet die dunkle Familiengeschichte Tuts aufzurollen (was ich weiter oben zusammengefasst habe, stellt nur einen Bruchteil dar) und sie als Schlüsselpunkt für seinen Kriminalfall heranzuziehen.
Betrachtet man diese sehr wirre und lückenhaft dokumentierte Zeit des politisch-religiösen Umbruchs in der ägyptischen Geschichtsschreibung, so ist dies keine leichte Aufgabe und dementsprechend häufig blanke Interpretation, der man folgen mag oder eben nicht. Seine Rekonstruktion der Vorgeschichte war bereits mehr als einmal Gegenstand hitziger Diskussionen und gerade in letzter Zeit immer wieder Stoff für ein aufflammendes Interesse am wohl berühmtesten Pharao in den Medien.
Briers Ausführungen haben einiges für sich, bieten sie doch so manche Antwort darauf, warum genau diese Epoche und die geheimnisvolle Vita Tutenchamuns und seiner Familie nur fragmentarisch erhalten blieben. Sehr belastbar ist die These nicht in allen wichtigen Punkten, hat aber auch eine Menge gut durchdachter Ansätze und nachvollziehbarer Begründungen für sich. Einige seiner Kollegen mögen seiner Argumentation trotzdem so gar nicht recht zustimmen, während sie bei anderen Ansichten mit ihm konform gehen. Dass der junge Pharao keines natürlichen Todes gestorben ist, gilt in der Fachwelt nämlich als gesichert, stellt sich nur die Frage, ob dort tatkräftig und mithin absichtlich nachgeholfen wurde. Brier ist jedenfalls dieser festen Überzeugung, was er nicht nur durch Herleiten einer langen Indizienkette, sondern anhand von Fotos auch schlüssig zu stützen versucht.
In den späteren forensischen Untersuchungen anhand von in den 60er Jahren angefertigten Röntgenbildern Tuts und der lange unbeachteten (und kaum bekannten) Mumien seiner beiden totgeborenen Töchtern wird’s dann aufgrund der wissenschaftlich überprüfbaren Sachlage weitaus weniger spekulativ. Dies ist auch sein angestammtes Fachgebiet als Mumienexperte respektive Paläo-Pathologe. N24, ZDF und GEO stürzen sich in letzter Zeit gerne auf den Lieblingspharao.
Brier ist dort immer wieder als Fachberater mit von der Partie, rückt aber mittlerweile von einigen seiner damaligen Erkenntnisse im Buch teilweise ab. Kein Wunder, war er doch wegen der wilden Spekulationen – die sich eben nicht auf seine Arbeit, sondern seine Interpretationen des Drumherums bezogen – aus der Fachwelt ganz schön unter Beschuss geraten. Man hielt ihn für nicht kompetent, sich als Historiker zu betätigen, während man seine pathologische Arbeit durchaus würdigte. Eine ziemlich überhebliche Sichtweise, wie ich finde. Seine Kernaussage hat jedoch auch noch nach sechs Jahren seit der Erstveröffentlichung Bestand:
Der ominöse Knochensplitter im Inneren des Kopfes, der die Gemüter von Wissenschaftlern seit seiner Entdeckung erhitzte und schon 1968 für die ersten Mordtheorien sorgte, ist seiner Untersuchung nach kein Beleg für die Todesursache. Seine Meinung ist, dass dieser von einer Ungeschicklichkeit bei der Einbalsamierung herrührt, soll also demnach erst nach dem Tode entstanden sein. Vielmehr sind er und einige Gerichtsmediziner einem vermutlichem Hämatom nahe des Übergangs zwischen Genick und Hinterkopf auf die Spur gekommen.
Das Hämatom an ausgerechnet diesem Teil des Kopfes ist durch einen Unfall kaum zu erklären (zumindest höchst unwahrscheinlich) und daher vermutet Brier (zusammen mit einigen anderen), dass diese Verletzung absichtlich durch einen gezielten Schlag auf diese empfindliche Stelle herbeigeführt wurde. Die teilweise Verknöcherung dieses ehemaligen Blutgerinsels legt den Schluss nahe, dass Tutenchamun schätzungsweise etwa einen Monat lang damit gelebt haben kann, einen Teil davon im Koma, bis dann letztlich der Tod eintrat.
_Abschlussplädoyer – Fazit_
Bob Briers Schlussfolgerungen entbehren durchaus nicht einer nachvollziehbaren Logik, sind aber in Ägyptologenkreisen nicht ganz unumstritten, denn für viele Behauptungen fehlt letztendlich der Beweis in Form von Inschriften o. ä. – sprich: Die Hardware. Somit müssen die hier dargebrachte Mordfall-Story und hergeleitete Indizienkette gegen die vermeintlichen Tatverdächtigen mit den wenigen wirklich nachprüfbaren Fakten aus Fundstücken und Autopsien dennoch hochspekulativ bleiben, doch das trifft auf die Lehrmeinung ebenso zu, welche sich allzu oft als ebenso falsch erwiesen hat.
Unfall, Mord oder gar Komplott? Das Mord-Szenario ist eine durchaus denkbare Variante, sofern Briers angestellte Mutmaßungen über den Hintergrund akkurat sind. Beweisen lässt es sich nicht, ein Unfall kann nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Die dargebrachten Verdachtsmomente würden heutzutage wohl vor Gericht kaum Bestand haben und nicht zu einer Verurteilung der beiden von Brier bezichtigten Hauptangeklagten führen: In dubio pro reo. Kurios und mysteriös genug bleibt das Leben und Sterben des jungen Regenten auch nach Lesen des interessant und flüssig geschriebenen Buches. Brier fügt dem Puzzle fantasiereich einige weitere Teile hinzu, doch bin ich sicher: Das letzte Wörtchen ist in diesem Fall noch nicht gesprochen.
|Originaltitel: „The Murder Of Tutankhamen. A True Story“
Ersterscheinung: 1998 – G. P. Putnam’s Sons / NY
Deutsche Übersetzung: Wolfgang Schuler
354 Seiten – diverse s/w-Fotos im Mittelteil|
Der sagenumwobene Orden der Erleuchteten ist zurück, jedenfalls in Romanform. Als Liebhaber von Verschwörungstheorien ist so etwas natürlich genau meine Kragenweite. Geschichte, Mythen und Geheimgesellschaften finde ich extrem faszinierend, vor allem, weil man davon ausgehen kann, dass in allem immer ein Körnchen Wahrheit steckt. Gerade die Illuminaten haben in der Riege der mystischen Kulte einen hohen Stellenwert in der Historie, manche meinen sogar, dass sie selbst heute noch hinter den Kulissen die wahren Weltherrscher sind, die auch das tagesaktuelle politische Geschehen über unsichtbare Kanäle diktieren.
Man mag das glauben oder nicht, es steht jedoch mit Sicherheit fest, dass die Bruderschaft seit jeher ein ausgesprochen konspirativer Haufen gewesen ist, der jede Menge Anlass zu Spekulation bietet. So auch im vorliegenden Roman von Dan Brown, der die Erleuchteten zum finalen Kampf gegen den Vatikan fiktiv auferstehen lässt – mit sehr hohen Erwartungen ging ich das Werk auch an.
_Allgemeines zum Thema_
Wer oder was sind die „Erleuchteten“ denn eigentlich und gab/gibt es sie wirklich? Für die präzisere Beantwortung der Frage muss man schon weiter ausholen: Die Illuminaten (oder korrekter: |Illuminati|) sind/waren ein dem Klerus feindlich gesonnener Geheimbund aus meist hochintelligenten Persönlichkeiten und gehen laut einigen Autoren sogar zurück bis auf den berühmten italienischen Wissenschaftler Galileo Galilei, andere verdächtigen auch den Templer-Orden schon zur Zeit der Kreuzzüge als Wurzel. Belegen lässt sich das nicht exakt, nach offizieller Lesart war der Bayer Adam Weishaupt der erste offizielle Illuminatus und Begründer des Ordens. Den Beweis, dass sie immer noch bis in die Moderne existieren, leiten Konspirologen immer wieder gern von der 1-US$-Note ab. Die Pyramide mitsamt des seltsamen Textes |“Ordo Novus Seclorum – Annuit Coeptis“| und das |Allsehende Auge| sind blitzsaubere Illuminati/Freimaurer-Symbolik und -Rhetorik.
Doch zurück zu den Urvätern der Loge. Im Laufe der Zeit wurden die Mitglieder von der Kirche zu Ketzern und Satanisten abgestempelt, das war insofern leicht, als sie „Luzifer“ (sinngemäß: „Lichtbringer“, von ital.: Luce = Licht) quasi im Namen tragen. Schon damals wirkte plumpe Propaganda Wunder. Waren die Illuminaten ursprünglich aufklärerische Freidenker, mutierte die Organisation von Generation zu Generation in einen regelrechten Kirchenhasser-Verein, dessen Methoden, die christliche Gotteslehre zu untergraben, immer diffiziler und auch drastischer wurden. Weishaupt selbst galt als Fürsprecher eines elitären Denkens und Handelns, was unter anderem die Ausrottung der Schwachen und Dummen beinhaltete. Diese Doktrin haftet dem Geheimbund auch heute noch an. Sofern man daran glaubt.
Etliche Gräueltaten wurden auf beiden Seiten verübt und es entstand eine Jahrhunderte dauernde Fehde zwischen beiden Lagern, bei der es Illuminati immer wieder unerkannt bis in höchste weltliche Ämter schafften oder gar klerikiale Zirkel infiltrierten und dort von innen heraus gegen die Kirche wirkten – auch vor Gewaltakten gegeneinander schreckte man beiderseits nicht zurück. Die direkte Reaktion Roms auf die vermeintliche Gefahr lag in der Inquisition. Was die wenigsten wissen: Die Hexenverbrennungen in dieser Periode waren nur Nebeneffekt (und Deckmäntelchen), primär ging es dem Papsttum wohl eher darum, die Illuminaten und wesensverwandte Gruppierungen auszurotten. Der Orden der „Templer“ soll das berühmteste Beispiel für die vatikanischen Säuberungsaktionen gewesen sein.
Doch die umtriebige Bruderschaft hat es mit List und Verschwiegenheit trotz aller Versuche bis in unsere Zeit geschafft zu überleben. Angeblich. In einem Zug mit den Erleuchteten wird auch häufig das Freimaurertum genannt; wenngleich das nicht dasselbe ist, fanden sich gerade unter diesen Freimaurern häufig Mitglieder des mystischen Ordens. Ob der Geheimbund auch heute noch existiert, ist umstritten. Verschwörungstheoretiker werden das sicher mit einem beherzten |Ja| beantworten. Die offizielle Geschichtsschreibung will davon nichts wissen. Es gibt eine ganze Menge sehr guter Literatur über dieses Thema, sodass ich es bei diesem – zugegeben – recht groben Überblick bewenden lassen will …
Mehr unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Illuminatenorden.
_Zur Story_
Eigentlich ist der Mittvierziger Professor Robert Langdon kein wirklicher Abenteurer, sondern ein biederer Dozent und Experte für religiöse Symbolik an der |University of Harvard|, doch der ominös-nächtliche Anruf des Teilchenphysikers Maximilian Kohler vom Genfer CERN-Institut (Conseil Européen pour la Recherche Nuclaire) soll ihm mehr als nur den Schlaf dieser Nacht vergällen. Was Direktor Kohler ihm per Fax schickt, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: Der berühmte Professor Vetra ist im [CERN]http://de.wikipedia.org/wiki/CERN auf grausame Art umgebracht und gebrandmarkt worden.
Das Ambigramm „Illuminati“ ziert den Brustkorb der Leiche auf dem Fax und Langdon wird |stante pede| nach Genf zitiert – sofort und ohne zu packen steigt er in das ultra-moderne Überschallflugzeug des CERN, welches ihn bereits erwartet. Auf seiner nur gut eine Stunde dauernden Reise in die Schweiz hat Langdon schon mal ein wenig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob die berühmte Bruderschaft nach über 50 Jahren Stillschweigen der Erleuchteten tatsächlich wiederauferstanden sein kann und warum dieser grausame Mord überhaupt begangen wurde. In Genf angekommen, lüftet sich der Schleier nur wenig.
Der undurchsichtige, an den Rollstuhl gefesselte Vollblutwissenschaftler Kohler zeigt dem entsetzten Experten aus den USA die Leiche von Vetra, der mit seiner Adoptiv-Tochter Vittoria an einem hochgeheimen Projekt zugange war: Der Erschaffung von [Antimaterie.]http://de.wikipedia.org/wiki/Antimaterie Nach Eintreffen besagter Tochter wird sehr schnell klar, dass es dem Attentäter und seinem Auftraggeber um genau diese hochbrisante Substanz mit der vielfachen Zerstörungskraft konventioneller Nuklear-Sprengköpfe ging. Das Ziel für die („saubere“) Massenvernichtungswaffe steht kurz darauf auch bereits fest – der Illuminatus will sich am Klerus für all die jahrhundertelange Schmach rächen, welche die Kirche der Wissenschaft angetan hat.
In Rom findet gerade das große Konklave statt (die Papst-Wahl) und daher sind alle ranghohen Kardinäle und Aspiraten auf den Job des Pontifex natürlich anwesend. Dank seines [Hashishin]http://de.wikipedia.org/wiki/Assassinen (Assassinen) hat der Illuminatus den Behälter mit der Antimaterie direkt vor den Augen der päpstlichen Schweizergarde in die Vatikanstadt geschmuggelt, doch er will seinen Triumph noch weiter auskosten: Er entführt die vier meistversprechenden Kandidaten auf den Papst-Titel (die sog. |Preferiti|) und plant sie, einen nach dem anderen medienwirksam abtreten zu lassen. Die einzige Chance, die Kardinäle und den Vatikan zu retten, ist, dem alten, rituellen Initiierungs-Pfad der Bruderschaft zu folgen – ein Pfad, der vor Jahrhunderten von niemand Geringerem als Galileo Galilei und den ersten Illuminaten gelegt wurde …
_Meinung_
Vom Start weg weiß „Illuminati“ zu gefallen, der kurze Prolog lässt bereits erahnen, was da alles kommen mag und spätestens, wenn Dan Brown respektlos den ersten hochangesehenen kirchlichen Würdenträger brutal über die Klinge springen lässt, ist man sich nicht mehr sicher, ob die verbliebenen drei Kardinäle die Sache heil überstehen. Ganz zu schweigen von der enormen Antimaterieladung unter dem Vatikan, welche im Umkreis von knapp einem Kilometer alles in einem grellen Lichtblitz pulverisiert, sollte der Behälter nicht innerhalb von insgesamt sechs Stunden aufgespürt werden. So entwickelt sich der anfängliche, rätselhafte Mordfall zu einem teils überaus dogmatisch geführten Überlebenskampf zwischen Kirche, Wissenschaft und Medien.
Bei der Hetzjagd durch Rom und der Spurensuche in alten Archiven sitzt den Protagonisten die Uhr zudem ständig im Nacken. Außer bei den beiden Hauptcharakteren (Robert Langdon und Vittoria Vetra) vermag man zwischendrin nie zu sagen, auf welcher Seite so mancher Handelnde eigentlich steht. Alle Figuren sind gut und lebendig ausgearbeitet, der Schreibstil ist locker, somit ist der Roman trotz der 640 Seiten keine allzu schwere aber dafür umso unterhaltsamere Kost – auch für Gelegenheitsleser.
Die archaischen Puzzles, die es zu lösen gilt, sind intelligent gemacht und verraten seitens des Autorsviel Kenntnis über die Thematik der Bruderschaft und die Strukturen des Vatikans. Er verflechtet hier gekonnt geschichtliche und wissenschaftliche Tatsachen mit Zukunftsmusik, natürlich ist die Geschichte frei erfunden und dürfte sich in dieser Form wohl kaum abspielen, logische Fehler konnte ich jedoch nicht ausmachen und das will bei mir notorischem Nörgler schon etwas heißen.
Ich bin der Thematik ja ohnehin nicht abgeneigt und wie der Autor auch schon im Vorwort erwähnt, stimmen die Örtlichkeiten, die physikalischen Grundlagen und die Historie des Vatikans und auch der Illuminati an sich, das hat er gut recherchiert und gekonnt zusammengefügt. Ein paar Begriffe aus der Mythologie und einige Brocken Italienisch und Latein sind vorteilhaft, diese Dinge werden teilweise unkommentiert stehen gelassen, was, wie ich finde, der Atmosphäre sehr dienlich ist. Der deutsche Übersetzter hat es sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, einige Fußnoten einzufügen, wenn er der Auffassung war, dass einige Begriffe dennoch einer Erklärung bedürfen. Netter Service.
Die aufkeimende und beinahe unvermeidliche Romanze zwischen Robert und Vittoria stört die Geschichte nicht und schwelt dankenswerterweise nur latent im Hintergrund und gleitet nicht in Schnulz & Kitsch ab, das hätte ich Dan Brown auch nicht verziehen. So mutet der Roman ein wenig wie Indiana Jones (speziell: „The Last Crusade“) und einige der guten alten „Drei ???“-Storys an, bei denen es knackige Text-, Logik- und Bilder-Rätsel zu lösen gibt und durch Kombinationsgabe erst am Ende ein Täter feststeht. Gestorben wird auch, und das recht gemein und blutig à la „Sieben“ oder „Resurrection“.
Langdon ist jedoch weit von den Allüren eines Actionhelden entfernt (dem Assassinen ist er körperlich zu hundert Prozent unterlegen und kriegt von dem auch mächtig die Hucke voll) und irrt auch gern mal mit seinen Vermutungen, das macht die Figur menschlich und sympathisch. Vittoria ist ein sehr starker Charakter und bestimmt nicht die berühmte Quotenfrau bzw. der Hauptpreis für den Helden am Ende (mit Sonnenuntergang und all dem Trallala). Sie steuert dank ihrer Orts- und Sprachkenntnis eine Menge bei, außerdem ist sie als Teilchenphysikerin als Einzige mit dem Antimateriekanister vertraut, den sie auch zusammen mit ihrem Daddy entworfen hat.
_Fazit_
Ein äußerst kurzweiliger und rasanter Roman, der auf beeindruckende Art Realität und Fiktion zusammenfügt und am Ende ziemlich unvorhergesehen ausgeht, da Dan Brown es versteht, Nebelkerzen zu werfen und den wahren Hauptschuldigen effektiv bis fast vor Schluss zu verschleiern. Nur wer auf den Punkt genau liest und richtig kombiniert, dem fallen inmitten der Story schon einige Sachen ins Auge, die auf den wahren Initiator dieser von Morden durchzogenen wilden Hatz durch Rom hinweisen. Nebenbei lernt man sogar eine ganze Menge Wissenswertes über (Kunst-)Geschichte.
Dank der flüssigen Erzählweise des Autors fällt es leicht das – zugegeben – etwas dickere Buch komplett durchzuziehen. Das Teil und auch sein Nachfolger „Sakrileg“ gehören endlich verfilmt – es ist eine Schande, dass sich dafür noch kein Filmemacher ereifert hat, denn die beiden um Dr. Robert Langdon gesponnenen Geschichten haben das Potenzial zu richtigen Blockbustern. Wobei ich „Illuminati“ noch als einen Tick besser und origineller empfinde. Klare Lesempfehlung für (noch nicht-)Freunde des intelligenten Thrillers.
http://www.danbrown.com
In letzter Zeit habe ich es offensichtlich mit Romanen, die im kirchlichen Umfeld stattfinden, schon wieder fand ein solcher den Weg in meine Hände. Dank des anstachelnden Klappentexts machte „Die schwarze Kathedrale“ einen überaus interessanten Eindruck. Im Original heißt der Roman übrigens wesentlich treffender |“The Unburied“| nämlich: „Der (oder Die) Unbegrabene(n)“, was der Handlung auch eher gerecht wird. Über misslungene deutsche Titelverballhornungen rege ich mich aber schon lange nicht mehr auf. Solange der Inhalt mich zu fesseln vermag, ist das eher zweitrangig, doch frage ich mich schon gelegentlich, welch Geistes Kinder sich die teils beknackten Eindeutschungen einfallen lassen.
_Zur Story_
Dr. Edward „Ned“ Courtine, seines Zeichens Referent und Lehrer für anglikanische Historie in Cambridge schlägt in der Vorweihnachtszeit 1881 gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Er hat schon lange seinem Ex-Studienkollegen und altem Freund Austin Fickling versprochen, ihn in dessen Wahlheimat Thurchester zu besuchen. In der englischen Kleinstadt befindet sich zudem eine berühmte Kathedrale, in deren Bibliothek er ein bestimmtes Manuskript zu finden hofft, das seine Theorie über den mittelalterlichen König Alfred stützt. Wenn er das Manuskript tatsächlich findet, kann er das von einigen seiner Kollegen gehegte Bild der anglikanischen Geschichte ändern und ihm sogar einen Lehrstuhl einbringen.
Außerdem will Courtine sowieso über Weihnachten zu seiner Nichte und Thurchester liegt genau auf dem Weg, was liegt also näher, als all das miteinander zu verquicken und einen einwöchigen Zwischenstopp dort einzulegen? Er und Fickling haben sich nach einem Streit vor 20 Jahren nicht mehr gesehen und das Wiedersehen verläuft sehr seltsam, Courtine wirft seinem ehemaligen Kumpel (wenngleich er das nicht zeigt) insgeheim immer noch vor, ihn und seine Frau damals auseinander gebracht zu haben.
Das Warum und Wieso bleibt zunächst im Dunkeln, Courtines Wunden reißen schon allein wegen Ficklings sehr komischem und widersprüchlichem Verhalten alsbald wieder auf. Jeder in dieser provinziellen und kleinbürgerlichen Stadt scheint irgendwas zu verbergen zu haben, des Weiteren sind sich die Bewohner untereinander alle nicht wirklich grün. Gerüchte, Getuschel und teils offene Anfeindungen sind quasi an der Tagesordnung – da gönnt der eine dem anderen nicht die Wurst auf dem Brot.
Courtine hat als Außenstehender einen erhabenen Blick auf diese Leute, doch muss er sich mit allen gut stehen, schließlich möchte er ja freien Zugang zur Bibliothek haben. Gleichzeitig will er herausfinden, welches Geheimnis seinen alten Freund Austin umgibt, der sich mal aufgekratzt, mal wortkarg schroff gibt und öfters des Nächtens wer-weiß-wohin verschwindet. Bald geht es rund um die geschichtsträchtige Kathedrale aber nicht mehr um persönliche Animositäten, nicht um alte historische Folianten, nicht um rätselhafte Schauergeschichten aus der Geschichte des Bauwerks, sondern um handfesten Mord an einem Banker und das Auftauchen des Leichnams eines verschwunden geglaubten Mörders direkt aus der Vergangenheit in der Kathedrale selbst …
_Meinung_
Was sich schön düster und mysteriös-spannend anhört, ist in Wahrheit sehr dröge präsentiert, dabei fängt der eigentliche Roman mit einem guten Flair an. Ein verwunschenes Kleinstädtchen auf dem Land mit schrulligen Bewohnern und einer gespenstischen Kirche, die von Nebel umwabert ein schreckliches Geheimnis trägt, sogar eine ominöse Kapuzengestalt (angeblich ein ruheloser Geist) lustwandelt über den Kathedralenvorplatz. Das klingt ganz verlockend nach Altmeister Edgar Wallace.
Leider verliert sich Palliser alsbald in seitenlangem Geschwafel von Courtines Theorie über König Alfred, sein Verhältnis zu Austin Fickling und den Begebenheiten, die sich rund um das alte Gemäuer ranken – immer wenn ich dachte, jetzt käme der Clou oder es würde endlich der entscheidene Hinweis geliefert, wurde ich enttäuscht. Denn kaum etwas von dem überflüssigen Geschreibsel ist später von Bedeutung. Der Lesespass wird dadurch ganz erheblich gebremst und ich konnte mir ein zähneknirschendes: „Komm endlich zur Sache, Kerl!“ kaum verkneifen.
Schlicht gesagt, es passiert nichts Weltbewegendes, bis fast gegen Ende und dann muss sich der Autor Mühe geben, die unnötig verworrenen Stränge zu einem Abschluss zu bringen. Selbst der Mord an dem sonderlichen Bankier und das Auffinden einer eingemauerten Leiche in der Kathedrale finden erst im letzten Drittel statt und können diese Provinz-Posse auch nicht mehr retten. Das Bild der Stadt und seiner Bewohner porträtiert Palliser sehr genau – |zu| genau, um ehrlich zu sein, denn im Endeffekt ist es für den Mordfall ziemlich irrelevant, der (ich bin mal so frei und spoiler hier ein wenig) nach dem Hauptteil der Geschichte ungesühnt und (fast) ungeklärt bleibt. Stattdessen werden Courtines persönliche Probleme mit Austin breit getreten und die viktorianische Gesellschaft um diese Zeit aufs Korn genommen (das allerdings sehr trefflich) … Gesellschaftliche Zwänge, wer mit wem und wer nicht und immer wieder Verweise auf die ollen Kamellen der Vergangenheit.
Zum besseren Verständnis muss ich aber die Gliederung heranziehen: Der Anfang des Buches findet um 1920 herum statt (nach dem virtuellen Tod von Dr. Courtine), es ist ein kurzer Vorgriff auf die eigentliche Handlung, die erst nach dieser Einlage kommen wird. Der „Bericht“ über die Vorfälle ist in der Ich-Form geschrieben und stellt die Geschehnisse aus der Sicht von Courtine dar, wie er sie fiktiv „erlebt“ hat. Nach dem Augenzeugenbericht folgt dann der Epilog, in welchem dann die letzten Puzzle-Teile an ihren Platz kommen, gefolgt von einem ausführlich geschilderten (visionären) Traum, den die Hauptfigur hatte (wie überaus ergreifend) und einem bitter nötigen Namensregister aller beteiligten Figuren.
Ich mag solche Geschichten ohnehin nicht sonderlich, bei denen schon von vornherein feststeht, dass mittendrin alles nur Geplänkel ist und der Kracher erst im Epilog aus dem Hut gezogen wird. Leider gibt es – oops! – aber gar keinen wirklichen Kracher und die endgültige Auflösung des lieblos inszenierten Rätsels (Welches Rätsel, die Auflösung war so was von offensichtlich!?) ist reine Makulatur. Was habe ich aus dem Roman gelernt? Briten sind spießbürgerlich von einer geradezu perfiden Höflichkeit beseelt, leben bevorzugt im Nebel (auch und gerade dem der Vergangenheit), lieben Gespenster und ungenießbares Essen. Na toll, auch |das| wusste man schon vorher.
_Fazit_
Mal Butter bei die Fische: Streckenweise ist des Buch ganz interessant und hat einige gute Ansätze, die Palliser – als regelrechte Spaßbremse – aber gleich wieder ruiniert, da hätte man wesentlich mehr draus machen können, um den anfänglichen Spannungsbogen auch konstant aufrecht zu erhalten. Die wirklich guten und akribischen Charakterisierungen der viktorianischen Kleinstadt-Gesellschaft und ihres (Un-)Rechtssystems können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem Plot massig an |pace| fehlt.
Zudem ist die Sache ziemlich leicht zu durchschauen, ich hatte mir nach nicht mal der Hälfte schon meine Theorie zurechtgelegt, die bedauerlicherweise erwartungsgemäß in beinahe allen Punkten zutraf – kein Ruhmesblatt für einen ausgewiesenen Thriller. Erschwerend kommt die akademisch-schwülstige „Von-Oben-Herab“-Schreibweise hinzu, die wohl Absicht ist, doch einem mit der Zeit ordentlich auf den Senkel geht, da sie die ohnehin schon langatmige Geschichte weiter unnötig verkompliziert und in die Länge zieht. Das dürfte vor allem Gelegenheitsleser sicher abschrecken. Eine (bedingte) Empfehlung spreche ich trotzdem aus, der Unterhaltungswert war mir trotz einiger guter Ansätze im Gesamtbild aber doch zu lau.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Original-Titel: „The Unburied“
Genre: Viktorianischer Krimi
Ersterscheinungsjahr: 1999 (Phoenix House / London)
Deutsche Übersetzung: Sigrid Langhaeuser
Erschienen: 2000 (Droemer / München)
Format: Hardcover / 480 Seiten
oder Taschenbuch (Neuauflage 2002)
ISBN: 3-426-19496-1 (HC)
ISBN: 3-426-61995-4 (TB)
Und immer noch lässt uns alle die weltpolitische Lage nicht los. Während sich Michael Moore mit der transatlantischen Gemengelage auf humorige Weise beschäftigt, gehört Scholl-Latour zu der ernsthaften Literatur, die sich mit dem globalen Dilemma befasst, in welchem auch wir Europäer zwangsläufig mit drinstecken. Der mittlerweile zweite Irak-Krieg kam alles andere als unvorhergesehen und kann bei weitem noch nicht als beendet angesehen werden, trotz alle Beteuerungen aus Übersee und seines nunmehr für eine Amtszeit wiedergewählten Kriegs-Präsidenten Bush. Wenigstens ein Kenner der weltpolitischen Bühne hat schon lange darauf hingewiesen, dass es dazu kommen würde. Peter Scholl-Latour, seines Zeichens deutsches Journalismus-Urgestein und Globetrotter in Sachen Recherche, der Hardy Krüger der deutschen Presse sozusagen, hat es vorausgesehen und wurde nicht müde, das kundzutun.
In diesem vorliegenden Werk, welches Ende 2001 abgeschlossen wurde, zieht er bereits Bilanz über das noch recht junge Jahrtausend. Wiewohl eines, das aber bereits sehr kriegerisch beginnt. Die Brandherde sind mannigfaltig und scheinen nur auf den ersten Blick grundverschieden, doch einen sie mehrere Parallelen: Immer wieder sind die letzte Supermacht USA, der angebliche fundamentalistische Islam und natürlich auch die NATO und die UNO darin verwickelt. Selbst Deutschland steckt trotz der ehemals ach-so-pazifistischen Koalition aus Rot-Grün bis über beide Ohren im Schlamassel des vorgeblichen „Human Rights“-Wahns.
Dass dieses bigotte Streben nach wirtschaftlicher und politischer Macht nicht erst seit der Bush-Regentschaft gepflegt wird und dass so manche UN-Resolution aus ethnischer Sicht gefährlicher Nonsens ist, versucht Scholl-Latour mit „Fluch des neuen Jahrtausemds – Eine Bilanz“ zu verdeutlichen. Er begibt sich auf Spurensuche vom Balkan über den Kaukasus bis zum Hindukusch und der immer noch heißumkämpften Zone am persischen Golf. Überall dort befinden sich die vermeintlichen „Schurkenstaaten“, wobei die einen verdammt, die anderen hingegen beinahe hofiert werden vom großen Weltsheriff. Mit wechselnder Sympathie der USA mal für den einen, dann wieder für den anderen.
_Der Autor_
Peter Scholl-Latour stammt aus Bochum, wurde im Jahre 1924 geboren und kann heute somit auf ein 80-jähriges, äußerst erlebnisreiches Leben zurückblicken. Heute wird die Ikone der deutschen Presse gerne in diversen Talkshows und anderen Sendungen zu seiner Expertise über die derzeit herrschende Politik zwischen der westlichen und der islamischen Welt befragt. Vor allem |n-tv| wird in den letzten Wochen nicht müde, ihn zu diversen Sendeformaten einzuladen. Doch wer ist Peter Scholl-Latour eigentlich? Nun, nicht immer war er Publizist bzw. Reporter – neben seinem Studium an der Sorbonne in Paris, wo er in Politikwissenschaften promovierte, legte er noch einen nach und erwarb in Beirut das Diplom für Islam-Studien. Bevor seine journalistische Zeit 1950 anbrach, diente er in Indochina sogar für die französische Fremdenlegion. Bekannt wurde er jedoch in den Siebzigern, als er damals zusammen mit einer US-Marines-Einheit durch den Dschungel Vietnams krauchte, in der Funktion eines Kriegsberichterstatters (Heute würde man „embedded reporter“ sagen) für das ZDF.
Sein weiterer Werdegang ließ ihn Programmdirektor beim WDR und auch Herausgebers des „Stern“ werden. Sein Fachgebiet ist jedoch stets die Politik respektive der Orient/Islam geblieben, dessen Länder er auch heute noch regelmäßig bereist. Kein Wunder, dass seine fundierte Meinung zum tagesaktuellen Geschehen gerade im Irak-Krieg derzeit so hoch im Kurs steht. Kaum ein westlicher Berichterstatter ist in seinem Leben so weit herumgekommen oder hat eine solche Nähe auch zu den so genannten „Schurkenstaaten“ wie Scholl-Latour – der dort wegen seiner kritischen, aber ehrlichen Sichtweise ebenfalls hoch geschätzt wird und Interviews erhält, wo anderen Journalisten die Türen vielleicht verschlossen bleiben.
_Zum Inhalt_
Scholl-Latour stellt von 1997 bis 2001 beinahe monatlich, manchmal sogar täglich (je nachdem, ob seiner Meinung nach irgendetwas Berichtenswertes vorfiel) seine Gedanken und Reportagen zusammen und präsentiert sie uns Lesern in chronologischer Reihenfolge. Lediglich das Vorwort und das erste Kapitel tanzen aus dieser Zeitlinie, sie sind etwas wie ein Vorgriff auf die folgenden Beiträge, welche er jedoch allesamt seit ihrer Niederschrift unverändert gelassen hat. Zum Teil sind dies wirklich Berichte und Reportagen, die veröffentlicht wurden, andere wiederum basieren auf persönlichen Notizen, die er zu exakt dieser Zeit niederschrieb, als bestimmte Ereignisse ihm ins Auge sprangen. Diese Abschnitte „Kapitel“ zu nennen wäre übertrieben, meist beschränken sich die einzelnen Segmente (versehen mit Überschrift und Datum) auf zwei Seiten pro entsprechendem Datum, selten überschreiten sie sechs oder mehr Seiten.
Die Ausnahme bilden die Abschnitte über das Kosovo bzw. den Balkan-Konflikt, diese gehören grundsätzlich zu den längeren Passagen. Dem Balkan und seiner speziellen Problematik wird ohnedies sehr viel Raum gewidmet, offenbar liegt ihm dieser Krisenherd – den er gerne als „Eiterblase“ bezeichnet – im Kernland Europas sehr am Herzen. Stück für Stück ergibt sich aus vielen kleinen Mosaiksteinchen ein grausiges Gesamtbild unseres Planeten, in welchem es eigentlich nur noch um Machterhalt durch große Konzerne und ihren „Wildwest“-Kapitalismus geht, den fast alle Staaten mit Hurra-Geschrei als Globalisierung bejubeln. Jedenfalls solange man kräftig mitverdient und das Deckmäntelchen der „Human Rights“ gewahrt bleibt – da man bei Nordkorea auf Seiten der Amerikaner generös von Drohgebärden absieht (die haben schließlich Atomwaffen), wird stattdessen kräftig auf die kleinen „Schurkenstaaten“ eingeprügelt. Von Afrika und dem immer wieder entflammenden Kriegen und schweren Menschenrechtsverletzungen dort schweigt des Dichters Höflichkeit (und auch das Gros der Presse) geflissentlich.
Der Wettlauf in Übersee und Russland um die globalen Ressourcen wird anderswo unerbittlich ausgefochten, doch deutlich zeigt sich die Unfähigkeit Europas und der UNO, dem Moloch USA und seinem Hunger nach Allmacht entgegenzutreten. Der schwächelnde, aber unter Wladimir Putin – welchen er gern mit Zar Peter dem Großen vergleicht – wieder erstarkende russische Bär ist als „Evil Empire“, sprich: als Feindbild im Westen weggebrochen und daher müssen jetzt „fundamentalistische“ Islam-Staaten herhalten. Russland kann nicht mehr mithalten und holt sich derweil im Kaukasus eine blutige Nase, beim Geschacher um die Öl- und Gaspipelines, während die Clinton- und später die Bush-Administrationen intrigant und geschickt den Nahen und Mittleren Osten manipulieren, um sich die Ressourcen zu sichern.
Dabei wird die Türkei ebenso geködert wie zunächst der Irak gefördert, beide Staaten wären (und sind geopolitisch) ein exzellenter Brückenkopf und zudem ein Garant dafür, dass die angrenzenden arabischen Staaten es sich zweimal überlegen, das US-Protektorat Israel weiter zu bekämpfen, wenn „Big Brother“ direkt vor ihrer Haustüre campiert. Doch wenngleich man sich den Irak und somit auch den Iran gefügig machen will – auf der anderen Seite der Welt gibt es noch weitere Staaten mit Großmacht-Gelüsten: China, Nordkorea und die so genannten „Tigerstaaten“ in denen es auch brodelt und die endlich auch ein Stück vom Wohlstands-Kuchen haben wollen. China und Nordkorea haben zur Durchsetzung ihrer Ansprüche sogar Nuklear-Potenzial zur Verfügung. Wo wir grade bei Nuklear-Technik sind: Auch Indien, Pakistan und vermutlich der Iran sind im Besitz von Kernwaffen. Armut und religiös angestrichene Machthaber – ein extrem explosives Gemisch: Die Lunte brennt bereits …
_ Meinung_
Hilflos muss die Staatengemeinschaft, allen voran die Institutionen der UNO, immer häufiger zusehen, wie die US-Administration den Ton angibt und fast alle anderen blind – sei es aus wirtschaftlichen Überlegungen oder vor Konformismus – folgen bzw. zwangsläufig folgen müssen. Dies ist seit langen Politik in Washington, doch kaum jemand kann sich gegen diese Vormachtstellung der letzten großen Weltmacht behaupten, Europa schon gar nicht, wie wir in den zurückliegenden Monaten eindrucksvoll miterleben durften.
Schon die Begebenheiten rund um den geschilderten Kosovo-Konflikt ließen laut Scholl-Latour auf die heutige Entwicklung schließen und viele seiner Bedenken, die er damals bereits in sein Tagebuch schrieb, geben ihm heute Recht. Hierbei beweist er aber sein Gespür für ethnische Zusammenhänge, die selbst der UN und auch all den anderen staatlichen Regierungen entgehen oder geflissentlich ignoriert werden. Zu behaupten, dass die derzeitige Weltlage ein „Kampf der Kulturen“ oder gar ein verkappter Glaubenskrieg ist, trifft nur bedingt zu, im Hintergrund stehen – wie meistens – vorrangig wirtschaftliche Interessen.
Obwohl der (Unter-)Titel eindeutig von einer „Bilanz“ spricht, ist dieses Buch eher eine „Never Ending Story“ aneinander gereihter Streiflichter und Gedanken, die Peter Scholl-Latour in die richtige zeitliche Reihenfolge gebracht hat, sich aber beliebig mit aktuellen Geschehnissen fortführen lässt. Da das Buch Ende 2001 / Anfang 2002 herauskam, erscheinen heute viele der Prognosen (auch laut Covertext) „visionär“, dem möchte ich widersprechen, denn eine Vision als solche kommt aus heiterem Himmel und davon kann bei Scholl-Latour wirklich nicht die Rede sein. Vielmehr hat er über viele Jahre – ja, Jahrzehnte – hinweg die weltpolitische Lage und speziell die Lage in den islamischen Staaten unter Beobachtung gehabt und „nur“ die richtigen Schlüsse gezogen: Konsequent, schonungslos und überaus kritisch.
Das Buch dürfte für manchen schwer zu lesen sein, es strotzt vor Fremdworten und Phrasen, die – jedenfalls bei den Kiddies heute – kaum mehr in Gebrauch sind, darunter auch einige geflügelte Worte und Aphorismen in anderen Sprachen, welche manchmal nicht gesondert übersetzt sind. Das gilt im Besonderen für das Französische, welchem sich der Autor immer wieder gerne bedient und zuwendet. Diese leicht archaische Art des Sprachgebrauchs ist sicher nicht jedermanns Sache, passt aber zu seinem Stil und verdeutlicht seinen Standpunkt durch Wortspiele und -wahl.
Es wirkt nicht so, dass Scholl-Latour damit „von oben“ herab missionieren oder belehren will – es ist ganz einfach die Sprache seiner Generation. Als Kenner gerade der islamischen Welt, dem meist sogar bei Diktatoren die Türen für Interviews offen stehen, berichtet er quasi direkt von der „Front“ und das überaus kritisch und mit großer Sachkenntnis der tieferen Zusammenhänge – wenngleich nicht immer sehr distanziert, man merkt, dass ihm die besuchten Länder ans Herz gewachsen sind.
Was mich anbelangt, so kann ich mir förmlich vorstellen, wie Scholl-Latour mit seiner markanten, leicht nasalen Stimme diese Reportagen vorträgt, wie er es seinerzeit im ZDF beim „Länderspiegel“ immer tat und auch heute zum Teil noch in diversen Beiträgen auf verschiedenen Sendern tut. Dadurch, dass es sich streng genommen um Einzelbeiträge handelt, die nicht für ein Buchprojekt wie dieses angepasst wurden, wiederholen sich manche Sätze zwischendrin immer wieder mal fast wortwörtlich. Gerade diese Passagen fallen dem aufmerksamen Leser sehr ins Auge und beweisen rückblickend, dass eben jene Punkte und Einschätzungen, die ihm augenscheinlich so wichtig erschienen, von der Realität heute tatsächlich beinahe Wort für Wort eingeholt wurden.
_Fazit_
Es gibt leider nicht mehr viele Journalisten wie ihn, was teilweise an seinem Alter liegen mag; er hat während seiner langjährigen Karriere die ganze Welt bereist und kann dadurch auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der vielen der heutigen Reporter abgeht. Das Buch ist sicher kein leichter Lesestoff (nicht nur wegen der streckenweise archaischen Sprache) und richtet sich eindeutig an Leute, die sich auf der weltpolitischen Bühne, im Bereich der Allgemeinbildung und mit den handelnden Personen auskennen.
Bedauernswerterweise sind für Einsteiger in die Materie keinerlei Karten enthalten, so bleibt dem ambitionierten Nichtkenner der geopolitischen Lage nur der eventuelle Griff zum hoffentlich vorhandenen Atlas. Schade, ein wenig Kartenmaterial hätte dem lesenswerten Werk noch den allerletzten Schliff gegeben, wer allerdings ein wenig im Feuilleton der Presse heimisch ist, kommt auch ohne aus. Die Gliederung und die häppchenweise Präsentation machen es leicht, mal zwischendrin abzusetzen, man findet selbst dann problemlos wieder hinein. Am Stück gelesen, brauchen geübte Bücherwürmer etwa sechs bis sieben Stunden Lesezeit. Insgesamt betrachtet ein Exkurs internationaler Zusammenhänge und ethnisch-politischer Bildung, den man gelesen haben sollte, um die heute vorherrschende Lage auf der Weltbühne besser verstehen zu können.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Titel: „Der Fluch des neuen Jahrtausends – Eine Bilanz“
Erscheinungsjahr: 2002 (Bertelsmann)
Format: Hardcover m. Schutzumschlag / 320 Seiten
oder: Taschenbuch / 352 Seiten (Goldmann / Mai 2004)
ISBN: 3-570-00537-2 (HC)
ISBN: 3-442-15272-0 (TB)
Preis: ab 9,95 (TB), 22 Euro (HC)
Er ist wohl der berühmteste Autor von Fantasy-Literatur, der bislang auf unserem kleinen Planeten zu wandeln geruhte und uns die Meisterwerke rund um Mittelerde hinterlassen hat. Kein anderer Autor hat dieses Genre so beeinflusst wie John Ronald Reuel Tolkien und selbst Harry-Potter-Schöpferin Joanne K. Rowling hat sich – wie schon so viele andere vor ihr – ganz mächtig für ihren Zauberlehrling beim Altmeister und Gebieter über Orks, Trolle und Drachen bedient.
Die Krefelder Metaller BLIND GUARDIAN haben in ihren Alben immer wieder Tolkien-Themen angepackt und sogar so etwa, wie den kompletten Soundtrack zu eben diesem Buch geliefert: |“Nightfall in Middle Earth“|. Doch gerade durch die kaum zu toppende Verfilmung der „Herr der Ringe“-Trilogie von Peter Jackson ist sein Lebens-Werk wieder verstärkt ins Bewusstsein gerückt.
Doch heute soll es um die Anfänge der Mittelerde gehen, nicht um den erst viel später stattfindenden Ringkrieg, der im HdR seinen Höhepunkt findet. Nein, heute kümmern wir uns um das, was davor geschah und zwar nicht unmittelbar davor, als Bilbo den |Einen Ring| in „Der Hobbit“ findet, sondern noch einige tausend Jahre vorher, als die Elben zunächst noch nicht und später als junges Volk durch die Gestade Mittelerdes wandelten und die ersten Menschen erst langsam auftauchten.
All diese Geschichten finden sich in „Das Silmarillion“, welches Tolkiens Sohn Christopher erst nach dem Tod JRRs zusammenstellte und veröffentlichte. Es geht hierbei um die ersten beiden Zeitalter des legendären Elbenreichs Valinor und der Blütezeit des Menschengeschlechts des Landes Númenór, welches von Sauron später verraten und zerschmettert wird, was im „Dritten Zeitalter“ zu den Begebenheiten führen, die wir als HdR-Trilogie kennen …
_Die Umstände der Veröffentlichung_
Sicher kommt man in einer solchen Rezension nicht umhin, ein paar Worte zum Autor zu verlieren, jedoch halte ich das so knapp wie nur irgend möglich, denn die genaue Biographie Tolkiens kann man in vielerlei Quellen nachlesen, daher hier nur ein paar allgemeine Infos zum besseren Verständnis. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die weder von Tolkien noch von seinen Werken jemals was gehört haben. Unvorstellbar, aber wahr.
Anfang der 20er Jahre begann Tolkien als junger Mann in den Wirren des ersten Weltkriegs, sich Geschichten rund um das fiktive Reich Mittelerde auszudenken, als Sprachgenie (später ein angesehener Professor für Sprachwissenschaften), erfand er sogar eine eigene Sprache für das Reich Mittelerde samt eigener Grammatik, Runenschrift usw. Bei der einen Sprache blieb es jedoch nicht, so sprechen die alten Lichtelben beispielsweise anders als die ebenso alten Grauelben und das „heutige“ (zur Zeit der HdR-Geschichte) Elbenvolk parliert in „Quenya“, einer Mischsprache, aber das nur am Rande.
Tolkien bediente sich für „seine“ Mittelerde in vielerlei Mythologien und so mancher Leser seiner Geschichten wird sich an die Bibel, Homers Atlantis-Sage oder an die skandinavisch-keltische Sagenwelt erinnert fühlen, was von ihm auch durchaus beabsichtigt ist. Das alles diente dem Zweck, seinen Protagonisten einen Stammbaum und einen ordentlich ausgearbeiteten Background zu verpassen, gerade so, als wären seine Storys und Figuren geschichtlich real und nicht erfunden.
Tolkien schrieb generell nie zeitlich zusammenhängend an einem einzelnen Buch, mit einer Ausnahme: |“Der Hobbit“|. Dieser war von vornherein als komplettes Kinderbuch geplant, doch JRR hat schon währenddessen immer wieder Hintergrundmaterial für Mittelerde ersonnen und quasi aus der Luft geschrieben, ganz so wie es ihm in den Kram passte. Was die wenigsten wissen: Der Herr der Ringe ist nicht „in einem Rutsch“ geschrieben worden, sondern stellt ein Konglomerat aus Einzelteilen dar, welches Tolkien nach dem Erfolg vom „Hobbit“ zusammenfügte und noch mal überarbeitete, damit es in sich schlüssig ist.
Was das mit dem „Silmarillion“ zu tun hat? Ganz einfach: Das Silmarillion als solches ist auch kein „Roman“, wie er nun vorliegt, sondern in Wahrheit eine Sammlung von Loseblättern und Kapiteln, die sich JRR zwischendurch und über mehrere Jahrzehnte immer mal wieder als Gedächtnisstütze angefertigt hat, ohne je daraus ein eigenes Buch machen zu wollen, denn einen Teil der Sagen und Personen daraus findet man auch im HdR in Form von Liedern und Anspielungen wieder.
Erst nach JRRs Tod hat sein Sohn Christopher diese Notizen und unvollendeten Kapitel in Buchform gebracht und veröffentlicht. Von ihm stammen auch die meisten Karten und Zeichnungen zum Lebenswerk seines Vaters. Christopher Tolkien hat also lediglich zusammengesetzt, was zusammengehört, und dieses Material in eine chronologische Reihenfolge gebracht, ohne dabei den Inhalt anzutasten. Herausgekommen ist dabei das, was einige heute spöttisch (aber gleichwohl ehrfurchtsvoll) als „Das Telefonbuch der Elben“ titulieren.
_Die Entstehung einer Welt – Zum Inhalt_
Die ersten Kapitel des Silmarillion lesen sich wie ein kruder Mischmasch aus der Bibel und diversen Göttersagen, es geht hier um die Entstehung des Himmelsreiches auf Erden, genauso wie in der Genesis (1. Buch Mose), nur das Jachwe/Jehova hier „Illúvatar“ heißt und noch so einige Göttervertreter hat, die wiederum verschiedenen Aufgabengebiete auf der neu erschaffenen „Mittelerde“ inne haben, ähnlich wie die Götter, die man allgemeinhin aus der ägyptischen, römischen oder griechischen Mythologie kennt.
So findet sich dort ein Anubis nicht unähnlicher Gott namens „Manwe“, der das Totenreich unter seiner Führung hat, das zudem ein wenig an die Ruhmeshalle der nordischen Walhalla erinnert, da gibt’s den Meeresgott, den Gott des (Süß-)Wassers „Ulmo“, der besonders später mit den Grauelben gut Freund ist usw. Diese Vertreter Illúvatars nennen sich Valar und leben auf Mittelerde im Lande Valinor (der Insel der Unsterblichen). Um Mittelerde zu bevölkern, schafft Illúvatar weitere Völker, zunächst die unsterblichen Lichtelben auf Valinor und auf dem Hauptkontinent (dem späteren Mittelerde, wie wir es kennen) auch die Rasse der sterblichen Menschen.
Doch auf Valinor herrscht nicht lange eitel Sonnenschein, denn ein Valar namens Melkor will ganz gerne alles Lebendige vernichten, was Illúvatar geschaffen hat, da er neidisch darauf ist, dass er nicht der Hauptvertreter des Gottes wurde, sondern ein anderer. Valinor ist jedoch nicht die einzige Landmasse, sondern es gibt dort noch etliche andere Inseln und den uns „heute“ bekannten Kontinent von Mittelerde, der zu dieser Zeit vor der großen Katastrophe noch eine etwas andere Form hat, jedoch schon früh von Elben (und etwas später auch von Zwergen und Menschen), aber anfangs noch dünn besiedelt ist.
So kommt es, wie es kommen muss: Durch Lug und Trug werden die beiden „Lebensbäume“ auf Valinor von Melkor vernichtet. Noch bevor er auf den Hauptkontinent verbannt wird, erschafft Feanor, ein Mächtiger unter den Lichtelben, die drei „Silmaril“, Gemmen (Edelsteine mit magischen Kräften), die das ewige Licht und die Kraft der zerstörten Lebensbäume in sich tragen. Feanor ist so stolz darauf, dieses Licht eingefangen zu haben, bevor es auf ewig schwinden konnte, dass er eifersüchtig darauf Acht gibt, dass niemand außer ihm und seiner Sippe Hand an diese Preziosen legen darf. Fatal, wie sich später herausstellt …
Melkor wird also von Valinor verbannt, doch stiehlt er vorher die drei Silmaril von Valinor und nimmt sie mit in seine dunkle Festung Angband, wo er in seinem Exil und nun unter dem Namen „Morgoth“ nur darauf wartet wieder zuzuschlagen. Dort in Angband schafft er aus ehemaligen Elben auch das Volk der sinistren Orks, paktiert mit Drachen und setzt seinen später so berühmten Statthalter Sauron ein. Nicht nur an den Küsten des Hauptkontinents haben sich nämlich schon recht früh abenteuerlustige und seefahrende Elben angesiedelt, zwar außerhalb von Valinor, doch immer in freundschaftlichem Kontakt stehend zu ihrem „Heimatland“.
Auf der Insel der Unsterblichen hingegen schwört Feanor einen schicksalhaften Schwur, der auch tausende Jahre später noch seine Nachkommen binden und ins Verderben treiben soll: Er und seine sieben Söhne wollen nicht eher ruhen, bis die Silmaril aus Morgoth Klauen (bzw. seiner Krone) wieder in deren Händen sind … sprachs, packte seine gesamte Sippschaft auf Schiffe und segelte aus Valinor weg, hin zum Hauptkontinent ins freiwillige Exil, um Melkor / Morgoth dort ordentlich die Hölle heiß zu machen, solange es auch dauern möge. Ein Kampf, der über Zeitalter hinweg toben sollte und bei dem so ziemlich alle Rassen einbezogen werden.
Zu erwähnen wäre da noch, dass natürlich irgendwann zwischendrin die Menschen und die Naugrîm (Die Zwerge) in Mittelerde auftauchen, teils zur Freude, teils zum Leid der Elben, von denen es zudem verschiedene Stämme mit verschiedenen Ansichten und Verhaltensweisen gibt und die sich untereinander auch häufiger bekriegen. So tummeln sich dort in Mittelerde Lichtelben (Noldor), Grauelben (Sirdar), See-Elben (Teleri) und auch die Dunkelelben, nebst einigen anderen Völkern mit ihren Splittergruppen. Allianzen und ganze Reiche werden geschmiedet, um dann irgendwann wieder zu vergehen.
Für Kenner des Herrn der Ringe / Hobbit: Wir erfahren zudem, woher Celeborn, Galadriel und Elrond stammen und was es mit dem legendären Pärchen Beren (Mensch) und Luthíen (Elbin) auf sich hat, dem ersten Mischehepaar der alten Welt, dem noch so einige folgen sollen und von denen beispielsweise Aragorn und auch Elrond bzw. seine Tochter Arwen abstammen. Ja ja, wer nur den Film kennt und gedacht hat, Meister Elrond wäre ein reiner Elb, der sieht sich getäuscht. Er ist zur Hälfte Mensch. Desweiteren bedeutet das, dass Aragorn und Arwen später eine klitzekleine Form des Inzestes betreiben – schließlich gehen beide auf ein und dieselbe Geburtslinie zurück, wenn auch nur entfernt.
Natürlich erfahren wir auch etwas über Sauron, den Gestaltwandlungszauberer und Stiefelputzer von Morgoth, erst später mutiert er zum bekannten Ober-Bösewicht, zu dieser Zeit jedoch ist er noch längst nicht so mächtig. Aber immerhin mächtig genug, um ordentlich Ärger zu machen im Namen seines dunklen Herrn von Angband, bis dieser niedergeworfen werden kann. Dabei möchte ich es einstweilen bewenden lassen, denn ich denke, bis hierher war es schon verwirrend genug, gibt aber einen guten Vorgeschmack darauf, was euch beim Lesen so erwartet.
_Meinung_
Puh! Starker Tobak, weil uns das Buch eine verwirrende Anzahl von Orts-, Personen- und Götternamen um die Ohren haut, die es gilt, erst mal zu verdauen und zu verinnerlichen. Die ersten Kapitel lesen sich ungefähr so zäh, wie sich eine alte Schuhsohle kauen lässt. Das liegt zum einen am rohen Sammelsuriumcharakter des Werkes, zum anderen an der Vielfalt unterschiedlicher Namen für ein und dieselbe Sache, daran muss man sich erst einmal gewöhnen.
Mit fortschreitender Seitenzahl hat man den Bogen aber so langsam raus und auch die Geschichte ist längst nicht mehr so trocken, da jetzt verstärkt Personen und Figuren auftauchen, mit denen der beschlagene HdR-Fan auch was anfangen kann. Zudem kommen nach der trägen Entstehungsgeschichte Mittelerdes nun endlich auch mal ein paar handfeste Schlachten vor, sei es Elb gegen Elb oder alle gegen Morgoth und seine Schergen. Orks, Drachen, Balrogs und auch die Urmutter der Spinne Kankra („Ungoliant“) geben sich scharenweise ein Stelldichein – es wird gemetzelt, gehauen, gestochen, geklaut und betrogen.
Interessant finde ich die Tatsache, dass die Elben keine so weiße Weste haben, wie sie diese im Hobbit oder beim HdR zur Schau tragen. Auch unter ihnen gibt’s Zwietracht und Kampf innerhalb und außerhalb der Sippen. Bis man jedoch richtig in die Story reingefunden hat, muss man sich ganz schön durchbeißen, denn es gibt zu der Namensverwirrung auch noch einige logische Inkonsistenzen, doch schließlich hat Christopher Tolkien die Finger von dem Material gelassen und so kriegen wir die unangepassten Kapitel JRRs so ziemlich in der Urfassung zu lesen, wodurch natürlich an einigen Stellen der Schliff fehlt.
Die Erzählgeschwindigkeit wechselt auch des Öfteren mittendrin, mal sind die Begebenheiten sehr ausführlich geschildert, dann wiederum geht’s Hopplahopp mit Zeit und Ortssprüngen woanders hin zu einer weiteren Nebenhandlung … Notizen eben, die ursprünglich nicht für unsere Augen gedacht waren und auf die sich wohl nur der verblichene JRR einen genaueren Reim machen könnte. Wer nur die Filme kennt und/oder sich mit dem Gedanken trägt, den Herrn der Ringe als Buch zu lesen, dem rate ich, die letzten Seiten auszulassen, weil dort dessen Ende quasi vorweggenommen wird, ein weiteres Zeichen dafür, dass große Teile der Geschichten und des reichhaltigen Backgrounds aus den Notizen, aus denen ja „Das Silmarillion“ eigentlich besteht, von Tolkien seinerzeit bereits mehr oder weniger subtil im HdR eingebaut wurden.
Damit der geneigte Leser nicht vollkommen verwirrt mit Fragezeichen über dem Kopf aus dem Buch entlassen wird, befinden sich am Ende noch ein paar vereinfachte Stammbäume, Hinweise zur Aussprache und Bedeutungen von Silben in der Elbensprache und die obligatorischen Landkarten Cristopher Tolkiens. An manchen Stellen springen einen die Inkonsistenzen regelrecht an, und man rätselt, was sich JRR dabei gedacht haben mag, wenn er zuvor detaillierte Handlungsstränge einfach nicht weiterführte und ins Leere laufen ließ. Wir können das heute nicht mehr nachvollziehen, da er ja nicht mehr unter uns weilt, und auch sein Sohn war nicht in der Lage oder willens, irgendetwas anderes zu machen als das Silmarillion zusammenzustellen – Geändert hat er an seines Vaters Manuskripten nach eigenem Bekunden im Vorwort nichts. Immerhin wissen wir, dass es JRR wichtig gewesen sein muss, denn er fand es wert, es aufzuschreiben.
_Fazit_
Für Tolkien- und „Herr der Ringe“-Fans ein absolutes Must-Read, wobei diese sich aber gleich von der Illusion frei machen sollten, dass es sich dabei um leichte Kost handelt. Das Teil ist sperrig, verwirrend und zuweilen dröge – selbst Meinereiner, der sehr viel liest, musste an einigen Stellen absetzen, einige Passagen nochmal lesen oder in den Appendices nachschlagen, weil da irgendwas nicht ganz hinhaute mit der Kontinuität. Damit muss man wohl leben, interessant ist der Aufstieg und Fall Mittelerdes und seiner Königreiche der Elben & Menschen allemal. Ich würde vorschlagen, die vermeintlichen „Nachfolgewerke“ (den „Hobbit“ und die „Herr der Ringe“-Trilogie) in diesem besonderen Fall |vorher| zu lesen, für Neueinsteiger in die Welt von Mittelerde ist „Das Silmarillion“ nicht geeignet. Die Bezeichnung „Bibel Mittelerdes“ oder salopper: „Das Telefonbuch der Elben“ trägt es zu Recht.
_Buchdaten:_
Originaltitel: „The Silmaril“
Autor: John Ronald Reuel Tolkien
(zusammengestellt von Christopher Tolkien)
Ersterscheinung: 1977 (2001 / |Klett-Cotta|-Verlag)*
Neuübersetzung: Wolfgang Krege
ISBN: 3-608-93245-3
Format: Hardcover oder broschiert erhältlich / um 390 Seiten*
Zusatzfeautures: Kartenmaterial (herausnehmbar)
*) Der von mir rezensierte 2002er Schmuckband (Leinen-Hardcover mit aufwendig gestaltetem Schutzumschlag und Lesebändchen) stammt als Lizenzausgabe vom |Club Bertelsmann|. Der Inhalt sowie sonstige Ausstattung (gesondertes Kartenmaterial Mittelerdes von Christopher Tolkien) ist mit der Original-Ausgabe von |Klett-Cotta| identisch.
Jeffery Deaver gilt nicht umsonst als einer der herausragenden Thriller-Autoren unserer Zeit, schließlich gelang es ihm mit |“Der Knochenjäger“|, einen absoluten Hit zu landen, der auch recht erfolgreich im Zuge der Serial-Killer-Welle mit Denzel Washington und Angelina Jolie in den Hauptrollen als Ermittler-Team Rhyme/Sachs verfilmt wurde. Thomas Harris und seine Figuren-Evergreens Clarice Starling und Hannibal „The Canibal“ Lecter hatten urplötzlich auf dem Sektor des intelligenten Thrillers Konkurrenz bekommen. Dennoch setzt er seine beiden besten und bekanntesten Zugpferde nicht in allen seinen Romanen ein, seine Themengebiete sind breit gefächert; so hat er mit „Lautloses Duell“ zum Beispiel auch einen packenden und authentischen Roman aus der Hacker-Szene auf der Pfanne.
|“The Stone Monkey“| jedoch (was im Deutschen vollkommen unverständlicherweise zu „Das Gesicht des Drachen“ vermurkst wurde, wenngleich der Originaltitel – wie so oft – viel passender gewesen wäre) ist wieder einmal seinem Dreamteam gewidmet und somit der vierte Roman, bei dem sich das dynamisch-forensische Duo aus New York auf seine unvergleichliche Art gemeinsam auf Verbrechersuche begibt. Diesmal bewegt Deaver sich aber ein wenig weg von dem typischen Bild des (westlichen) Serienkillers und macht die Menschenjagd auf illegale Einwanderer aus China zum Gegenstand seiner Geschichte. Als geneigter Leser des Erstlings |“The Bone Collector“| war ich natürlich besonders gespannt …
_Ghost(’s)ship – Zur Story_
Eigentlich heißt er Kwan Ang, doch wird er nur „Gui – Der Geist“ genannt – seines Zeichens chinesischer Menschenschmuggler, berüchtigter Profi-Killer, skrupelloser Psychopath … Niemand hat wirklich je sein Gesicht gesehen und wer es sah, der lebte meist nie lange genug, um davon jemandem zu berichten. Sein persönliches Motto: „Nianxi“ („Geduld – Alles zu seiner Zeit“), sein Auftrag: Eine Ladung illegaler Dissidenten und sich selbst aus China per Schiff in die USA zu schleusen, mit ihm unterwegs: Sein „Bangshou“ (Handlanger / Assistent). Doch das Schiff – die „Fuzhou Dragon“ – wird bereits von FBI und INS (der US-Einwanderungsbehörde) vor New York erwartet; nicht zuletzt dank der akribischen Mitarbeit des querschnittsgelähmten, forensischen Ermittler-Genies Lincoln Rhyme bekommen die Behörden Wind von dem Transport und seinem hochrangigsten Passagier.
Der Geist ist für die INS weiß Buddha kein Unbekannter und ein dicker Fisch, den man gerne dingfest machen möchte. Als sich das Patrouillenboot der Küstenwache dem verdächtigen Frachter nähert, zeigt der Geist, wie wenig ihm Menschenleben wert sind: Kurzerhand lässt er eine vorbereitete Ladung hochgehen und schickt das Schiff in Küstennähe eiskalt auf Grund. Natürlich trägt er Sorge dafür, als einziger mit heiler Haut davonzukommen – Einigen Flüchtlingen gelingt es unerwartet aber dennoch, der Todesfalle des absaufenden Potts zu entfliehen und sich per Schlauchboot zu retten. Der Geist setzt zu einer brutalen Verfolgungsjagd zu Wasser und zu Lande an …
Trotz seiner Bemühungen alle Opfer wenn schon nicht auf dem Meer selbst, dann zumindest am Ufer auszuschalten, schlüpfen ihm zwei ganze Familien durch die Finger, die sich an Land mittels eines gestohlenen Vans mit knapper Not Richtung New York absetzen können, zudem wird der Killer von seinem herbestellten Kontaktmann in den USA am Strand verladen und schmählich im Stich gelassen. Während die beiden Familien allein in diesem fremden Land einen sicheren Unterschlupf finden müssen, hat der Geist das Problem, sich vor den schon herannahenden Polizisten (allen voran Rhymes „Assistentin“ Amelia Sachs) auch erstmal in Sicherheit zu bringen, bevor er seine dreckige Arbeit – die verbleibenden Überlebenden zu eliminieren – zu Ende führen kann.
Bei ihrer Untersuchung des Tatortes stellt Sachs fest, dass es mindestens noch einen lebenden Flüchtling des Massakers gibt: Der chinesische Doktor und Dissident John Sung treibt lediglich angeschossen im Meer. Bei seiner Rettung übersieht sie jedoch einen weiteren Chinesen, der ebenfalls ohne Schrammen (und unbemerkt) davongekommen ist und zunächst eine höchst undurchsichtige Rolle in diesem neuen Fall für das Ermittlerteam um Rhyme/Sachs spielt. Doch wer ist der geheimnisvolle Sonny Li, der sich kurz darauf bewaffnet in das Haus Rhymes schleicht, wirklich? Wird es den Ermittlern gelingen, den Wettlauf gegen den Geist zu gewinnen, der auf der Suche nach den entflohenen und untergetauchten Familien Wu und Chang mit Leichen seinen Weg pflastert? Ihr aktueller Fall ist knifflig und gefährlich zugleich, denn Kwan Ang unterliegt einer ganz anderen Mentalität, die weder Gnade noch Reue kennt, was ihn schwer einzuschätzen (und noch schwerer zu fassen) macht …
_Das forensische Duo – Die beiden Hauptfiguren_
|Lincoln „Linc“ Rhyme| – Kriminalistisches Genie, der eine ganze Reihe Lehrbücher zur Forensik schrieb, bevor er bei der Tatortuntersuchung eines Mordfalles von einem herabfallenden Deckenbalken getroffen wurde. Die Ärzte konnten sein Leben zwar retten, doch ist Rhyme seither vom Hals abwärts gelähmt und kann nur noch den Kopf, die Schultern und einen Finger bewegen. Lange Zeit wollte sich Lincoln sogar das Leben nehmen und hatte auch schon einen Euthanasie-Arzt aufgetrieben. Er residiert in einem schmucken Stadthaus am Central Park West inmitten seiner hochtechnischen Apparaturen und Computer.
Diese erlauben ihm ein halbwegs bequemes (aber arbeitsreiches) Dasein, denn Rhyme wird gerne von den Behörden bei kniffligen Fällen hinzugezogen und dient als „Berater“. Aus dem aktiven Dienst als Cop ist er wegen seines schweren Handicaps natürlich ausgeschieden, dennoch hat sein berufenes (oft mürrisches) Wort auch an höchsten Stellen Gewicht. Entgegen der filmischen Darstellung Rhymes als Schwarzer in „The Bone Collector“ durch Denzel Washington, ist das Romanvorbild ein dunkelhaariger, etwa 40-jähriger Weißer.
|Amelia Sachs| – Sie kommt eher durch Zufall in das |Crime Scene Investigation|-Team, als sie die erste Leiche beim Knochenjäger-Fall findet. Da war sie noch ein Straßen-Cop und stand kurz davor, wegen ihrer schweren Arthritis freiwillig zur Abteilung Jugendkriminalität überzuwechseln. Rhyme erkannte jedoch ihr Talent für die Spurensicherung und Forensik und hat die zunächst recht widerspenstige Amelia in seine „Dienste“ geholt. Auch privat sind die beiden nach dem Fall ein Paar geworden, wobei die deutschstämmige und rothaarige Amelia (beim „Bone Collector“ durch Angelina Jolie verkörpert) nicht nur die rechte, sondern auch die linke Hand Rhymes am Tatort darstellt und mehr als ersetzt.
Aus verständlichen Gründen kann er mit seinem Rollstuhl nur selten sein Haus und die Obhut seines gestrengen Pflegers Thom verlassen. Amelias Gespür für Tatorte und Spuren ist ihr quasi angeboren, sie schreckt jedoch auch nicht vor handfesten Auseinandersetzungen / Ermittlungen zurück, dafür ist sie immer noch zu sehr Cop – ein Erbe ihres Vaters (auch ein „Plattfuß“ sprich Straßenpolizist), der im Dienst erschossen wurde und dem sie nacheifert. Legendär sind ihre rasanten Fahr- und Schießkünste und Vorliebe für ihren getunten Camaro nebst ihrer Dienstwaffe, einer schweren „Glock“.
_Einmal Chop-Suey bitte! – Die Kritik_
Es ist ein typischer „Deaver“ und ein noch typischerer Rhyme/Sachs-Roman obendrein, doch eins muss man dem guten Jeffery mal wieder zu Gute halten und zugestehen: Er bereitet sich stets exzellent auf das verwendete Thema vor. Das ist bei dieser Problematik, sprich der ausführlichen Auseinandersetzung mit der asiatischen Mentalität, speziell dem traditionellen Taoismus und Konfuziusismus, sehr gelungen. Die handelnden Personen und ihre Motive sind überaus glaubhaft und die unterschiedlichen Vorgehensweisen der westlich-rationalen Ermittlungsmethoden mit den fernöstlichen (mehr intuitiven) Sichtweise, sorgen für frischen Wind. Eine gute Portion Feng Shui und chinesische Ying-Yang-Lehre darf logischerweise nicht fehlen, doch flicht Deaver das geschickt mit ein und erschlägt seine Leserschaft nicht mit schwülstigen Weisheiten von Konfuzius oder Lao-Tse. Vielmehr nimmt man den betreffenden Figuren ab, dass sie tatsächlich danach leben.
Dazu passt auch, dass auch immer wieder Begriffe in Chinesisch wie selbstverständlich eingebaut wurden, durch die ständige Wiederholung mancher dieser Ausdrücke bekommt man ein gutes Feeling für den Plot und seine Stimmung. Das Flair der Story geht also vollkommen in Ordnung, auch die Action stimmt – Deaver verzichtet dabei aber weitgehend auf die Schilderung exzessiv-blutiger Gewalt und arbeitet lieber mit subtileren Methoden, um bei seiner Leserschaft Beklemmung und Spannung auszulösen, indem er Dinge unausgesprochen lässt und stattdessen einen eleganten Szenenwechsel einleitet. Ein alter und erprobter Trick, seine Leserschaft bei der Stange zu halten, aber dennoch sehr wirksam …
Die Geschichte krankt aber in meinen Augen durchaus daran, dass der Täter von vorneherein quasi feststeht, das mag ich meist nicht so gern, trotzdem ist der Thriller intelligent und logisch aufgezogen, wie vom Autor gewohnt – Lücken gibt es keine. Doch irgendwie beschleicht mich ein wenig Déjà-vu gepaart mit einer ziemlichen Vorhersehbarkeit des Plots. Deaver gibt sich zwar redlich Mühe, einige Wendungen herbeizuführen, allerdings kommt mir das zum Teil recht erzwungen vor. Klar passen diese eingestreuten Nebenhandlungen und Wendungen in die Story, wenn ich auch hier und da sagen würde, dass er unter einer Art Originalitätsdruck gestanden haben muss. Sequels sind halt immer eine kribbelige Sache. Die Hauptfiguren sind nun mal ziemlich feststehende Größen, da kann man beim immerhin vierten Roman mit Rhyme/Sachs schlecht großartig noch weitere, unbekannte Aspekte aus dem Ärmel schütteln, denn die Hauptfiguren sind schon hinreichend ausgeleuchtet. Unnötig zu erwähnen, dass der Rest des „Casts“ recht farblos und austauschbar bleibt …
Da konstruiert Deaver auf Nummer Sicher eben eine „riskante“ Operation, der sich Rhyme unterziehen will und Amelias bislang vergeblicher Kinderwunsch, ihre Arthritis und ihre Klaustrophobie werden auch einmal aufs Neue einbezogen und als Aufhänger verwendet. Glaubhaft: ja, originell: nein. Zu allem Überfluss lässt Deaver Amelia nämlich auch noch im Wrack des Schiffes tauchen und nach Spuren suchen. Nun gut, das kann man natürlich machen, war aber irgendwie abzusehen. Ich fand dagegen den sympathischen, chinesischen Counterpart zu Rhyme – den chinesischen Cop Sonny Li – mit seinen unorthodoxen Methoden schon wesentlich gelungener, die Figur hat etwas, ganz im Gegensatz zu den üblichen Reibereien und dem zu erwartenden Hick-Hack zwischen dem Ermittlerteam und den zuständigen Departments. Das kennt man bereits hinlänglich und reißt dadurch nicht gerade vom Hocker.
_Ente (süß-sauer) gut … alles gut? – Das Fazit_
Alles in allem eine durchaus spannende und gute Lektüre, die Leseratten innerhalb von guten sechs bis acht Stunden durchackern können. Wäre da nicht die Vorhersehbarkeit, könnte ich dem doch immerhin intelligenten – wenn auch wenig originellen – Thriller sogar eine Maximalbewertung verpassen, die gezeichneten Figuren sind prima, auch die chinesische Mentalität ist exzellent getroffen, ebenso die unterschwellig kritischen Töne an der Einwanderungspolitik bzw. der Menschenverachtung der INS, wenn es um „Illegale“ geht. Doch erinnert mich das Ganze unweigerlich an |“Lethal Weapon 4″| (mit Mel Gibson & Danny Glover), wo man eigentlich nur die Figuren austauschen muss (eben nicht Riggs & Murtaugh, sondern Rhyme & Sachs) und ein klitzekleines bisschen an der Story schütteln, die Parallelen sind unbestreit- und übersehbar.
Zack! Schon hat man fast das Gleiche in Grün mit etwas anderen Protagonisten, leicht abgewandeltem Plot, gleichwohl mit mehr Thriller-Elementen und weniger Ballerei – selbst der eiskalte Bösewicht aus |“Lethal Weapon 4″| (dort genialst dargestellt von Jet Li) ähnelt der Figur des „Geist“ Kwan Ang in Deavers Werk in vielerlei Hinsicht, sodass ich vermute, dass diese Rolle hier mehr als nur Pate gestanden hat. Trotzdem ein lesenswertes und kurzweiliges Buch. Wenn auch kein Gassenhauer, so doch wenigstens leicht verdauliche und unterhaltsame Thriller-Kost, die solide verfasst wurde und den Erwartungen von Deaver-Fans sicher gerecht wird. Mir ist es stellenweise schlicht zu seicht und durchsichtig.
Tolkiens Bücher sind Klassiker und erlangten zu Recht Weltruhm, anders als beim Ringkrieg, besser bekannt als die |“Herr Der Ringe“|-Trilogie, welche aus einem Sammelsurium von zunächst unzusammenhängenden Kapiteln besteht, ist |“Der Hobbit“| eine Geschichte, die Tolkien in einem Rutsch schrieb. Von Anfang an war die Geschichte um Bilbo Beutlin als Kinderbuch geplant gewesen, allerdings mit dem Hintergrund der Fantasywelt Mittelerdes, deren Grundzüge Tolkien bereits kurz nach dem ersten Weltkrieg schuf.
Der Erfolg dieses Werkes kam für JRR recht unerwartet und dem ist es auch zu verdanken, dass Tolkien überhaupt in Erwägung zog, den heute wesentlich berühmteren |Herrn der Ringe| zu überarbeiten und als eigenständige Geschichte zu veröffentlichen – eigentlich waren die Geschichten rund um Mittelerde nur für ihn selbst bestimmt und fanden dementsprechend nur in der Phantasie seines Kopfes statt. Selbst nach seinem Tod wurde die Fackel weitergetragen: Sein Sohn Christopher – JRRs allererster und kritischster Rezensent – zeichnete nicht nur die Karten, die heute in allen Büchern zu finden sind, sondern trug auch unveröffentlichtes Material seines Vaters zusammen, was posthum in weiteren Publikationen gipfelte.
Das Berühmteste davon ist sicher [|“Das Silmarillion“|, 408 welches die Anfänge und die Schöpfungsgeschichte Mittelerdes behandelt. Eine Rohfassung der Historie von Mittelerde, wie sie das Silmarillion beschreibt, sind |“Die verlorenen Geschichten“| in zwei Bänden, die sich hauptsächlich um das Reich „Westernis“ (später besser bekannt als „Númenór“) kümmern. Somit stellt |“Der Hobbit“| bemerkenswerterweise das erste komplett fertiggestellte Buch und nicht den tatsächlichen Anfang der niedergeschriebnen Geschichten dar (wie man es bei „Fortsetzungen“ eigentlich erwarten könnte), sondern streng genommen ein Bindeglied mittendrin.
_Zur Story_
Hobbits sind die leicht kleinbürgerlichen Spießer von Mittelerde, die für alles, was sich außerhalb ihres geliebten, friedlichen Auenlands abspielt, nicht nur wenig Interesse, sondern vielmehr spöttische Verachtung übrig haben. Hobbits – oder auch „Halblinge“ genannt – leben in bequemen und gut ausgestatteten Erdhöhlen. Sie weisen einen kleinen Wuchs auf, selten werden sie größer, als 1 – 1,2 Meter, noch dazu ist ihre Statur eher gedrungen und rundlich um die Hüften. Wahrlich kein Volk, das dem Bild heldenhafter Abenteurer entspricht, die sich für gewöhnlich mit der Bekämpfung von Drachen beschäftigen. Solcherlei „Unfug“ überlässt der gemeine Auenländer lieber dem „Großen Volk“ (den Menschen) oder den geschäftstüchtigen Zwergen.
Doch ab und zu schlagen immer wieder mal Hobbits aus der Art und die zieht’s tatsächlich zu Abenteuern hin, das gilt vor allem für die Sippe des alten Tuck, zu welcher auch Bilbo Beutlin gehört. Bilbo ist bis dato ein bodenständiger Hobbit von 50 Jahren, als der Zauberer Gandalf eines schönen Tages an seine Tür klopft und die Geschichte ihren Lauf nimmt. Ehe Bilbo es sich versieht, steckt er als „Meisterdieb“ engagiert mitten in einer zwölfköpfigen Schar von Zwergen, die seine Dienste beim Zurückerobern eines Zwergenschatzes tief unten im „Einsamen Berg“ benötigen.
Das Dumme dabei ist, dass Bilbo eigentlich gar kein Meisterdieb ist, wenngleich eine Eigenschaft seines Volkes darin besteht, beinahe lautlos zu verschwinden, wenn sie es wünschen. Noch dazu wird der Schatz vom alten Drachen Smaug beschützt, der sicher nicht davon begeistert sein wird, wenn man Hand an „seine“ geraubten, unermesslich wertvollen Wertgegenstände legt. Smaug mag alt sein, doch gefährlich ist er dennoch. Und blöd ist er auch nicht.
Obwohl nun Hobbits alles andere als abenteuerlustig sind, riskiert Bilbo die beschwerliche Reise, wohl die Schicksalsschwere seiner Handlungen in weiter Zukunft unterbewusst ahnend. Der kleine Hobbit und seine Mitstreiter sollen auf ihrem Weg so mancher Gefahr trotzen. Dabei sind drei gefräßige Trolle erst der Anfang und so richtig zur Sache geht’s hernach, als man Bruchtal – die Heimstadt Elronds des Halbelben – in Richtung Nebelgebirge verlässt und in den dortigen Höhlen von Orks überfallen und gekidnappt wird. Hier in den finsteren Kavernen kommt es auch zu der schicksalshaften Begegnung mit dem Geschöpf Gollum, dem Bilbo den später so berühmten und heiß begehrten |Einen Ring| und sein blankes Leben mit einer List abringen kann.
Damit werden Ereignisse in Gang gesetzt, die später im Ringkrieg gipfeln sollen, doch noch ist der Ring einfach nur ein Zauberring, der Bilbo und seinen später wiedergefundenen Zwergen-Kameraden im Laufe dieser Odyssee noch häufiger die Haut retten soll. Dennoch ist der Schatten des Herrn von Mordor ebenfalls anzutreffen, wird aber nur am Rande erwähnt, als Gandalf die Gruppe zwischenzeitlich sich selbst überlässt, um den „Nekromanten“ aus dem Finsterwald zu vertreiben. (Richtig geraten, es ist Sauron.)
Unsere Helden schlagen jedoch einen anderen Weg ein, der sie nach weiteren gefahrvollen Momenten und Begegnungen in die Drachenhöhle unter dem Einsamen Berg führen soll. Hier muss Bilbo nun beweisen, dass er wirklich der Meisterdieb ist, für den die Zwerge ihn halten und „sein“ später so berühmter und gefürchteter Zauberring bekommt ordentlich zu tun.
_Meinung_
„Der Hobbit – oder: Hin und Zurück“ – Ich habe dieses Werk des Altmeisters der Fantasyliteratur bereits im zarten Alter von neun Jahren zum ersten Mal gelesen und war fasziniert. Damals hieß es noch: „Der |kleine| Hobbit“. Mittlerweile ist man zu einer akkurateren Übersetzung des Titels und des Inhalts übergegangen, wofür sich Wolfgang Krege verantwortlich zeigt. Das hat nicht überall Anklang gefunden, viele meinen, man hätte die deutsche Urfassung unangetastet lassen sollen. Ich mag beide Varianten. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Die Neuübersetzung ist moderner und flotter, während die alte etwas geschwollen-sperrig („very british“ sozusagen) und archaisch daherkommt. Besser ist es natürlich,wenn man direkt das englische Original liest.
Der Stil des Hobbits ist wesentlich einfacher gehalten als die anderen etwas ernsthafteren Bücher Tolkiens aus Mittelerde, immerhin handelt es sich dabei ja auch um ein Kinderbuch. Die angedachte jugendliche Leserschaft wird von JRR oft im Plural geduzt („Was würdet IHR machen?“) und somit direkt angesprochen bzw. mit einbezogen, hier gönnt Tolkien seinen Lesern zwischendurch die Gelegenheit, das Gelesene zu reflektieren. Diese Einschübe, wo er quasi zum Mitdenken auffordert, sind zudem willkommene kleine Pausen in der temporeichen Geschichte, die ich für Kinder ab acht bis zehn Jahren für geeignet halte.
Trotzdem weist „Der Hobbit“ viel Handlung und Querverweise auf, die es auch für erwachsene HdR-Fans nicht nur lesenswert, sondern immens wichtig machen, denn hier ist das Bindeglied zur Trilogie und den zeitlich früher handelnden Büchern. Viele Personen, Wesen, Orte und Gegebenheiten, die später von Bedeutung sind, hat JRR teils gut versteckt untergebracht, sodass sie den Fan ansprechen, jedoch auch den Neuling nicht vor den Kopf stoßen – Letztere werden vielleicht den einen oder anderen Satz einfach so überlesen, der einem Fan ein schiefes Grinsen abverlangt.
Doch auch ohne den restlichen Mittelerde-Kontext findet sich der Leser zurecht, die eingestreuten Hinweise auf andere Handlungen sind zwar für den Kenner das Salz in der Suppe, benötigt man aber nicht, um diese Geschichte zu verstehen und zu mögen. Sie ist in sich schlüssig und kann für sich alleine stehen, ohne dass man den Rest kennt. Tolkiens oft gepflegter subtiler und feiner Humor findet sich auch im Hobbit wieder, doch denke ich, dass dieser wohl nur (fast) erwachsenen Lesern ins Auge fallen dürfte, auch deshalb ist es nicht nur ein Buch für Kinder, sondern für alle Generationen.
Jede Altersgruppe wird damit angesprochen und etwas für sich darin finden, man muss nur genau hinlesen. Eine gelungene Gratwanderung, die ihresgleichen sucht. Im Buch wird auch gewaltsam gestorben, wenngleich auch nicht so heftig und blumig-ausführlich beschrieben wie im HdR. Wird dort noch darüber referiert, wie schön aerodynamisch (Ork-)Köpfe rollen & fliegen, nimmt JRR hier nen Gang zurück und redet allenfalls von „erschlagen“, was zwar prinzipiell aufs Gleiche herauskommt, sich jedoch wesentlich weniger blutig anhört.
_Fazit_
Ein Must-Read-Buch für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, die knapp 320 Seiten zu lesen und die darin enthaltenen Botschaften zu verstehen, fällt leicht. Wem es sprachlich möglich ist, sollte das Original lesen, denn dann erübrigt sich auch die Diskussion, welche der deutschen Übersetzungen die treffendere ist. Die Abenteuergeschichte ist zeitlos genial und kann auch losgelöst von seinem berühmten Nachfolger verstanden werden, es empfiehlt sich aber, den „Hobbit“ zu lesen, bevor man sich an HdR (Film oder Buch) wagt. Man ist über manche Zusammenhänge wesentlich besser im Bilde. Das Nicht-Kennen des Hobbits ist zudem eine echte Bildungslücke, obwohl er ja seit jeher im Schatten der Trilogie stand. Unverdient. Nicht nur HdR-Fans, die nur die Verfilmung von Peter Jackson kennen, und ein wenig tiefer in die Geschichte von Mittelerde eintauchen wollen, kommen auf ihre Kosten.
_Buchdaten:_
Originaltitel: „The Hobbit“
Ersterscheinungsjahr: 1937
Deutsche Übersetzung: Margaret Carroux oder Wolfgang Krege
ISBN: 3-608-93805-2 (1998 Neuübersetzung / Klett-Cotta)*
ISBN: 3-423-20277-7 (2001 „Klassische“ Übersetzung / dtv)*
ISBN: 0-261-10221-4 (2001 Englisches Original / HarperCollins)
Format: Broschiert oder Hardcover / um 320 Seiten
Extras: Kartenmaterial *
Preis: variiert je nach Ausgabe von 4,50 – 14,95 €
*) Die von mir rezensierte Version des Werkes ist eine Lizenz-Ausgabe (2001) aus dem |Club Bertelsmann|. Der dort erhältliche, leinengebundene Hardcover-Schmuckband hat herausnehmbare Karten Mittelerdes, Lesebändchen und einen Golddruck-Präge-Schutzumschlag. Inhaltlich ist das Buch jedoch mit dem Original aus dem |Klett-Cotta|-Verlag und der Taschenbuchausgabe von |dtv| identisch.
Wohl kaum etwas hat die Weltgemeinschaft im noch sehr jungen Jahrtausend so in helle Aufregung versetzt wie der Anschlag auf die „Twin Towers“ des |World Trade Center| am Nine-Eleven. Dies war der Auftakt zu einer Kampagne von Feld- oder sollte man besser sagen |Kreuz|zügen?, die uns Bewohner dieses durchgeknallten Planeten sicher noch viel länger beschäftigen wird, als uns allen lieb (und einigen bewusst) ist – ausgelöst durch die letzte verbliebene Supermacht und selbst ernannten Weltsheriffs, die nun endlich die Möglichkeit und Legitimation sahen, ganz mächtig – und entgegen dem geltenden Völkerrecht – loszuschlagen.
Da die „Beweise“ für einen muslimischen Terrorakt mittlerweile immer zweifelhafter erscheinen, brauchte man wohl ein wenig Propaganda, daher bedient sich die Machtzentrale wohl nun auch des berufenen Mundes Bob Woodwards (Pulitzer-Preisträger und zusammen mit seinem Kollegen Bernstein der journalistische Enthüller der Watergate-Affäre, die seinerzeit Richard Nixon zu Fall brachte). Woodward gilt als Number One unter den investigativen Vertretern der Journallie und auch sein deutscher Verlag (der ehrenwerte |SPIEGEL|-Buchverlag) spricht vom Namen her für ein kritisches Sachbuch über die ersten 100 Tage nach den Anschlägen – Wollen wir mal sehen, was davon zu halten ist …
_Worum geht’s? – Zum Inhalt_
Woodward ist seit jeher bei der angesehenen Tageszeitung „Washington Post“ beschäftigt und wird seit 1972 als |der| kritische Beobachter der amerikanischen Innenpolitik gefeiert (die oben erwähnte Watergate-Affäre). Ein richtiger Wadenbeißer möchte man meinen, vor dessen Feder die Mächtigen der USA zittern. Dennoch gelingt ihm der Coup, an die geheimen *hust* Protokolle des Sicherheitsrates zu gelangen, die Nine-Eleven und den anschließenden Afghanistan Feldzug beinhalten – beinahe freiwillig habe man sie (ausgerechnet ihm!) zugänglich gemacht und auch von Seiten der Behörden und sogar der Regierung (sic!) war man gern bereit, ihm für Interviews Rede und Antwort in dieser Sache zu stehen.
Der Junta-Chief himself kommt übrigens auch oft zu Wort und wird fleißig zitiert, komischerweise jedoch nicht seine bekannten markig-lächerlichen und sinnentleerten Sprüche, die uns auch aus seinen hochnotpeinlichen TV-Auftritten bestens bekannt sind, sondern allerhand extrem fragwürdiges pseudo-intelligentes Zeug, was er Woodward gegenüber in seinen Interviews zum Besten gegeben haben soll. Woodward rekapituliert diese hundert Tage, als wäre er förmlich bei den zum Teil hochgeheimen Treffen der US-Machtzentrale persönlich anwesend gewesen. Was er nachweislich ja nicht kann, ergo ist er auf das angewiesen, was ihm diejenigen, die dort teilnehmen durften/mussten, an Informationsbrocken vor die Nase setzen.
Die hauptsächlich handelnden Personen sind hierbei: Möchtegern-Präsi George Walker Bush, Sicherheitsbelaberin Condolezza Rice, Außenscherge Colin Powell, Pentagramm-Vorstand Donald Rumsfeld, Vize-Wäre-Gern-Präsi Richard „Dick“ Cheney, CIA-Chef-Terrorist Tenet und deren Vertreter. Ach ja. Ein paar vom Fußvolk des CIA dürfen in Afghanistan auch ein paar Warlords schmieren und sich an der Frontlinie irgendwie nützlich machen. Vor allem aber ein vor Pathos nur so triefendes Ende verursachen. God bless America! Oder so.
_Wer’s glaubt, wird selig – Meinung_
Was augenscheinlich wie der große journalistische Wurf anmutet, besteht schon im Vorwort keinen zweiten Blick, denn wie Woodward dort bereits andeutet, habe man zwar von offizieller Stelle sein Buchmanuskript durchgesehen und zum Teil auf „Irrtümer“ hingewiesen, es sei jedoch nicht zensiert worden. Da er von vorneherein so vehement auf diesen Umstand pocht, kommt mir automatisch der alte Sinnspruch in den Kopf, dass wer sich vorweg ungefragt, pauschal und ohne erkennbaren Anlass verteidigt, etwas im im Schilde führt. Es riecht also bereits auf den ersten Seiten bei der Lobhudelei auf die tolle, kooperative CIA verdächtig und ganz extrem nach Schwefel – Hier ist also buchstäblich schon irgendwas im Bush, dabei hat das Buch noch nicht mal richtig angefangen und mir sträuben sich bereits die Nackenhaare.
Auf den ersten 100 Seiten erfahren wir nun wer, wo, was, wann gesagt und getan haben soll, als das WTC attackiert wurde, hier hebt Woodward mindestens drei Mal hervor, dass der „gewählte“ Präsident dieses oder jenes zu einer bestimmten Zeit unternahm oder anordnete. Es ist nicht nötig extra zu erwähnen, dass ein Präsident gewählt wird, das ist in der Regel nun mal so (außer eben bei diesem), also wie soll man diese auffällige Hervorhebung dann interpretieren – Ironie seitens des Autors?
Ich könnte jetzt in nicht enden wollende Dauerlästerei verfallen und fast jede Seite mit Gegenargumenten und Quellen belegen, doch dann kann ich gleich selbst ein ganzes Buch schreiben – ich überlasse in diesem Fall mal der Presse das Wort und kommentiere anhand der drei auf dem Buchrücken abgedruckten Statements deutscher Pressestimmen:
|“Wer Woodward gelesen hat, wird glauben, bei Bush und den Seinen dabei gewesen zu sein.“ (DIE ZEIT)|
Kommentar: Na klar, |Glaube| trifft es ziemlich gut, Glaube ist der Mangel an Wissen und selbst heute glauben noch viele an die Unbefleckte Empfängnis und daran, dass Schokoriegel gesund sind. Lieber Kritiker von |DIE ZEIT|, es muss richtig heißen: „Wer Woodward gelesen hat, |soll| glauben, bei Bush und den Seinen dabei gewesen zu sein“ oder wie es der Sportsender DSF in seinem Werbeslogan so trefflich ausdrückt, ist es besser „mittendrin statt nur dabei“ zu sein. In diese Sitzungen hat man ihn (aus nachvollziehbaren Gründen) aber nicht vorgelassen und ihn stattdessen mit äußerst dubiosen Protokollen gefüttert, die meine Oma hätte ebenso verfassen können – und die arbeitet (zumindest meines Wissens nach) nicht für die CIA.
Der Autor versucht eine gewisse Nähe zwischen der Leserschaft und den Protagonisten zu schaffen, indem er den Handelnden Emotionen wie „sie oder er dachte“ oder „empfand dies und das“ zuordnet, nur fließt die Gedanken- und Gefühlswelt bekanntermaßen nicht dergestalt in Protokolle eines Sicherheitsrates ein und muss daher reine Spekulation bleiben. Nur selten verweist er auf von ihm oder anderen geführte Interviews, aus denen er die verwendeten Informationen bezieht (allerdings sind auch alle Zitate weitgehend ohne Quellenangabe, was den Autor nicht glaubwürdiger macht).
|“Um zu verstehen, wie die Bush-Administration ihre weltpolitische Bedeutung und ihre geopolitischen Möglichkeiten einschätzt, ist das Buch von fundamentaler Bedeutung.“ (SÜDDEUTSCHE ZEITUNG)|
Kommentar: Hat fundamental nicht etwas mit fundamentalistisch zu tun? Na egal, da in dem Werk keinerlei Hinweise zu den massiv bestehenden Verknüpfungen der einzelnen Kabinettsmitgliedern zu wichtigen Firmen in der Kriegs- und Ölmaschinerie (nicht zu vergessen die innige Connection zwischen der bin-Laden-Familie und dem Bush-Clan) hergestellt werden, ist dies allenfalls ein unvollständiges und lückenhaftes Bild – um zu verstehen, was wirklich an unglaublicher Perfidität hinter den Machtinteressen der amerikanischen Führungs-Elite steckt, muss man wesentlich tiefer graben, als Woodward es gewagt hat (oder wagen durfte?) – Ein schwaches Bild für einen angeblichen Schnüffel-Journalisten, die solcherlei Angriffspunkte schon von Berufs wegen doch liebend gern weidlich ausschlachten.
Doch nichts davon wird auch nur ansatzweise aufgegriffen! Weder Haliburton noch Carlyle oder ähnlich dubiose von US-Politikern geführte bzw. mit ihnen verbundene Firmen werden auch nur mit einer Silbe erwähnt. Außerdem wird ziemlich schnell klar, dass Osama nicht das eigentliche Ziel der Vergeltungsschläge ist – zunächst wird dieser Eindruck zwar erweckt, doch schon bald ist vom angeblichen Schreckgespenst Al Qaida und dergleichen nichts mehr zu lesen, sondern nur noch von den Taliban, denen man auf deutsch gesagt um jeden Preis den Arsch aufreißen will. Natürlich spielen geopolitische Interessen eine Rolle, aber ganz andere, als hier geschildert – dass von Streubomben und ähnlichem Zeugs auch kein Sterbenswörtchen fällt, dürfte klar sein und spätestens jetzt niemanden mehr wundern … Die „Daisycutter“-Bomben werden zwar am Rande angerissen, aber derart, dass man glaubt, es wäre nur gerecht, sie zu abzuwerfen.
|“Woodward gelang ein Coup: Er konnte die Sitzungsprotokolle des Nationalen Sicherheitsrates an Land ziehen. Aus ihnen ergab sich die einzigartige Perspektive des Buches.“ (DER SPIEGEL)|
Kommentar: Oh, diese Formulierung ist geschickt und kann doppeldeutig gelesen werden, die Jungs und Mädels vom |SPIEGEL| sind nicht doof, man kann schon von einer einzigartigen Perspektive sprechen, ich würde das aber eher als ein|seitige| Sicht der Bush-Krieger bezeichnen, die Woodward brav nachbetet. Ob diese Protokolle vollständig (und wahrheitsgemäß) sind, darf anhand einiger fehlender Begebenheiten, die nachträglich öffentlich wurden, arg bezweifelt werden. So manche Passage aus dem Buch ist durch wirklich investigative Journalisten mittlerweile |ad absurdum| geführt und als Propaganda-Mär entlarvt worden.
Ebenso wie viele Äußerungen der amerikanischen Regierung zum Fall des WTC und des Afghanistan-Feldzugs. Insofern ist die Authentizität der ach-so-geheimen Protokolle doch stark anzuzweifeln, denn wenn sich viele Punkte als faustdicke Lüge herausstellen, darf man davon ausgehen, dass der Rest ebenso fragwürdig ist. Es handelt sich hierbei nämlich lediglich um die enttarnten Flunkereien – aber mit aller Wahrscheinlichkeit sind das noch längst nicht alle. Inwieweit die Protokolle den Tatsachen entsprechen, wird wohl nie ganz geklärt werden können, eines steht auf jeden Fall fest: Sie wurden massiv getürkt.
_I want to believe – Das Fazit_
Dies ist kein „Enthüllungs“-Buch, denn es leiert nur die Propaganda und Bettelei um Verständnis für den Einsatz in Afghanistan herunter. Dabei ist nicht einmal geklärt, ob die Selbstmordattentäter überhaupt welche waren. Zumindest bestehen in einigen wichtigen Punkten berechtigte Zweifel, ob nicht der Regierungsapparat selbt mit Hilfe des CIA und anderen ein wenig nachgeholfen hat, um die Legitimation, andere Staaten mit Krieg zu überziehen, zu erhalten. Wie dem auch sei, dieses Buch ist weder sachlich noch lesetechnisch auf der Höhe. Wenn ich statt Condoleeza (Rice) wiederholt „Condi“ lesen muss (die Anführungszeichen sind von mir, Woodward setzt dort keine!), keimt in mir der Verdacht auf, dass hier eine Verniedlichung und subtil eingefädelte Solidarisierung herbeigeführt werden soll – traurig, dass sich ein solches Urgestein offenbar so ohne Weiteres vor den Karren spannen ließ, diese Fabeln zu verbreiten.
Für einen ausgezeichneten Pulitzer-Reporter geht mir das kritische Hinterfragen vollkommen ab stattdessen dümpelt der Autor beim Weglassen des ganzen Firlefanzes tatsächlich nur an der Oberfläche. Die Intention dieses Buches mag falsch verstandener Patriotismus sein, oder ein weiteres denkbares Szenario wäre, dass Woodwards Arbeitgeber, die „Washington Post“ (wie übrigens auch der Nachrichtensender ABC) fest in der Hand des Bush-Clans ist. Ein Schuft, wer jetzt denkt, dass Woodward diese Hände nicht beißt, die ihn füttern. Ohne in Verschwörungstheorien abgleiten zu wollen, aber hier stimmt was nicht. Dennoch lassen sich zwischen den Zeilen einige Infos extrahieren, die interessant sind, wenngleich wohl nur ungewollt preisgegeben. Allerdings muss man sich dafür schon stark interessieren oder durch Zugriff auf andere Literatur quer lesen, damit man dem Puzzle einige weitere Stückchen hinzufügen kann. Man kann sich das Propaganda-Werk |just for show| mal geben, der Preis für die Restexemplare ist laut |amazon.de| mittlerweile auf 4,95 statt 25 Euro runtergegangen.
Kritische Betrachtungsweisen zum 9/11 gibt es wie Sand am Meer. Kurioserweise schießen sie stets vor dem betreffenden Datum aus der Deckung hervor und zurück in die Köpfe der Gesellschaft. Gerhard Wisnewski legt nach seiner letzten Publikation [„Operation 9/11 – Angriff aus den Globus“ 678 mit „Mythos 9/11 – Der Wahrheit auf der Spur“ sein mittlerweile zweites Buch zum Thema vor, bei dem der Cover-Aufdruck „neue Enthüllungen“ verspricht. Unterstützt wird er bei der Publikation von Willy Brunner, mit welchem er schon die WDR-Dokumentation „Aktenzeichen 9/11 ungelöst“ produzierte, die 2003 einige Wellen schlug. Aufgrund eben jenes Beitrags wurden sie beim Westdeutschen Rundfunk geschasst und mit einem Beschäftigungsverbot beim öffentlich-rechtlichen TV belegt. Man kann nach der bewegten Vorgeschichte des Autors also davon ausgehen, im vorliegenden Werk auf einigen Zündstoff zu stoßen. Oder auch nicht?
_Offizielle contra Verschwörungstheorie_
In der öffentlichen Meinung wird der 11. September gerne kollektiv wie eine heilige Kuh behandelt. Obwohl an der offiziellen Version des Attentats so manches Teil nicht passt. Demzufolge entschied sich ein gewisser Herr Osama bin Laden, 19 Terrorpiloten auszusenden, um das Wirtschaftszentrum der Welt (das WTC), das Weiße Haus und das Pentagon empfindlich zu treffen. Vier gekaperte zivile Verkehrsmaschinen sollen die mutmaßlichen Entführer dafür in ihre Gewalt gebracht und als lebende Bomben in die betreffenden Ziele gelenkt haben. Im Falle von UA 93 ging es daneben, sie erreichte ihr Ziel (mit großer Wahrscheinlichkeit das Weiße Haus) in Washington nicht, sondern crashte vorgeblich bei Shanksville / Pennsylvenia in den Acker. Nebenbei eine „schöne“ Mär von Heldenmut und tapferen Passagieren.
Soweit die hinlänglich bekannte Version, welche über die Medien permanent verbreitet wurde und wird, in deren Konsequenz eine gefährliche Kettenreaktion ausgelöst wurde, die bis heute andauert: Der Afghanistan-Feldzug und in (bisher) letzter Instanz der Irak-Krieg. Die Anschläge mussten seither für eine Menge Repressalien und Einschränkungen in der Freiheit herhalten – alles mit dem Totschlagargument des „Kampfes gegen den Terrorismus“. Der beinahe in Nullzeit eingeführte „Patriot-Act“ ist nur ein einzelnes und prominentes Beispiel dafür, wie man sein Staatsvolk gängeln und die Verfassung aushebeln kann. Man gewinnt den Eindruck, dass genau ein solcher Fall von langer Hand vorbereitet wurde. Selbst hierzulande sind die Ausläufer des Innere-Sicherheit-Bebens mit Epizentrum in den USA spürbar. Unlängst knickt auch das alte Europa zunehmend ein. Mehr noch. Dank 9/11 schwelt es auf unserem Planeten nicht mehr, es brennt sogar schon lichterloh.
Auch wenn einige es immer noch nicht verstanden haben: Wir stehen mitten in einem weiteren Weltkrieg, ein Krieg, der jedoch auf subtilerer Ebene ausgefochten wird als seine beiden Vorgänger. Das macht ihn nicht weniger real oder vielleicht weniger tödlich für die Partizipanten, bekam aber das Label eines „gerechten“ Krieges. Dabei haben sich alle zur Rechtfertigung herangezogenen und vorgebrachten „Beweise“ für die militärischen Interventionen bislang als fadenscheinig, nicht haltbar und völkerrechtlich höchst bedenklich herausgestellt. Dass Dank des Schaffens von Fakten auch handfeste geopolitische und wirtschaftliche Interessen quasi im Handstreich durchgepeitscht wurden, wird gerne übersehen oder als „pietätlos“ wegzudiskutieren versucht. Das wirft vor diesem Hintergrund natürlich die Frage auf, was an der Geschichte des alles auslösenden Schlamassels denn nun wirklich wahr und was davon praktikable Dichtung ist.
Fest steht, dass die Ungereimtheiten des 9/11 unübersehbar sind und es allerorts mit viel Schlamperei, wenn nicht sogar Manipulation zuging. Aufklärung – so scheint es – wird nicht gewünscht; auch wenn so manche berechtigte Kritik geäußert wird, finden sich diejenigen, die sie vorgebracht haben, entweder als Terrorsympathisanten oder spinnerte Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und ins Abseits gestellt wieder. Gruppenzwang auf amerikanisch – „Wer nicht unserer Meinung ist, kann nur ein Feind sein“. Dieser gefährlich pauschalisierte Automatismus ist unlängst in Gang gesetzt eine gern verwendete Waffe und probates Mittel, Kritiker kalt zu stellen und unangenehme Fragen zu unterbinden. Wie man an der Vielzahl von Websites und anderen Publikationen sieht, zieht diese Masche aber nicht überall.
_ Zum Buch_
Soweit also zur Ausgangslage, die auch dem Grundtenor des Buches entspricht. GW konzentriert sich aber nicht so sehr auf New York. Er verbeißt sich stattdessen verstärkt in die vermeintlichen Nebenkriegsschauplätze bei Shanksville und Washington, welche im Bewusstsein der Öffentlichkeit nicht ganz so präsent sind wie die bildtechnisch besser dokumentierten Vorgänge um den Einsturz der WTC-Tower. Das ist seiner Ansicht nach der Grund, warum an diesen beiden Orten, die nicht unter so vielen Zeugen getroffen wurden, auch keine Verkehrmaschinen einschlugen und es sich bei den Kratern nicht um Folgeschäden von Verkehrs-Linern, sondern um etwas anderes gehandelt haben kann/soll. Raketenbeschuss oder das Auftauchen eines Kampfflugzeugs vom Typ A-10 „Warthog“ bzw. einer mit Sprengstoff beladenen Drohne hält er für möglich, gestützt auf Augenzeugenberichte, Fotos und Filmaufnahmen direkt nach dem Desaster. Er kommt zu dem Schluss, dass es sich hier um eine lupenreine Inszenierung gehandelt hat – und eine schlampige noch dazu.
Anhaltspunkte für diese Theorie liefert ihm dabei nicht nur das, was man auf den Fotodokumenten und den vom FBI freigegebenen Bildern einer Überwachungskamera sieht, sondern auch das, was NICHT sichtbar ist: Flugzeugtrümmer nämlich, die zu den entführten Maschinen passen. Die offizielle Darstellung lautet: Sowohl die Boeing, die in das Pentagon einschlug, als auch jene, welche bei Shanksville den Boden umpflügte, seien vollständig „pulverisiert“ worden. Kurioserweise ist das einmalig in der Geschichte der Luftfahrt, da man bei ähnlichen Unfällen und Abstürzen doch bislang immer erkennbare Teile eines Flugzeugs dieser Größenordnung finden kann. Diese beiden Maschinen jedoch sind die Ausnahmen und das sogar an einem einzigen Tag. Zudem fehlen beim besagten Pentagon-Crash-Video urplötzlich elementare Passagen des Einschlags (erkennbar am Time-Stamp). Andere Videos von diversen Überwachungskameras wiederum sind hochoffiziell konfisziert und auf Nimmerwiedersehen im Orkus der Behörden verschwunden. Offizielle Begründung: „Nationale Sicherheit“ und „Pietät gegenüber den Angehörigen der Opfer“.
Dies sind aber nicht die einzigen Seltsamkeiten, die GW wirksam plakativ an den Leser bringt, es gibt durchaus noch mehr Aspekte, bei denen man staunend den Kopf schüttelt. Ferngesteuerte Drohnen, welche die „richtigen“ Maschinen ersetzten, sowie das unglaublich erscheinende Einstürzen gleich beider Tower in New York (was laut einiger Fachleute ziemlich unmöglich und unwahrscheinlich ist) sind nach seinem Dafürhalten keine Präzedensfälle. Sowohl Hollywood als auch schon vorherige Regierungen haben qua CIA und anderer Behörden ein solches Szenario mehr als einmal durchgekaut und in Betracht gezogen. Hinter vorgehaltener Hand natürlich. Bekannt wurde eine Aktion in den sechziger Jahren, die nach gängiger Meinung im Kennedy-Attentat gipfelte: „Operation Northwoods“ bzw. „Mongoose“. Hier sollten Kuba mit ganz ähnlichen Methoden wie heute der Islam diskreditiert und das amerikanische Volk mental auf eine Invasion vorbereitet werden. Somit wäre der Tenor der Bush-Administration „Wir haben das nicht gewusst/ahnen können“ äußerst scheinheilig. Das Drehbuch lag schon lange vor.
Gescholten werden auch die merkwürdigen Ermittlungsmethoden der US-Behörden und selbstverständlich die Journallie. Auch (und gerade) die deutsche. Logisch, denn mit dieser haben GW und WB auch hinreichend schlechte Erfahrungen gemacht und ihre Jobs beim WDR verloren. So nimmt es nicht wunder, dass die beiden Autoren hier keilen und Schienbeintritte verteilen. Im Fokus steht wieder einmal ganz besonders das Nachrichtenmagazin |“Der Spiegel“|, was für manch einen sicher einer glatten Majestätsbeleidigung gleichkommt. Das renommierte Hamburger Magazin muss sehr häufig stellvertretend als Buhmann für die ganze Zunft herhalten und sich wohl seinen Zorn zugezogen haben. Es wird ohnehin viel Werbung in eigener Sache gemacht und die Opferrolle anscheinend doch irgendwie genossen. Zwar mündet das nicht in absoluter Selbstbeweihräucherung oder -bemitleidung, jedoch ist es schon etwas auffällig, dass immer wieder von eben jenen kritischen Organisationen die Rede ist, in denen GW – zum Teil – führendes Mitglied ist.
Neu sind die Vorwürfe, dass am 9/11 ein Riesenschwindel stattgefunden hat, hingegen alle nicht. Die diversen Nutznießerschaften verschiedener neokonservativer Gruppen aus einem solchen Anschlag sind schon des Öfteren diskutiert worden – sowohl in den hier attackierten „konformen“ Medien, als auch in „konspirativen“ Kreisen. Über die möglichen Motive herrscht also weitgehend Einigkeit. Wer sich mit dem Thema etwas auseinander gesetzt hat, wird das alles irgendwie schon einmal gehört haben. Die Verbindungen der Saudis (speziell derer bin Ladens) zum Bush-Clan, die vollkommen dilettantisch-überdeutliche (und somit fragwürdige) Spurenlage, die ausgerechnet 19 nachweisliche Fliegerei-Nieten als Hauptschuldige darstellt. Die de facto nicht wirklich durchgeführten Untersuchungen der Behörden, das ausweichende Schweigen der Regierenden zu unangenehmen Fragen mit dem Universal-Argument „Nationale Sicherheit“, kurzum: all die „Schludrigkeiten“ und kalkuliert verbreitete Desinformation der Bush-Administration sind ja mittlerweile schon legendär.
_Fazit_
In der Hauptsache werden hier unlängst zuvor geäußerte Theorien und Spekulationen sowie die (großteils berechtigte) Kritik an unserer Medienlandschaft noch einmal aufgekocht. Dabei können weder die unscharfen Bilder, noch die scharfe Zunge Wisnewskis – übrigens ebenso wenig wie die offizielle Version – letztendlich zweifelsfrei beweisen, was am 11. September 2001 nun wirklich geschah. Was bleibt, ist die Frage nach der Motivation dieses Buches. Frust auf die Medien? Bitterkeit wegen des Rauswurfs beim WDR? Ich vermeine das zwischen den Zeilen und in bestimmten Formulierungen ein wenig herauszulesen, doch letztendlich weiß das nur der Autor selbst. Der Schreibstil jedenfalls ist gefällig und nicht frei von einem unterhaltsamen, ironisch-sarkastischen Unterton, was die ganze Sache süffig und flott lesbar macht. Mir entlockt der reißerische Aufdruck: „Neue Enthüllungen!“ trotzdem nur ein halbherziges Gähnen.
Ich zähle mich selbst zu den Zweiflern, stehe also dem Gedankengut per se nicht grundsätzlich negativ gegenüber, dass der 9/11 und das Drumherum ganz anders abgelaufen sind, als man uns von offizieller Seite und den Massenmedien her Glauben machen will. Wisnewski benutzt als Aufhänger bevorzugt den Pentagon- und Shanksville-Crash, leider sind gerade diese Fälle, wegen der spärlich verfügbaren und streckenweise dubiosen Informationsquellen, besonders schwer auf ihren Wahrheitsgehalt hin verifizierbar. Nichts Genaues weiß man nicht. Als Nachschlagewerk für gestandene Verschwörungstheoretiker bietet „Mythos 9/11“ sicherlich zu wenig Neues und für Neueinsteiger in die Materie nur einen (zu) kleinen Ausschnitt des Gesamtbildes, als dass man sie damit überzeugen könnte, dass die bisher verbreiteten Geschichten Mumpitz sind. Ohne Zusatzliteratur wird man als Laie in der Thematik schwerlich alles nachvollziehen können. |Summa summarum| eine unterhaltsame Lektüre, doch alles andere als eine Offenbarung.
Bibliographie des Autors:
Das RAF-Phantom (1992 als Co-Autor)
[Operation 9/11 678 (2003)
Mythos 9/11 (2004)
Weiterführende Informationen:
www.operation911.de (Website des Autors)
www.unansweredquestions.org (Website der Hinterbliebenen-Organisation)
Bitte beachtet zu dieser Thematik auch unseren Gastbeitrag von Mathias Bröckers:
[Fiktion & Wahrheit – Verschwörungstheorien als moderne Mythen.]http://www.buchwurm.info/artikel/anzeigen.php?id=24
Ein Hörspiel als DVD-Audio heraus zu bringen, ist auch heute nicht unbedingt üblich. Doch genau dies taten der MDR und RB bei ihrer Produktion der Jules Verne Klassikers „20.000 Meilen unter den Meeren“ bereits im Jahre 2003. Inzwischen ist dieses nicht mehr solo erhältlich, sondern nur noch als Teil der vertonte Verne-Trilogie „Phantastische Reisen“ im |Hörbuchverlag|. Dieses CD-Pack enthält zum fraglichen Titel zusätzlich auch noch „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ und „In 80 Tagen um die Welt“. Natürlich bleibt weiterhin der einschlägige Gebrauchtmarkt, um an den einzelnen, und überdies recht raren, 5.1 Surround DVD-Silberling mit erweiterter Laufzeit zu gelangen. Es dürfte wohl kaum jemanden geben, der die Story nicht kennt. Oder doch? Ok, hier dann noch mal eine kleine Gedächtnisauffrischung:
_Zur Story_
Wir schreiben das Jahr 1866, genauer gesagt den 20. Juli 1866, als diese Geschichte beginnt. Seit geraumer Zeit macht ein seltsames Objekt von stattlichen Abmaßen die Schiffswege unsicher. Es wird allgemein angenommen, dass es sich um ein Seeungeheuer handelt und ein sehr schnelles noch dazu – es kann mehrere hundert Seemeilen scheinbar mühelos am Tag zurücklegen. Manche Überlebende der Attacken berichten auch von phosphoreszierenden Augen, was die Theorien, dass es sich lediglich um einen selten großen Narwal handelt nicht gerade stützt. Ebenso wenig, wie die Löcher, die dieses Objekt selbst in stählerne Schiffsrümpfe zu reißen vermag.
Der Pariser Meeresbiologe Professor Pierre Aronnax erhält in New York ein Jahr später – 1867 – das Angebot sich mit der Fregatte „Abraham Lincoln“ einzuschiffen und auf die Jagd nach dem mysteriösen Phänomen zu gehen. Das „Ungeheuer“ interessiert ihn aus wissenschaftlicher Sicht brennend. Tatsächlich stoßen sie nach wochenlanger, ergebnisloser Fahrt auch auf das geheimnisvolle Objekt, dass sie zunächst nur umkreist und seine Spielchen mit ihnen zu treiben scheint. Bis Kapitän Farragut es mit der Bordkanone unter Beschuss nimmt. Zwecklos – Die Kanonenkugel richtet keinen Schaden an. Auch die Harpune des kanadischen Meister-Harpuniers Ned Land zeigt keinerlei Wirkung, außer, dass es das vermeintliche Ungeheuer wohl soweit reizt, dass es zum Angriff übergeht und das Schiff rammt.
Professor Aronnax wird bei dem heftigen Stoß über Bord geschleudert, ihm hinterher springt sein treuer Diener Conseil. Freiwillig. Wassertretend müssen die beiden mit ansehen, wie sich die beschädigte Fregatte rasch von ihnen entfernt. Ned Land ist ebenfalls von Bord gefallen und fischt die beiden – wundersamerweise aufrecht stehend – aus dem Wasser. Bestürzt müssen sie feststellen, dass sie sich auf dem stählernen Rücken des Ungeheuers befinden, dass, wie ihnen nun schnell klar wird, eigentlich ein von Menschenhand erschaffenes Unterwasserschiff ist. Das schickt sich zudem gerade an abzutauchen. Ihre Hilferufe werden erhört und das bringt sie in die Hände des seltsamen Kapitän Nemo, auf dessen „Nautilus“ sie eine Reise in Gefangenschaft antreten, die 20.000 (französische) Meilen betragen wird… unter den Meeren.
_Eindrücke_
Die Story ist naiv aber zugleich auch sehr visionär. Als sie geschrieben wurde tickten die Uhren noch ganz anders und vieles von dem, was Verne schreibt, war zu dieser Zeit pure Zukunftsmusik und im wahrsten Sinne des Wortes Science Fiction. Es ist jedoch faszinierend, wie viel sich davon später aber als zutreffend herausstellen sollte – vor allem in technischer Hinsicht. Anderes hingegen erweist sich heute als überholt und falsch bzw. physikalisch nicht zutreffend. Doch vieles konnte er mit dem damaligen Kenntnisstand nicht wissen, sondern nur vermuten. Weniger fiktiv ist seine Gesellschaftskritik an der Menschheit selbst, auch hier beweist Verne sehr viel Voraussicht, denn bis in die Jetztzeit hat sich was das angeht nichts wirklich gravierend verändert.
Die Kernaussage: Macht korrumpiert und jedwede Technik kann zur Waffe pervertiert werden – unabhängig davon, welche (wenn auch eigentlich hehre) Motive und Ziele dahinter stecken. Gerade bei Nemo ist der Grat zwischen Genie und Wahnsinn extrem schmal, der selbst ernannte Racheengel hat nicht realisiert, dass er seinen damaligen Peinigern in seinen despotischen Methoden ähnlicher ist, als er es wahrhaben will. Dass Gewalt stets Gegengewalt erzeugt ist ihm in diesem Zusammenhang ebenfalls irgendwie entfallen. Eine Binsenweisheit, die damals wie heute uneingeschränkt gilt – und das bereits seit Menschengedenken.
Nach unseren heutigen Standards fällt die Charakterzeichnung sehr stereotyp und schablonenhaft aus, Verne legte wesentlich mehr Wert auf die Beschreibung der phantastischen Unterwasserwelt und die Technik der ‚Nautilus‘, als der detaillierten Ausarbeitung seiner Figuren. Zum Glück hat man diese ausufernden Ergüsse im Hörspiel weitgehend glatt gebügelt, ohne jedoch das alte, faszinierende Flair zu zerstören. Auch die aus heutiger Sicht unzutreffenden, wissenschaftlichen Halbwahrheiten und Spekulationen Vernes blieben unangetastet, sein unvergleichlicher Stil, sowie seine darin enthaltene Message, sind klar erkennbar geblieben, wenn auch an einigen Stellen gestrafft. Insbesondere dort, wo einige der Inkonsistenzen oder Kanten am Original vorsichtig abgeschliffen wurden.
Die Umsetzung des MDR kann sich also mehr als hören lassen, das gilt im Besonderen für die um 30 Minuten längere Version in DD 5.1 Mehrkanalton, welche die zuvor im Handel befindliche Doppel CD/MC-Variante in Stereo zwar nicht komplett ablöst, jedoch ergänzt. Beide Fassungen finden sich auf der DVD als getrennt anwählbare Hörspiele und gliedern sich jeweils in zwei Teile. Als Bonbon können bei der DVD zusätzlich die Original-Illustrationen von Edouard Riou und Alphonse de Neuville der französischen Erstausgabe auf dem Bildschirm dargestellt werden. Insgesamt sind es 110 Bilder, die wie bei einer Diashow jeweils passend zum Gehörten auf dem Bildschirm eingeblendet werden.
Wahlweise liegen die Bilder aber auch bequem im DVD-ROM Part vor, sodass man sie sich auch losgelöst vom Rest einzeln – mittels Windows Explorer/ Mac Finder oder auch jedem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm – auf dem Computer anschauen kann. Apropos DVD-ROM: Das komplette Drehbuch/Manuskript, sowie ein Produktionstagebuch und ein Essay über Jules Verne hat man im Adobe PDF-Format ebenfalls mit drauf gepresst. Das Essay kann man sich als Lesefauler aber auch über die DVD-Features im Bonusmaterial geben, dieser 25 Minuten-Text wird da nämlich komplett vorgelesen.
Das restliche Bonusmaterial ist im Übrigen ziemlich karg, eine kleines Making Of und einige wenige Bilder aus dem Studio – mehr nicht. Es gefällt aber vor allem das vollständige Manuskript ausgesprochen gut, einige Sachen hätte der ewig nörgenlde Rezensent beispielsweise anders betont, als es die Sprecher tun. Schön, wenn man mal die seltene Gelegenheit eines Vergleichs hat, zwischen der Rohfassung und dem fertigen Hörspiel. Dieses Beispiel sollte unbedingt Schule machen. Damit wären wir über Umwege beim wichtigen Thema Sprecher angelangt.
Viele Sprechrollen gibt es ja nun nicht zu besetzen, man griff beim MDR auf gestandene Mimen zurück, die bereits eine lange Karriere sowohl beim öffentlich-rechtlichen, als auch beim privaten TV, oder Bühnenerfahrung beim Theater respektive als Synchronstimmen vorzuweisen haben. Eine kurze Biographie aller 4 Hauptsprecher ist im Bonusmaterial abrufbar, weswegen man darauf verzichten kann, hier eine ellenlange Liste herunter zu leiern. Urgestein Ernst Jacobi als Kapitän Nemo gefällt mir nicht ganz so gut, was nicht an seiner Leistung, als vielmehr an seiner – nach meinem Empfinden – zu hohen und leicht heiseren Stimme liegt.
Nemo sollte, so der subjektive Eindruck, gerne etwas volltönender und barscher klingen. Als Synchronstimme ist der ältliche Herr aus vielen Filmen positiv in Erinnerung, doch passt diese Figur nicht zu ihm. Vielleicht wäre es angebrachter gewesen mit Gottfried John zu tauschen, der größtenteils in der Ich-Form in Gestalt Professor Aronnax die Geschichte souverän erzählt und natürlich auch dessen Dialoge übernimmt. Sein Diener Conseil (Hermann Lause) und Ned Land (Peter Gavajda) sind vorzüglich getroffen, vor allem letzterer mit seinem tiefen, polterigen Organ kann in der Rolle des rebellischen Harpuniers vollends überzeugen.
Die Geräuschkulisse lebt in der Hauptsache vom wohldosierten Surround, der das Geschehen auch räumlich darstellt, die Effekte sind ansonsten aber eher dezent und nicht überzogen. Auch die spärliche musikalische Untermalung ordnet sich der Dialoglastigkeit unter, es sei denn natürlich Nemo greift in die Tasten seiner Orgel. Die Soundtechniker haben sich eine Menge einfallen lassen, um realistisch zu bleiben und den Bogen nicht zu überspannen, trotz des filigranen Hintergrundsounds, der ständig zu hören ist. Knalleffekte gibt es wenige, es geht recht beschaulich zu.
Einen Fauxpas hat man sich aber dennoch geleistet, obschon das ein Fehler der Regie ist: Der (sinngemäß korrekt dem Roman entnommene) Dialog am Ende des ersten Teils des Hörspiels zwischen Aronnax und Nemo, nachdem man ein Besatzungsmitglied der Nautilus auf dem Meeresgrund bestattet hat, findet hier an dessen Grab statt (Im Roman erst zurück an Bord der Nautilus), wie man an den Atemgeräuschen der Lungenautomaten der Taucheranzüge eindeutig hören kann, doch sind diese |nicht| mit Sprechgeräten ausgestattet. Ansonsten verständigt man sich durchweg auf allen Exkursionen außerhalb des Schiffes nämlich höchst umständlich mit Handzeichen und Gesten – auch hier im Hörspiel, mit Ausnahme dieses einen Dialogs.
_Die Produktion_
Originaltitel: „Vingt Mille Lieues sous les Mers“
Nach dem Roman von Jules Verne
basierend auf einer anonymen, deutschen Erstübersetzung von 1875
Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk und Radio Bremen
DVD-Version: 2003 – Der Hörverlag / MDR
Tonformat: wahlweise DD 5.1 oder Stereo*
Bildformat: 4:3 (1:1,33) / Bild- und Videoteil
ISBN: 3-89940-286-3
|Bonusmaterial|
– 110 Illustrationen, plus Bilder von der Produktion
– Making Of Video-Sequenz
– Biografien und Essay über Jules Verne
– DVD-ROM Teil mit Manuskripten und Produktionsnotizen
_Fazit_
Die DVD ist ein gelungenes Beispiel, wie Mehrkanalton ein Hörspiel durch Räumlichkeit aufwerten kann und man buchstäblich in andere Klangwelten abtaucht. Im Gegensatz zur ebenfalls als Dreingabe enthaltenen Stereo-Version eine deutliche Verbesserung in der Atmosphäre dieses Meilensteins. Die Umsetzung hält sich streckenweise wortwörtlich an die Vorlage und verschweigt nur Nebenhandlungen und Details von eher geringem Interesse. Klar ist der Roman im Zweifelsfalle immer vorzuziehen, doch die MDR-Produktion ist schon verdammt nah dran. Näher als jedes andere Hörspiel oder die Verfilmung von Walt Disney aus dem Jahre 1954, dessen unvergessliches ‚Nautilus‘-Design das Cover ziert. Hätte man doch nur Nemos Stimme etwas besser ausgewählt, wäre es eine nahezu perfekte Umsetzung.
|DVD mit Laufzeit: 178 Minuten (Mehrkanal-) bzw. 141 Minuten (Stereo-Fassung)|
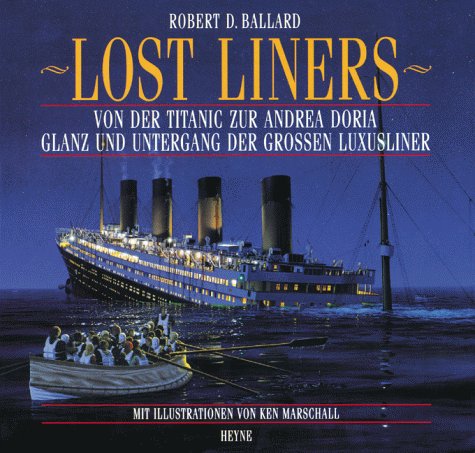
Auf kein anderes Verkehrsmittel trifft dieses Zitat mehr zu als auf Transatlantik-Schiffe, denn ihre Zeit ist längst vorbei, dank des Aufkommens der Fliegerei sind diese Ozeanriesen immer mehr in den Hintergrund gedrängt und schließlich komplett obsolet geworden. Doch auch während ihrer Hochzeit war nicht immer alles zum Besten bestellt und spätestens seit dem Untergang der Titanic hat die Technikgläubigkeit der Menschheit einen schweren Schlag erlitten. Seereisen sind gefährlich, die Natur lässt sich selbst mit der ausgeklügelsten Technik nicht überlisten und allzu oft waren Schiffskatastrophen auch durch schlichtes menschliches Versagen gekennzeichnet. Ballard, Archbold und Marschall beleuchten in diesem Band die Geschichte der Passagier-Seefahrt und führen den Leser zu ausgewählten Wracks der einst stolzen und erhabenen Ozeanriesen – gemäß dem Untertitel: „Von der Titanic zur Andrea Doria – Glanz und Untergang der großen Luxusliner“
Robert D. Ballard / Rick Archbold / Ken Marschall – Lost Liners weiterlesen

Corpus Delicti