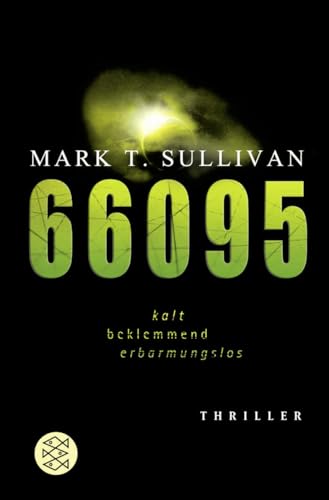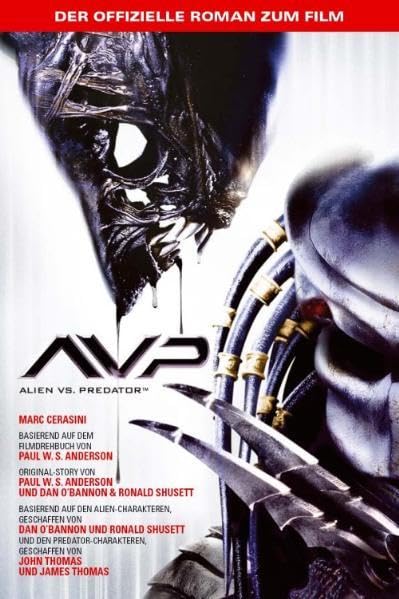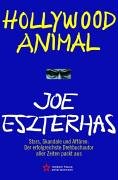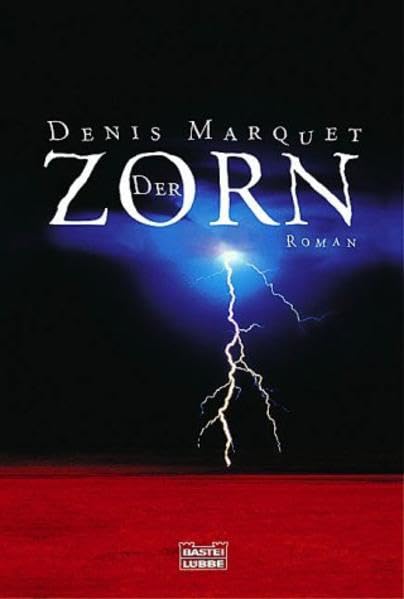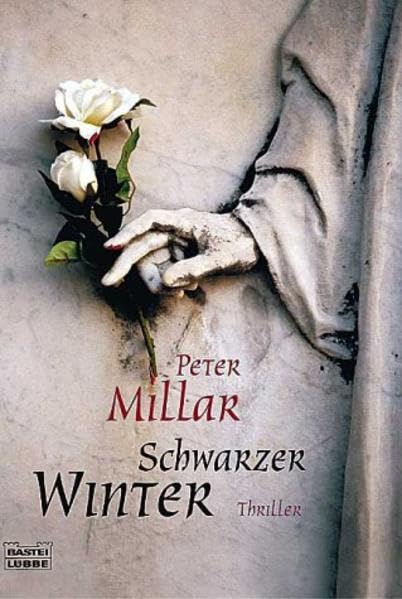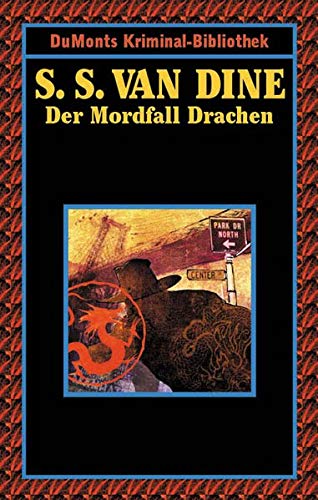
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Richard Dalby (Hg.) – Geister zum Fest. Weihnachtliche Gruselgeschichten

Richard Dalby (Hg.) – Geister zum Fest. Weihnachtliche Gruselgeschichten weiterlesen
Neal Asher – Der Erbe Dschainas
Die „Polis“ nennt man jenen Teil der Galaxis, der von den Menschen und ihren Abkömmlingen, Verbündeten und Feinden besiedelt wird. Das Sagen haben die KIs, künstliche Intelligenzen, deren Einheiten über die gesamte Polis verteilt sind und mit der Zentrale in Verbindung stehen. In dieser gewaltigen Sphäre begehren immer wieder feindliche Mächte auf. Vor gar nicht langer Zeit machte sich über dem Planeten Samarkand der „Drache“ bemerkbar – ein außerirdisches Biokonstrukt der legendären, längst ausgestorbenen „Erschaffer“, das unter hohen Verlusten nur scheinbar besiegt werden und fliehen konnte. Deshalb fragt sich Earth Central Security, die Sicherheitseinheit der Polis, ob der Drache hinter den mysteriösen Ereignissen steckt, die zur Zerstörung der Raumstation „Miranda“ geführt haben.
Das Schlachtschiff „Occam Razor“ wird in Gang gesetzt. An Bord befinden sich die Agenten Cormac und Gant sowie „Narbengesicht“, eine Kreatur Draches, deren Loyalität höchst ungewiss ist. Zunächst an anderer Stelle der Galaxis jagt Cormacs alter Kampfgefährte Thorn den kriminellen Naturwissenschaftler Skellar. Dieser ist durch einen Zufall in den Besitz von Hightech der der ausgestorbenen Dschaina gelangt. Sie lassen den skrupellosen Skellar zu einem Gegner werden, dem kaum beizukommen ist. Da sich der Forscher an Cormac rächen und außerdem ein Kampfschiff an sich bringen will, überfällt er die „Occam Razor“. Ein Segment Draches rettet die wieder vereinten Kampfgefährten. Neal Asher – Der Erbe Dschainas weiterlesen
Robert A. Heinlein – Reiseziel: Mond

Robert A. Heinlein – Reiseziel: Mond weiterlesen
Mark T. Sullivan – 66095
Während einer der letzten Mondlandungen wurde 1972 gefunden der Steinbrocken mit der Probennummer „66095“ geborgen. Er sendet mysteriöse Strahlen aus, wenn man ihn mit Energie ‚füttert‘. Für Menschenhirne sind sie nicht bekömmlich, da sie Depression und Mordlust fördern. Dies bleibt lange unbemerkt, denn 66095 versauert viele Jahrzehnte in einem Laborarchiv. Dann experimentiert der Forschungsassistent Robert Gregor damit herum, bis er gollumartig dem fatalen Zauber des Steins erliegt und zum mondsüchtig verrückten Mörder mutiert.
Szenenwechsel: Die USA planen ihre Rückkehr auf den Mond. Dort werden supraleitende Erze vermutet, aus denen sich Energie gewinnen lässt. Als ideales Training für angehende Luna-Bergleute empfiehlt die NASA aus logisch recht unerfindlichen, für die Dramaturgie dieses Buch jedoch unverzichtbaren Gründen einen unterirdischen Marsch durch die Labyrinth-Höhlen im US-Staat Kentucky. Mark T. Sullivan – 66095 weiterlesen
Marc Cerasini – AVP: Alien vs. Predator
Der unermessliche reiche, mächtige und undurchsichtige Industriemagnat Charles Bishop Weyland heuert die besten Archäologen, Historiker und Naturwissenschaftler an. Er will mit ihnen eine mysteriöse Pyramide erkunden, die im Eis der Antarktis zum Vorschein gekommen ist und offenbar vor Jahrtausenden von einer völlig unbekannten Kultur errichtet wurde. Die Zeugen dieser Urzeitzivilisation finden die Forscher im Untergrund als Skelette und Mumien, deren Ende sichtlich nicht friedlich war. Diese Sensation wird überboten, als Weyland und seine Begleiter die versteinerten Überreste einer außerirdischen Kreatur entdecken.
Leider stellt sich rasch heraus, dass diese keineswegs tot ist, sondern nur in einer Art Winterstarre auf neue Opfer gewartet hat. Die insektenhafte Alienkönigin beginnt sogleich mit dem Legen neuer Eier. Daraus schlüpfen gruselige Winzmonster, die sich in Windeseile in gepanzerte Riesenkiller verwandeln, in deren Adern ätzende Säure kreist. Die Neuankömmlinge werden als willkommene Beute in Empfang genommen. Marc Cerasini – AVP: Alien vs. Predator weiterlesen
Eszterhas, Joe – Hollywood Animal
Joe Eszterhas war ein „Hollywood Animal“ – ein Platzhirsch in der Stadt der Filme, deren Einwohner 24 Stunden täglich damit beschäftigt sind, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen. Lügen und betrügen, einander mit offenen Armen empfangen, den Dolch für den Stoß in den Rücken stets griffbereit, fixiert auf den Dollar, getrieben von Ruhmsucht, umschwärmt von schönen (und willigen) Frauen, den Medien, von Speichelleckern und falschen Freunden: eine (Alb-)Traumwelt, in der sich Eszterhas ein Vierteljahrhundert pudelwohl fühlte. Kein Wunder, war er doch der wohl erfolgreichste Autor aller Zeiten: Dreißig Drehbücher hat er verfasst, von denen 15 verfilmt wurden. Darunter waren Blockbuster wie „Flashdance“, „Das Messer“ und natürlich „Basic Instinct“, aber auch nicht minder berüchtigte Flops wie „Showgirls“ oder „Jade“.
An die Spitze hat sich Eszterhas durch eine typische Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Karriere gekämpft, wie sie die US-Amerikaner so lieben, weil es ihnen die Existenz in einem Land der Chancengleichheit suggeriert. Geboren wurde Eszterhas 1943 in Ungarn in den Wirren des II. Weltkriegs. Vertreibung und Flucht, elende Jahre in diversen Lagern folgten, dann die Emigration und nicht minder schwere Anfangsjahre in den Vereinigten Staaten, die sich nicht unbedingt von ihrer freundlichen Seite zeigten. Das Ergebnis: ein junger Mann aus Cleveland, der raucht wie ein Schlot, säuft wie ein Loch, nach Anerkennung giert und gelernt hat sich „durchzubeißen“ – ohne Rücksicht auf Verluste.
Nach einem mehrjährigen Zwischenspiel als Reporter des „Rolling Stone“-Magazins landet Eszterhas 1974 in Hollywood, wo er – noch völlig unbedarft – beim Verfassen des Drehbuchs zum Sylvester-Stallone-Vehikel „F.I.S.T. – Ein Mann geht seinen Weg“ einen Crashkurs in Sachen Hollywood-Falschheit durchläuft. Eszterhas lernt schnell – das Drehbuch-Schreiben und das Intrigieren. Immer höher steigt er auf, der als Autor eigentlich das soziale Schlusslicht der Hollywood-Society bildet, kassiert Millionengagen, wird selbst ein Medienstar, hofiert von den Großen und Mächtigen der Stadt, die sich seiner Dienste versichern wollen.
Parallel zum wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg wird Eszterhas von Hollywood „infiziert“. Er verliert jegliches Maß, jede Rücksicht, legt sich mit Gott & der Welt an, weil er es kann und damit durchkommt. Spektakuläre Misserfolge im Kino läuten seinen Sturz ein; seine langjährige Ehe scheitert, er erkrankt an Kehlkopfkrebs. Das 21. Jahrhundert erlebt einen völlig gewandelten Joe Eszterhas, der aus Hollywood geflohen ist und sich vom Saulus zum Paulus wandelte; eine Genese, die er nur für die Niederschrift dieser Lebenserinnerungen unterbrochen hat …
Ach ja, er war schon ein genialer, beinharter Macho-Kotzbrocken; voll uneingestandener Wehmut und Stolz lässt es uns Joe Eszterhas wissen. Er hat zweifellos ein buntes Leben geführt, viel erlebt, noch mehr erduldet. Das haben andere Menschen zwar auch, aber die waren halt nicht in Hollywood tätig. Die Filmstadt und ihre Bewohner faszinieren noch immer ihr Publikum in der ganzen Welt. Objektiv betrachtet gibt es dafür wenige Gründe, aber in Hollywood werden seit jeher Träume fabriziert, was denjenigen, die diesem Job nachgehen, ein Höchstmaß an kollektiver Aufmerksamkeit garantiert.
Ohne diesen Bonus würde uns „Hollywood Animal“ wohl kaum über eine Distanz von 900 Seiten fesseln. Es gibt interessantere und auch angenehmere Zeitgenossen als Joe Eszterhas. Den wilden Mann markiert er noch immer ein wenig zu offensichtlich, als dass man ihm – „weise“ und sogar „fromm“ geworden – seine „Läuterung“ glauben möchte. Da gibt es augenscheinlich mehr als eine Rechnung, die offen geblieben ist, nachdem Eszterhas Tinseltown verlassen hat.
Autobiografien sind niemals objektiv, denn Objektivität gegenüber dem eigenen Leben liegt nicht in der Natur des Menschen. Eszterhas gibt genau das über weite Strecken vor, geißelt sich als Egoist, Ehebrecher, undankbarer Sohn, Verräter usw. usf. Das führt er sehr richtig auf seine schwierige Kindheit und Jugend zurück und deutet es außerdem als Reaktion auf die fragwürdigen Methoden, die im Hollywood-Business an der Tagesordnung sind.
In diesen Punkten kann „Hollywood Animal“ unbedingt fesseln. Nicht einmal die Tatsache, dass Eszterhas deutlich zu episch in seinen Clevelander Jugendjahren schwelgt, schmälert dies. Der Mann kann schreiben, wenn er denn will bzw. sich selbst diszipliniert: „Hollywood Animal“ ist nämlich als Buch an sich recht gewöhnungsbedürftig für den Leser. Eszterhas scheint es mit der wilden Energie in die Tasten seiner alten mechanischen Schreibmaschine gehauen zu haben wie seine Drehbücher, denen es in weiten Passagen auffällig gleicht. Kontinuierliches oder chronologisches Erzählen ist Eszterhas’ Sache nicht. Er bricht – für ihn selbstverständlich – mit entsprechenden Konventionen. „Hollywood Animal“ bietet ein komplex gedachtes, tatsächlich aber vor allem kompliziertes Nebeneinander von Vergangenheit/en und Gegenwart. Eszterhas springt zwischen Zeiten und Ereignissen, splittert sein Leben auf in die wilde Konfusion, als welche er es verstanden wissen möchte. Manche „Unterkapitel“ umfassen nur wenige Zeilen. Ein roter Faden wird lange nur ansatzweise oder gar nicht sichtbar.
Der Mann hat Ehrgeiz; vielleicht vermisst er das Verfassen von Drehbüchern auch mehr als er sich selbst eingestehen mag. Verstehen wir uns nicht falsch: Eszterhas versteht sein Handwerk. Sein Werk liest sich deutlich flüssiger als manche „Autobiografie“, die ihren Weg in die Buchläden findet statt echten Pferdemist als Blumendünger zu ersetzen. Auch an das „künstlerische“ Durcheinander gewöhnt man sich.
Was hingegen erheblich stört, ist Eszterhas’ Neigung zu scheinbar „saftigem“ Klatsch. Am „Basic Instinct“-Skandal klammert er sich beispielsweise förmlich fest. Nur war der vor allem ein Medienprodukt, dessen Schockwirkung primär auf die prüden USA beschränkt blieb. Vor allem liegt das Geschehen mehr als ein Jahrzehnt zurück. Wer interessiert sich heutzutage noch so exzessiv für „Basic Instinct“ – oder für Sharon Stone (die ihrem Drehbuchautoren eine Liebesnacht gewährte, was dieser allen Ernstes zu einem zentralen Kapitel seiner Biografie aufschäumt), wie Eszterhas dies offensichtlich glaubt?
Wie man es viel besser macht, beweist der Autor mit der präzisen Chronologie seiner Auseinandersetzung mit dem Agenten Michael Ovitz, die in die Hollywood-Geschichte eingegangen ist – und das mit Recht, denn hier wurden dank Eszterhas, der dafür allerhand Federn lassen musste, wahrhaft beängstigende, quasi mafiöse Strukturen offen gelegt. So etwas ist allemal spannender als die pseudo-schockierenden Schmuddel-Histörchen, mit denen Eszterhas das uralte Klischee von Hollywood-Babylon bedient. Ähnlich fesselnd wird der Schock des Verfassers geschildert, der seinen Vater nach und nach als Kriegsverbrecher enthüllt sehen muss.
Wie es sich gehört für ein Hollywood-Drehbuch, schreibt sich Eszterhas einen Neuanfang nach großer Katharsis auf den Leib. Aus dem „Hollywood Animal“ wurde ein treu sorgender Ehemann und Familienvater. Bis es so weit war, erlegte das Schicksal selbst Joe Eszterhas eine Reihe gewaltiger Prüfungen auf. So muss es gewesen sein, denn wie konnte dieser große Mann sonst so tief fallen? Darüber grübelt er selbst anscheinend immer noch nach – und dies ist seine Interpretation der Ereignisse.
Auf Abbildungen verzichtet Eszterhas vollständig. Man vermisst sie auch nicht; was außer den üblichen Starporträts und nichts sagenden Familienschnappschüssen könnten sie auch bieten? Dass Eszterhas noch immer „heiß“ ist, bezeugt die Geschwindigkeit, mit der seine Lebenserinnerungen auch ins Deutsche übertragen wurden: Gleich drei Übersetzungen bemühten sich, „Hollywood Animal“ hierzulande möglichst zeitgleich mit der amerikanischen Ausgabe erscheinen zu lassen. Sie haben ihren Job gut erledigt, wobei ihnen Eszterhas selbst mit seiner Vorliebe für kurze, prägnante Sätze entgegen gekommen sein mag. Auf jeden Fall liest sich dieses wahrlich seitenstarke Buch die meiste Zeit sehr flüssig. Im letzten Viertel nehmen allerdings die Längen zu. Wieso fand Eszterhas es notwendig, Tagebucheintragungen seiner geliebten Neufrau Naomi geradezu exzessiv zu zitieren? Einmal mehr zeigt sich, dass eine Beziehung vor allem bzw. fast ausschließlich für jene lebenswichtig ist, die sie führen – Außenstehende können damit nur wenig anfangen, zumal auch Joe & Naomi nichts wirklich Neues zum uralten Tanz der Gefühle beizutragen haben.
Der durch Krankheit & Lebensweisheit geläuterte Joe Eszterhas ist zudem nicht wirklich ein neuer Mensch. Mit derselben Intensität, mit der er früher „gesündigt“ hat, zieht er jetzt gegen Unmoral & Suchtverhalten zu Felde. Heuchlerisch mokiert er sich über die Unwilligkeit der Welt, sich belehren und bekehren zu lassen – dabei ist dies exakt die Reaktion, die er selbst früher an den Tag gelegt hat. So liest man das letzte Kapitel von „Hollywood Animal“ lieber nicht allzu intensiv, sondern überfliegt es, was den überwiegend positiven Eindruck dieser Rock’n’Roll-Autobiografie nicht mehr allzu stark beeinträchtigen kann.
Sarah Murgatroyd – Im Land der grünen Ameisen
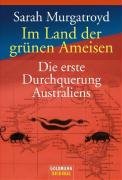
Sarah Murgatroyd – Im Land der grünen Ameisen weiterlesen
Aron Boone – Kannibalen!
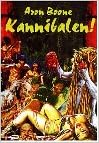
Masterton, Graham – Manitou, Der
_Das geschieht:_
Klein aber fein ist das Privatkrankenhaus „Schwestern von Jerusalem“ in New York City. Die folglich gut situierte, noch sehr junge Karen Tandy kann sich daher mit Recht vertrauensvoll an Dr. Hughes wenden, gilt er doch als Koryphäe seines Metiers. Besonders als Fachmann für Tumorerkrankungen hat er sich einen guten Namen gemacht. Trotzdem ist er erschrocken, denn im Nacken seiner Patientin wuchert eine Schwellung, die nicht im Lehrbuch findet. Der ‚Tumor‘ ist eine Art Embryo, der sich im Zeitraffertempo entwickelt und seine Wirtin schon bald auch geistig unterjocht.
An einem weniger eleganten Ort der Stadt fristet Harry Erskine, der alten Damen die Zukunft aus den Karten liest und dabei den echten Kontakt zum Reich der Geister durch Fantasie und Erfindungsreichtum ersetzt, sein bescheidenes aber zufriedenes Dasein. Dann kommt der Tag, an dem ihn die Nichte einer alten Stammkundin aufsucht: Karen Tandy, die nicht nur unter besagtem Tumor, sondern auch unter seltsamen Träumen leidet.
Harry verliebt sich ein wenig in seine Besucherin. Er bemüht eine alte Freundin, die über echte parapsychische Fähigkeiten verfügt. Bei einer Seance taucht der Geist eines Indianers auf, dessen Attacken die Anwesenden nur mit knapper Not entkommen. Kurz darauf ist Karens Tumor fast so groß wie der Körper seiner Wirtin geworden. In dieser Situation ist Dr. Hughes geneigt Harry Gehör zu schenken, der die bevorstehende Wiedergeburt eines indianischen Rachegeistes ankündigt.
Ein Fachmann muss her! Medizinmann Singing Rain (der eigentlich im Immobiliengeschäft tätig ist) erkennt den Gegner: Misquamacus ist der vielleicht mächtigste Zauberer seines Volkes, der mit dem Weißen Mann noch eine Rechnung offen hat, seit ihn holländische Siedler Mitte des 17. Jahrhunderts in den Tod getrieben haben. Nun ist Misquamacus wieder da – orientierungslos und wie immer äußerst schlecht gelaunt. Es stimmt ihn nicht versöhnlicher, dass verschwenderisch eingesetzte Röntgenstrahlen seinen neuen Körper schwer geschädigt haben. Der erzürnte Geist setzt seinen Zauber ein, um sich zu rächen …
_Eiliger Horror mit trivialem Charme_
Graham Masterton ist nicht nur ein sehr fleißiger, sondern auch ein in seiner amerikanischen Heimat (eigentlich ist er Schotte) recht populärer Autor moderner Horrorgeschichten. In Deutschland ist ihm der Durchbruch dagegen seltsamerweise nie wirklich gelungen. Nur ein Bruchteil seiner phantastischen Romane und Thriller, ganz zu schweigen von seinen historischen Werken (oder den berühmt-berüchtigten Sex-Leitfäden) haben den Weg über den Großen Teich gefunden, wo sie sich unter denen, die das Phantastische lieben, zu begehrten Sammelobjekten entwickelt haben.
„Der Manitou“ markiert Mastertons Debüt als Autor, was zu berücksichtigen ist, wenn man diesen Roman beurteilen möchte – dies und das Wissen, dass Masterton ihn 1974 binnen einer einzigen Woche niederschrieb. Das erklärt eine Menge; die anspruchslose Handlung oder die schlichte Figurenzeichnung beispielsweise. Auf der anderen Seite verspricht Masterton nie mehr als er zu halten bereit ist: Horror der handfesten Art! „Der Manitou“ ist schnell, durchaus witzig und gespickt mit drastischen Effekten. Auf kaum mehr als 170 Seiten wird die Story ohne Pausen vorangetrieben.
|Geist mit schlechtem Planungsstand|
Probleme gibt es immer dort, wo Masterton einhält, um der Handlung Tiefe zu verleihen. Er bildet sich offensichtlich viel ein auf sein Wissen um die indianische Kultur und Mythologie, kommt aber trotzdem niemals über die peinlichen Roter Mann = Guter Mann-Plattitüden hinweg, die als politisch korrekt gelten.
Zwar angesprochen aber nie wirklich beantwortet wird außerdem die Frage, wieso der angeblich so schlaue Misquamacus eigentlich volle dreieinhalb Jahrhunderte übersprungen hat, um ausgerechnet in der Welt des ausgehenden 20. Jahrhunderts aufzutauchen. Wäre es nicht ein Zeichen echter Intelligenz gewesen schon nach fünf oder zehn Jahren zurückzukehren? Für einen Geist, der außerhalb der Gesetze von Raum und Zeit steht, legt Misquamacus ein bemerkenswert schlechtes Gefühl für Timing an den Tag. Da hat es schon etwas rührend Hilfloses, die magische Eroberung der Welt ausgerechnet in einem Krankenhaus zu starten … Aber natürlich sollte man über Sinn & Unsinn solcher für den raschen Konsum bestimmten Unterhaltungsliteratur lieber nicht intensiver nachdenken.
|Ein Medizinmann spukt im Kino|
„Der Manitou“ erschien zwar zunächst in Großbritannien, war aber später auch in den USA überraschend erfolgreich. Bald wurde Hollywood bei Masterton vorstellig, doch dies leider nur in der Gestalt des jungen William Girdler, dessen Filmografie bis dato nur Sch(l)ock-Klassiker wie „Asylum of Satan“ (1972) oder „Three on a Meathook“ (1973) auflistete. Aber Masterton liebt das Abwegige, und so stand Misquamacus= Zelluloid-Zauberschlacht nichts mehr im Wege. „Manitou“, der Film von 1978, ist mit Tony Curtis (!), Stella Stevens, Ann Sothern und Burgess Meredith erstaunlich gut besetzt. Ganz offensichtlich wandelt „Der Manitou“ hier auf den Spuren der „Exorzisten“ und „Omen“-Reihen, die Mitte der 1970er Jahre Geldfluten in die Kinokassen spülten.
Es lässt sich allerdings nicht leugnen, dass sich die genannten Darsteller 1978 gerade in einem Karrieretief befanden, welches in den meisten Fällen andauerte: War das der Fluch des Manitou? Die ohnehin schlichte Story wurde durch kein geniales Drehbuch geadelt (um es höflich auszudrücken), und Girdler ist nicht Orson Welles (und sollte es auch niemals werden; nachdem „Der Manitou“ ein bescheidener Erfolg geworden war, recherchierte Girdler 1978 auf den Philippinen für seinen ersten Big Budget-Hollywood-Film – und stürzte prompt mit dem Hubschrauber ab; ein neues Opfer des Misquamacus?).
So blieben wie so oft im phantastischen Film nur die Spezialeffekte, die dem Streifen Kontur verliehen. Sie sind ordentlich, können aber aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr überzeugen. „Der Manitou“ erfreut sich in Amerika trotzdem noch eines gewissen Rufes, weil er den dauerpubertierenden US-Boys den erregenden Anblick blanker Busen in einem ‚richtigen‘ Spielfilm beschert.
|Misquamacus geht in Serie|
In Deutschland war des Manitous Wiedergeburt auf der Kinoleinwand immerhin Anlass genug, mit Misquamacus die 1978 ebenfalls im Zeichen der phantastischen Renaissance ins Leben gerufene „Horror-Bibliothek“ des Bastei-Lübbe-Verlages prominent einzuleiten. Heute dürfen sich die wohl nicht gerade zahlreichen Besitzer dieses Bändchens glücklich schätzen – über ein hübsches Sammlerstück und die wehmütige Erinnerung an eine Zeit, da jeder deutsche Taschenbuch-Verlag mindestens einen einschlägigen Titel pro Monat auf den Markt brachte.
Misquamacus ließ der unverhoffte Erfolg seines ersten Auftretens übrigens nie lange im Geisterreich verweilen. Schon 1979 war er wieder da; die Chronik seiner neuen Untaten trug hierzulande den sinnigen Titel „Die Rückkehr des Manitou“ und signalisierte schon dadurch, dass dieser seit dem letzten Mal wenig dazugelernt hatte.
|Deutschland bleibt Manitou-Diaspora|
Leider können wir Freunde des Unheimlichen uns in Deutschland davon nur sporadisch überzeugen; wenige Masterton-Romane fanden und finden den Weg in dieses unser Land. Dabei gilt z. B. Misquamacus dritter Streich („Burial: A Novel of the Manitou“, 1992) als bester Teil der Serie, zumal der Verfasser hier seine Leser mit einem Kniff zu fesseln weiß, den er zu einem persönlichen Markenzeichen entwickelt hat: der Verknüpfung einer fiktiven Handlung mit realen historischen Ereignissen, hier der Schlacht am Little Big Horn, an deren Verlauf Misquamacus nicht ganz unbeteiligt war.
Dass Masterton seinen ersten Anti-Helden nicht vergessen hat, bewies er 2005, als er Misquamacus nach 13-jähriger Pause überraschend zurückkehren ließ: Weiterhin ist der Manitou nicht zimperlich ist, wenn es gilt, seinen altbekannten Zielen böse Taten folgen zu lassen, und immer noch folgt auf jede Niederlage eine Wiederkehr. Auf diese Weise kann Misquamacus noch lange sein (lukratives) Unwesen treiben.
_Autor_
Graham Masterton, geboren am 16. Januar 1946 im schottischen Edinburgh, ist nicht nur ein sehr fleißiger, sondern auch ein recht populärer Autor moderner Horrorgeschichten. In Deutschland ist ihm der Durchbruch seltsamerweise nie wirklich gelungen. Nur ein Bruchteil seiner phantastischen Romane und Thriller, ganz zu schweigen von seinen historischen Werken, seinen Thrillern oder den berühmt berüchtigten Sex Leitfäden, haben den Weg über den Kanal gefunden.
Besagte Leitfäden erinnern übrigens an Mastertons frühe Jahre. Seine journalistische Ausbildung trug dem kaum 20 Jährigen die die Position des Redakteurs für das britische Männer Magazin „Maifair“ ein. Nachdem er sich hier bewährt hatte, wechselte er zu Penthouse und Penthouse Forum. Dank des reichlichen Quellenmaterials verfasste Masterton selbst einige hilfreiche Werke, von denen „How To Drive Your Man Wild In Bed“ immerhin eine Weltauflage von mehr als drei Millionen Exemplaren erreichte.
Ab 1976 schrieb Masterton Unterhaltungsromane. Riss er sein Debütwerk „The Manitou“ (dt. „Der Manitou“) noch binnen einer Woche herunter, gilt er heute als kompetenter Handwerker, dem manchmal Größeres gelingt, wenn sein Geist schneller arbeitet als die Schreibhand, was freilich nur selten vorkommt.
|Taschenbuch: 173 Seiten
Originaltitel: The Manitou (London : Neville Spearman 1975/New York : Pinnacle Books 1976)
Übersetzung: Rosmarie Hundertmarck
ISBN-13: 978-3-404-01043-1|
[Autorenhomepage]http://www.grahammasterton.co.uk
[Verlagshomepage]http://www.luebbe.de
(Michael Drewniok)
Armitage Trail – Scarface
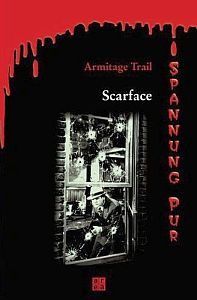
Armitage Trail – Scarface weiterlesen
Allingham, Margery – Hüter des Kelchs, Der
_Das geschieht:_
Albert Campion ist das schwarze Schaf seiner hochadligen Familie, die ihn deshalb verstoßen hat. Nun verdingt er sich als privater Ermittler, der auch dort seiner kriminalistischen Arbeit nachgehen kann, wo die Polizei versagt. Campion hat dank seines bodenständigen ‚Partners‘, des ehemaligen Einbrechers Lugg, einen guten Draht zur Unterwelt. So hat er von der „Firma“ erfahren. Diese Verbrecherbande arbeitet für hoch angesehene, schwer reiche, absolut skrupellose Kunstsammler, die ihrer Sammlung Stücke einverleiben wollen, die sich in Privatbesitz befinden oder in Museen hängen: Sie werden schlicht gestohlen.
Nun erging ein neuer ‚Auftrag‘ an die „Firma“: Der berühmte Kelch von Gyrth soll geraubt werden. Seit Jahrhunderten befindet er sich im Besitz der gleichnamigen Familie, die ihn in „The Tower“, dem Stammsitz nahe der Gemeinde Sanctuary in der Grafschaft Suffolk, aufbewahrt. Ein uralter Geheimvertrag verpflichtet die Gyrthes, den Kelch für die Krone zu hüten. Verschwindet er, verlieren sie Rang und Besitz.
Kein Wunder, dass Campions Warnung für Aufregung sorgt. Doch wer ist Freund, wer Feind? Campion findet einen Verbündeten in Valentine Gyrth, Sohn und Erbe des derzeitigen Baronets. Dieser hat sich zwar mit dem Vater zerstritten, kehrt jetzt aber zurück, als nicht nur die Familienehre in Gefahr gerät: Lady Diana, Valentines törichte Tante, die sich selbst zur „Kelchjungfrau“ ernannt hatte, wurde ermordet auf einer Waldlichtung gefunden. Die „Firma“ ist schon aktiv, und sie will den Kelch offenbar um jeden Preis: schlecht für Campion & Co., die weiterhin absolut keine Ahnung haben, wer ihre Gegner sind!
|Kleine, mörderisch gemütliche Welt|
Glückliches Großbritannien: Hier ist zumindest im klassischen Kriminalroman die Welt noch in Ordnung. Ein Verbrechen kann das nur kurzfristig stören. In so einer Welt möchten wir globalisierungsgestressten, outgesourcten Gegenwartsmenschen insgeheim auch gern leben. Deshalb lesen wir so gern Romane wie diesen. Alle von den Fans so heiß geliebten Elemente eines zünftigen „Whodunit“-Thrillers werden von der Verfasserin kundig beschworen. Da haben das kleine, idyllische, von der Zeit offenbar vergessene Dorf auf dem Land, über dem ein feudaler, von einem verwunschenen Wald umgebender Landsitz thront, der über einen Turm mit Geheimkammer verfügt.
Der Plot ist dieser Umgebung angemessen. Vor Urzeiten hat ein frühmittelalterlicher Eroberer in „The Tower“ einen Schatz verborgen, von dessen Existenz die englische Monarchie abhängt. Ein kompliziertes, höchst archaisches Ritual ist damit für jene verbunden, die ihn hüten. Die Vergangenheit ist und bleibt präsent, als sich nun gierige Diebesfinger nach dem wertvollen Kelch ausstrecken.
Hüten können diesen natürlich nur Adlige reinsten Geblüts, die dann ruhig reichlich verschroben sein dürfen. Es ist unter diesen Umständen überhaupt kein Stilbruch, dass sich ein leibhaftiges Gespenst ins Geschehen einmischt. Auch eine Hexe, ein Dorftrottel, ein zerstreuter Professor, romantisch-verwegene Zigeuner, pittoreske Schurken und andere absolut unrealistische, aber allerliebst agierende Gestalten haben ihre großen Auftritte.
Eine riskante Geschichte, stets haarscharf am Rande der Lächerlichkeit balancierend: Das Talent der Autorin führt dazu, dass wir uns stattdessen durchweg gut amüsieren. Allingham leugnet nie die Märchenhaftigkeit ihres Kelch-Krimis – sie ignoriert diese einfach bzw. präsentiert noch die haarsträubendsten Ereignisse mit dem berühmt-berüchtigten britischen Ernst, hinter dem sich knochentrockener Humor verbergen kann. Solche Meisterschaft und Dreistigkeit zugleich im Spinnen absurder Garne kennt man sonst nur von John Dickson Carr (1906-1977), der gruselige Burgen und Ruinen liebte und doch immer wieder streng rational denkende Detektive ihre Geheimnisse lüften ließ. In dieser Beziehung geht Allingham noch einen Schritt weiter: Die Präsenz des Übernatürlichen fügt sie geschickt ins Geschehen ein. Das hätte Carrs Dr. Fell niemals gestattet!
|Den Anstand wenigstens vorgeben|
Verfolgungsjagden, Massenprügeleien, nächtliche Hexenhatz, Entführungen, Todesfallen: Auch sonst lässt Allingham ihre Leser nie zur Ruhe kommen. Albert Campion kommt kaum zum Kombinieren. Für einen angeblich vergeistigten, weichlich wirkenden Ermittler ist er ziemlich rege, reist inkognito mit Zigeunern im Land umher, verfügt über bemerkenswerte Verbindungen zur Prominenz seines Heimatlandes in Politik und Gesellschaft. Kein Wunder, ist er doch selbst so etwas wie ein Königskind, das sich zwar von seiner Familie losgesagt hat, aber dennoch seine Adelspflichten erfüllt. Um seine ehrwürdige Verwandtschaft nicht vor der Öffentlichkeit zu düpieren, hat er sich ein bürgerliches Leben und einen neuen Namen zugelegt. Die ihm in die Wiege gelegten Kontakte kombiniert er mit seinen kriminalistischen Talenten. Das ist für den echten Blaublütler praktisch: Selbst das Königshaus bemüht Albert Campion, wenn es heikle Verbrechen zu klären und Skandale zu verhindern gilt, denn er ist offiziell zwar persona non grata, aber trotzdem „einer der Jungs“ & ein Gentleman, mit dem man sich abgeben kann.
Campion ist wie so viele Detektive der klassischen Ära ein Abkömmling von Sherlock Holmes. Allingham bemüht sich zwar ihn menschlicher wirken zu lassen, aber da ist einerseits doch eine Grenzlinie, hinter der sich der wahre Albert Campion verborgen hält. Andererseits finden wir halt doch viele Holmes-Elemente wieder, wenn wir nach ihnen Ausschau halten.
|Freunde & Frauen|
Einen Watson besitzt Campion auch. Den hat Allingham allerdings völlig neu gestaltet. Lugg zeichnet ganz sicher nicht die Taten seines Herrn für die Nachwelt auf. Er schreibt (oder denkt) nicht, er handelt. Als waschechter Angehöriger der Unterschicht und geläuterter Krimineller verfügt er über Mutterwitz, Schlauheit und Mut. Allingham hat ihn bemerkenswert freigeistig und ohne Spur des typischen Herr-Diener-Verhältnisses gestaltet, wie es z. B. Dorothy Sayers’ Lord Peter Wimsey und Bunter verbindet. Campion und Lugg haben viel miteinander erlebt; sie sind Freunde geworden, soweit dies das starre britische Kastensystem möglich macht.
Frauen sind im klassischen Thriller üblicherweise schmückendes Beiwerk. Auch Allingham hütete sich ihre zeitgenössischen Leser zu vergrämen. Emanzipation im eigentlichen Sinn wird man daher nicht finden. Allerdings deutet der Originaltitel unseres Abenteuers bereits an: Die Verfasserin ist sich durchaus der Tatsache bewusst, dass ihre Geschlechtsgenossinnen nicht nur deshalb auf dieser Welt wandeln, um von guten Männern vor bösen Kerls gerettet zu werden ,..
_Autorin_
Margery Louise Allingham wurde 1904 geboren. Die Schriftstellerei wurde ihr quasi in die Wiege gelegt; in ihrer Familie ersetzte sie die Hausmusik. So war es kaum verwunderlich, dass Margery beschloss, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Sie veröffentlichte 1923 als Romanerstling „Blackkerchief Dick“, eine Romanze. In diesem Genre verfasste sie auch eine Reihe von Kurzgeschichten für Magazine
In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre entdeckte Allingham den Kriminalroman. 1928 erschien „The White Cottage Mystery“ (dt. „Ein böser Nachbar“). Die Leserschaft reagiert positiv. Allingham blieb dem Genre treu. Sie erfasste rasch, dass sie ihr Publikum noch fester an sich binden konnte, wenn sie ihm eine Identifikationsfigur in Gestalt eines Serienhelden lieferte. 1929 erschien Albert Campion auf der Bildfläche. Allingham schuf ihn (übrigens in enger, lebenslanger Zusammenarbeit mit ihrem Ehegatten Philip Youngman Carter) als freundlichen, intelligenten, jungen Mann mit adligem Hintergrund. Sie stattete ihn mit einer Biografie aus, wies ihm als Geburtsdatum den 15. Mai 1900 zu und ließ ihn altern. Mit den Jahren wurde Albert Campion klüger (und ein wenig zynisch). Auch seine Fälle wurden moderner; zwar blieben sie „Whodunits“, aber sie orientierten sich sacht an der Zeitgeschichte und taten nicht so, als sei das viktorianische England nie verstrichen.
Allinghams Thriller wurden von der Kritik und den Lesern gleichermaßen wegen der sauber gedrechselten, verwickelten Plots, der einprägsamen Figurenzeichnung und des Stils geschätzt. Zusammen mit Agatha Christie oder Dorothy L. Sayers gehörte sie zur Prominenz der britischen Kriminalschriftstellerinnen. (In Deutschland genoss sie seltsamerweise nie den Ruhm, der ihr zukommt; erst relativ spät nahm sich in den 1980er Jahren der Diogenes-Verlag des Allinghamschen Œvres an, aber dann immerhin gut übersetzt und ungekürzt.)
In den 1960er Jahren erkrankte Margery Allingham an Krebs. Sie erlag ihrer Krankheit am 30. Juni 1966. Dies war allerdings nicht das Ende von Albert Campion. Youngman Carter setzte die Reihe fort, er starb allerdings selbst bereits dreieinhalb Jahre später. Trotzdem blieb Albert Campion präsent; Allinghams Bücher werden ständig neu aufgelegt. Ende der 1980er Jahre gelang Campion der Sprung ins Fernsehen. In acht spielfilmlangen Episoden verkörperte ihn Peter Davison mit großem Erfolg.
_Die Albert-Campion Serie:_
(1929) Mord in Black Dudley/Der italienische Dolch |(The Black Dudley Murder)|
(1930) Gefährliches Landleben |(Mystery Mile)|
(1931) Polizei am Grab |(Police at the Funeral)|
(1931) Der Hüter des Kelchs |(Look to the Lady)|
(1933) Süße Gefahr |(Sweet Danger)|
(1934) Ein Gespenst stirbt/Wenn Geister sterben |(Death of a Ghost)|
(1936) Für Jugendliche nicht geeignet/Blumen für den Richter |(Flowers for the Judge)|
(1937) Der Fall Pig |(The Case of the Late Pig)|
(1937) Tänzer in Trauer |(Dancers in the Morning)|
(1938) Mode und Morde |(The Fashion in Shrouds)|
(1941) Judaslohn |(Traitor’s Purse)|
(1945) Zur Hochzeit eine Leiche |(Coroner’s Pidgin)|
(1948) Überstunden für den Totengräber |(More Work for the Undertaker)|
(1952) Die Spur des Tigers |(The Tiger in the Smoke)|
(1955) Die lockende Dame/Trau keiner Lady |(The Beckoning Lady)|
(1958) Schlag mich mit Blindheit |(Hide My Eyes)|
(1963) Der Geist der Gouvernante |(The China Governess)|
(1965) Gedankenschnüffler |(The Mind Readers)|
(1968) |Cargo of Eagles| (vollendet von Philip Youngman Carter; keine dt. Ausgabe)
(1968) Der zweite Anruf |(Mr. Campion’s Farthing)|*
(1971) Trick 17 |(Mr. Campion’s Falcon)|*
* von Philip Youngman Carter
_Die Campion-Kurzgeschichten-Sammlungen_
(1937) |Mr. Campion, Criminologist| (keine dt. Ausgabe)
(1939) Die Handschuhe des Franzosen |(Mr. Campion and Others)|
(1947) |The Casebook of Mr. Campion| (keine dt. Ausgabe)
(1969) Mädchen, Nerz und Detektive/Der Dank des Einbrechers |(The Allingham Case Book)|
(1973) Der vollkommene Butler |(The Allingham Minibus – More Short Stories)|
(1989) |The Return of Mr. Campion| (keine dt. Ausgabe)
|Taschenbuch: 282 Seiten
Originaltitel: Look to the Lady (London : Jarrolds 1931)
Übersetzung: Alexandra u. Gerhard Baumrucker
ISBN-13: 978-3-442-03079-8|
[Autorenhomepage]http://www.margeryallingham.org.uk
[Verlagshomepage]http://www.randomhouse.de/goldmann
(Michael Drewniok)
David Quammen – Die zwei Hörner des Rhinozeros

David Quammen – Die zwei Hörner des Rhinozeros weiterlesen
Denis Marquet – Der Zorn
Unheimliches geht vor in den USA: Die Bürger diverser Kleinstädte gehen Blut spuckend zu Boden, brave Hunde werden wild und beißen guten Menschen die Kehlen durch, das Meer verwandelt sich in Fliegenleim, Obst fällt von den Bäumen … Die Plagen muten biblisch an, und sie nehmen kein Ende, so sehr sich die Regierung auch bemüht, dies zu vertuschen, um eine General-Panik unter ihren offensichtlich chronisch unmündigen und wenig belastbaren Landeskindern zu verhindern.
Dafür ist Colonel Bosman, der über Fort Detrick – das medizinische Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten der US-Army – herrscht, sicherlich der richtige Mann. Er liebt seinen Job und sorgt dafür, dass keine Terroristen oder schlappschwänzige Zivilisten Giftviren über die Schwelle der Vereinigten Staaten tragen. Scharf im Auge behält Boswell deshalb die jüngst angeheuerten Biologen Peter Basler und Greg Thomas. Sie sollen ein Gegenmittel gegen die beschriebenen Plagen finden, wollen sich aber unpatriotisch den Mund zum Wohle des Landes nicht verbieten lassen. Denis Marquet – Der Zorn weiterlesen
Westlake, Donald E. – Fünf gegen eine Bank
John Dortmunder ist clever, von ehrlicher Arbeit hält er wenig: Also schlägt er sich mit kleinen Gaunereien durch, wobei er der Polizei meist nur einen Schritt voraus ist. Ein großer Fischzug soll ihn endlich sanieren. Mit seinen Kumpanen Kelp, einem Autodieb, Hermann X, einem Safeknacker, March, einem Amateurrennfahrer, und Viktor, einem Ex-FBI-Agenten, will er die |Capitalists’ & Immigrants’ Bank| überfallen.
Besagte Bank ist wegen des Umbaus ihrer Filiale in einen riesigen Trailer umgezogen. Diese unsichere Schatzkammer zieht unser Gaunerquintett wie ein Magnet an. Man entschließt sich zu einer ungewöhnlichen Vorgehensweise und will zunächst die Bank abschleppen, um sie anschließend in einem stillen Winkel in aller Ruhe auszurauben.
Mit Hilfe eines ausgetüftelten Plans und eines starken Sattelschleppers gelingt das waghalsige Unternehmen tatsächlich. Dortmunder und Co. schrecken nicht einmal die sieben wütenden Wachmänner, die schwer bewaffnet in dem Banktrailer hocken.
Mit der Tücke des Objekts hat die Bande freilich nicht gerechnet. Es ist weitaus schwieriger als gedacht, den Safe im Inneren des Wagens zu knacken. Der Trailer verwandelt sich in eine belagerte Festung, vor deren Tor Dortmunder und seine nervösen Spießgesellen lauern. Die Zeit drängt, denn die Polizei schläft nicht. So muss Dortmunder einmal mehr seine grauen Zellen strapazieren. Anschließend ist das Chaos komplett …
Das „Rififi“-Thema ist nach dem französischen Kinoklassiker von 1954 („Du Rififi chez les hommes“) benannt: Minuziös werden die Vorbereitungen eines höchst komplizierten, eigentlich unmöglichen Raubes und seine anschließende Durchführung geschildert. Enorm ist die Spannung, die eifrigen Gauner wachsen den Zuschauern ans Herz, aber selbstverständlich geht während des Coups etwas gewaltig schief. An seinem Ende stehen Scheitern, Verhaftung, sogar Tod – ein fast tragischer Ausgang, der praktisch alle zufrieden stellt: das Gesetz und die intellektuellen Freunde des anarchistischen Gangstertums. (Im Angelsächsischen nennt man diese Filme übrigens „Caper-Movies“.)
„Fünf gegen eine Bank“ verkneift sich Gefühle und Gefühlsduseligkeit. Zwar werden Planung und Raub detailliert in Szene gesetzt. Schon von Anfang an ist freilich klar, dass die Geschichte, welche sich darum rankt, nur insofern ernst genommen werden darf, als sie sorgfältig geplottet und mit liebenswerter Verrücktheit inszeniert ist.
Der Raub der Trailer-Bank wird wohl kaum gelingen. Wir wissen es, sobald wir jene kennen lernen, die ihn durchführen möchten. Der kriminelle Akt ist an sich ohnehin Nebensache: Im Vordergrund steht vor allem sein Umkippen in puren Slapstick. Murphys Gesetz gilt auch für Verbrecher: Es wird schief gehen, was schief gehen kann.
Wie das aussieht, schildert Donald E. Westlake mit der ihm üblichen Meisterschaft. Lange narrt oder irritiert er sein Publikum. Bitterernst sitzen fünf Gauner beisammen und tüfteln ein Kapitalverbrechen aus. Doch obwohl Westlake dies fast sachlich beschreibt, wissen wir bald, dass hier etwas faul ist. Die Bande, die ihren Plan umsetzen will, zeichnet sich vor allem durch chronische Erfolglosigkeit aus.
So kommt es, wie es kommen muss: Dominosteinen gleich geraten die Elemente des Plans ins Stürzen. Eine Katastrophe führt zur nächsten, die Ereignisse überstürzen sich, immer absurder wird das Geschehen, während unsere Gauner zunehmend verzweifelt bemüht sind, einen klaren Kopf und das ersehnte Geld im Auge zu behalten. Ihr einziger Erfolg: Das Chaos wird immer turbulenter.
Der Heiterkeitsfaktor steigt ständig, weil Westlake die Regeln der Komik versteht. Nie forciert er das Vergnügen. Scheinbar ungerührt, aber mit knochentrockenem Humor beschränkt er sich darauf zu schildern, was geschieht. Platziert ist das Geschehen jedoch in einer Art Parallelwelt, die nur realistisch wirkt und von überaus irrationalen Zeitgenossen bevölkert ist. Vor dem inneren Auge des Lesers kann sich der Untergang der Dortmunder-Gang deshalb in immer neue groteske Höhen schaukeln.
Wichtig sind dabei auch die Details. So wird Dortmunder beispielsweise in einen Auffahrunfall verwickelt. Sein Gegenüber will die Polizei rufen. Da entdeckt der Gauner auf dem Rücksitz des anderen Autos einen Karton mit (zum Zeitpunkt des Romans verbotenen) Sexromanen: Die Titel dieser Schmuddelbücher sind real, und geschrieben hat sie ein noch sehr junger Autor namens Donald E. Westlake. Dortmunder möchte seiner Freundin mit gestohlenen Zigaretten eine Freude machen, bis ihm einfällt, dass sie ihre Glimmstängel selbst im Laden zu klauen pflegt. Kelp stiehlt ausgerechnet den Laster einer Schmugglerbande.
Er hat in seinem Leben noch keinen Dollar auf ehrliche Weise verdient und ist stolz darauf: John Archibald Dortmunder ist ein Krimineller mit Leib und Seele. Er liebt seinen Job, obwohl der ihm im Grunde mehr Hirnschmalz und Schweiß abfordert als jede „ehrliche“ Arbeit. Außerdem ist Dortmunder wie jeder Hollywood-Gauner ein unbelehrbarer Idealist und Träumer: Obwohl seine genial-verrückten Streiche regelmäßig scheitern, setzt er auf den nächsten, den endlich erfolgreichen Coup.
Fragt sich allerdings, wie das gelingen soll, wenn sich Dortmunder stets mit ausgesprochen farbenfrohen Komplizen umgibt. Sein alter Kumpel Kelp ist nicht der Hellste. March hat seine kaum vorbildhafte Mutter im Schlepptau, mit der er nebenbei einen windigen Versicherungsbetrug durchzieht. Herman X ist ein Möchtegern-Revoluzzer, der für seine schwarzen „Brüder“ aus der „Bewegung”“wie am Fließband Überfälle begehen muss. Viktor schreibt simultan zum Überfall auf die Bank an einem Roman darüber. Dortmunder wird von seiner abenteuerlustigen Freundin May zum Raub begleitet.
Die Bande profitiert von der Tatsache, dass ihnen seitens des Gesetzes nur bedingt Gefahr droht. Captain Deemer und seine Leute stellen sich wahrlich dümmer an als die Polizei erlaubt. Mehr als einmal laufen ihnen die gesuchten Bankräuber in die Arme – erkannt werden diese nie und von den Beamten stattdessen fürsorglich mit Kaffee und Kuchen versorgt …
Donald Edwin Westlake wird am 12. Juli 1933 in Brooklyn, New York, als Sohn irischstämmiger Eltern geboren. Bereits als Student denkt er an eine berufliche Laufbahn als Schriftsteller und verkauft erste Kurzgeschichten an Science-Fiction- und Mystery-Magazine. 1958 zieht Westlake nach New York City. Als überaus fleißiger Schreiber fasst im Verlagsgeschäft Fuß. 1960 erscheint sein erster Roman. „The Mercenaries“ (dt. „Das Gangstersyndikat“) lässt Westlakes Talent für harte, schnelle Thriller deutlich erkennen.
Bereits 1962 betritt Parker, ein eisenharter Berufskrimineller, die Bildfläche. „The Hunter“ (dt. „Jetzt sind wir quitt“/“Payback“) verfasst Westlake als Richard Stark. „Richard“ borgte sich der Autor vom Schauspieler Richard Widmark, „Stark“ suggerierte – völlig zu Recht – die schnörkellose, gewaltreiche Machart dieses Romans. Bis in die 1970er Jahre veröffentlicht „Richard Stark“ immer neue Parker-Romane. Westlake ist ein guter und schneller Unterhaltungs-Schriftsteller. Jährlich wirft er mehrere Romane auf den Buchmarkt. Unter diversen Pseudonymen versucht er sich in allen Genres, schreibt Science-Fiction, Western, ein Kinderbuch und sogar eine Biografie der Schauspielerin Elizabeth Taylor.
Mühelos meistert Westlake den Spagat zwischen knallharter Action und witzigem Slapstick. Ab 1970 lässt er John Dortmunder sein Unwesen treiben. Wie sein bärbeißiger „Kollege“ Parker hat dieser den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft. Andere Serien hat Westlake dagegen abgeschlossen. Neben dem Schriftsteller Westlake gibt es auch den Drehbuchautor Westlake. Nicht nur eine ganze Reihe seiner eigenen Werke wurden inzwischen verfilmt. Westlake selbst adaptiert für Hollywood Geschichten anderer Autoren. Für sein Drehbuch zu „The Grifters“ (nach Jim Thompson) wurde er für den „Oscar“ nominiert. „Bank Shot“ wurde 1974 unter der Regie von Gower Champion verfilmt (dt. „Klauen wir gleich die ganze Bank!“). Den John Dortmunder spielte – seltsamerweise unter dem neuen Rollennamen „Walter Upjohn Ballentine“ gewohnt fabelhaft George C. Scott.
Nach einer mehr als vier Jahrzehnte währenden, höchst produktiven und erfolgreichen Schriftsteller-Karriere denkt Westlake offensichtlich nicht an den Ruhestand. Er ist aktiv wie eh’ und je und bereichert als höchst lebendige Legende das Krimigenre mit immer neuen, immer noch lesenswerten Beiträgen. Donald E. Westlake hat eine eigene [Website,]http://www.donaldwestlake.com die in Form und Inhalt an seine Romane erinnert: ohne Schnickschnack, lakonisch und witzig, dazu informativ und insgesamt unterhaltsam.
Die Dortmunder-Romane von Donald E. Westlake wurden in Deutschland vom |Ullstein|-Verlag veröffentlicht (freilich nur die ersten vier Bände).
1970: Finger weg von heißem Eis (The Hot Rock)
1972: Fünf gegen eine Bank (Bank Shot)
1974: Jimmy the Kid (Jimmy the Kid)
1977: Jeder hat so seine Fehler (Nobody’s Perfect)
1983: Why Me?
1986: Good Behavior
1990: Drowned Hopes
1993: Don’t Ask
1996: What’s the Worst That Could Happen?
2001: Bad News
2004: The Road to Ruin
Ebenfalls 2004 erschien „Thieves’ Dozen“, eine Sammlung mit Dortmunder-Kurzgeschichten.
Suzuki, Kôji – Dark Water
Prolog (S. 7-12): An den Ufern der Bucht von Tokio erteilt eine alte Frau ihrer Enkelin eine Lebenslektion. Sie bereitet ihre Botschaft vor, indem sie an jedem Abend der folgenden Woche eine seltsame Geschichte erzählt.
Dunkles Wasser (S. 13-54): In einem kaum bewohnten Hochhaus mehren sich für eine allein erziehende Mutter die schrecklichen Beweise dafür, dass die vor Jahren spurlos verschwundene Tochter einer Vormieterfamilie zumindest des Nachts sehr wohl noch zu den Nachbarn gehört …
Die einsame Insel (S. 55-98): Auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Tokio findet ein Besucher den lebenden Beweis für eine bizarre Beziehungsgeschichte, mit der ihn ein Freund vor vielen Jahren in Verwirrung gestürzt hat …
Strafe (S. 99-146): Ein ungehobelter Fischer muss erstens die Feststellung machen, dass er mehr über den Verbleib seiner verschwundenen Frau weiß als ihm lieb ist, während sich zweitens das Meer nachdrücklich weigert, als Mantel der Verschwiegenheit über seine Untat gezogen zu werden …
Traumschiff (S. 147-182): Kurz vor dem rettenden Hafen stößt ein kleines Segelboot auf einen traurigen Geist, der in seiner Einsamkeit die Passagiere einfach nicht mehr gehen lassen möchte …
Die Flaschenpost (S. 183-218): Auf hoher See findet die Besatzung einer Jacht eine Flasche mit ganz besonderem Inhalt, der mit seiner Grundstimmung – mörderischer Hass – überaus freigiebig umgeht …
Wassertheater (S. 219-246): In einer leer stehenden Diskothek beobachten den Schauspieler, der eine lecke Toilette reparieren will, aus einer nur scheinbar leeren Kabine höchst interessierte Zuschauer …
Der unterirdische See (S. 247-288): Ein allzu wagemutiger Forscher strandet in einer Höhle, die er nur durch einen unterirdischen Fluss verlassen kann, der womöglich in einer Sackgasse endet …
Epilog (S. 289-303): Die alte Frau hat ihre Geschichten erzählt. Die letzte betraf sie selbst, denn ein merkwürdiger Zufall hatte den Abschiedsbrief des Höhlenforschers in ihre Hände geraten lassen.
Wasser ist ein Element, ohne das wir Menschen nicht leben können. Gleichzeitig kann es auch unser schlimmster Feind sein. Wir benutzen es, wir verbrauchen es, aber wir kennen es nicht wirklich. Was das Meer angeht, so befahren die Menschen seit Jahrtausenden seine Oberfläche. Darunter gehen indessen Dinge vor, von denen wir auch heute nur wenig verstehen. Deshalb fürchten wir uns seit jeher vor dem tiefen, dunklen Wasser, versuchen es mythisch zu beschwören, was sich natürlich primär an jene Bewohner wendet, die dort mutmaßlich auf uns lauern, wenn wir uns allzu vertrauensvoll oder unvorsichtig in Tiefen vorwagen, in denen wir nichts zu suchen haben.
Kôji Suzuki widmet dem Wasser einen Reigen lose miteinander verbundener Geschichten. Ihnen gemeinsam ist der Ort des Geschehens – die Bucht von Tokio, eine Wasserwildnis, die direkt vor den Toren einer Hightech-Millionenstadt beginnt. Dieser Gegensatz ist Suzuki aufgefallen. Die Grenzlinie zwischen den beiden Sphären ist dünn. Immer wieder stolpern unglückselige Zeitgenossen unverhofft in eine archaische Urwelt, der sie sich hochkonzentriert stellen müssten. Dass ihnen dies nie gelingt, ist oftmals ihr Untergang.
Wobei „Wasser“ nicht einmal identisch mit „Meer“ sein muss. Das Grauen sickert in „Dunkles Wasser“ aus einem simplen Hahn. Allerdings gilt es die Details zu beachten, die Suzuki, der sich ansonsten einer sehr nüchternen Sprache bedient, fast beiläufig einstreut: Das Haus, in dem besagte verfluchte Badewanne steht, wurde auf Müll errichtet, mit dem man einen Teil der Bucht von Tokio aufgeschüttet hat. Da ist es also wieder, das Symbol des wilden Wassers, das sich von der Zivilisation nie wirklich bändigen lässt.
„Echter“ Spuk macht sich übrigens eher rar in Suzukis Geschichten. Höchstens „Traumschiff“ und „Die Flaschenpost“ können mit Gästen aus dem Jenseits rechnen, die indessen nur eine Nebenrolle spielen, quasi nur im Augenwinkel aufscheinen und dadurch um so nachdrücklicher wirken, wenn man sich denn auf dieses Spiel einlässt. „Wassertheater“ präsentiert einfach eine groteske Geschichte, deren „Auflösung“ vor allem deshalb überrascht, weil sie mit den Mitteln der Phantastik erzählt wird. „Der unterirdische See“ ist pures psychologisches Grauen. Hier wandelt Suzuki in der Tat auf den Spuren von Stephen King- und dessen Schuhe sind ihm beileibe nicht zu groß!
Menschen unter Druck und in Ausnahmesituationen sind es, von denen Suzuki erzählt. Sie stecken latent bereits in einer Krise, deren Ursprünge in die Vergangenheit reichen. Wir treffen sie zu jenem Zeitpunkt, an dem der Seelenkessel überkocht. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Die labile Mutter aus „Dunkles Wasser“ verbeißt sich förmlich in ihre Theorie, von einer untoten Wasserleiche verfolgt zu werden, die sie sich – Suzuki bleibt da meisterlich vage – durchaus nur einbilden kann. Der unzufriedene Lehrer aus „Die einsame Insel“ bastelt sich sein „Gespenst“ ebenfalls in der Werkstatt seiner angeschlagenen Psyche. Die „Strafe“ ereilt einen Fischer, der nicht nur das Opfer seiner brutalen „Erziehung“ wurde, sondern in dessen Familie eine erbliche Geisteskrankheit grassiert.
Auf die Höllen, die sich diese Menschen schaffen, kann ein böser Geist eigentlich nur neidisch sein. Selbst ein halbwegs handfester Spuk wie der unfreundliche Gast im „Flaschenschiff“ kann sich darauf beschränken, vorhandene Dissonanzen der Seele zu verstärken; für Horror und Tod sorgen die Betroffenen dann selbst. „Wassertheater“ und „Der unterirdische See“ kommen sogar gänzlich ohne Gespenster aus; in der letzten Geschichte erweckt Suzuki nicht einmal den Anschein, es ginge nicht mit rechten Dingen zu. Ein verzweifelter Mann in einer grabesdunklen Höhle – das reicht ihm uns, seine Leser, in Angst & Schrecken zu versetzen.
Anmerkung 1: „Dark Water“ multimedial
Die Veröffentlichung einer japanischen Sammlung phantastischer Geschichte ist wahrlich keine Alltäglichkeit auf dem hiesigen Buchmarkt. „Dark Water“ verdankt seine deutsche Inkarnation dem unverhofften Ruhm des Kôji Suzuki, der mit dem Multimedia-Phänomen der „Ring“-Saga einen echten Kult ins Leben rief. Nachdem auch Hollywood aufmerksam geworden war und den ersten Teil erfolgreich neu verfilmte (Fortsetzung folgt), dauerte es nicht lange, bis in der Hoffnung auf eine weitere Scheibe vom Kuchen auch Suzukis übrige Werke übersetzt wurden. (Allerdings greift |Heyne| für „Dark Water“ wieder einmal auf die US-amerikanische, d. h. die ihrerseits schon aus dem Japanischen übersetzte Fassung zurück …)
„Dark Water“, die deutsche Version, weist sich mit einem Aufkleber als Träger der „Originalvorlage zum großen Kino-Schocker“ aus. Wahr ist immerhin, dass „Dunkle Wasser“ ein Drehbuch inspirierte, das 2002 „Ring“-Regisseur Hideo Nakata in Japan unter diesem Titel verfilmte. 2004 folgte unter der Regie von Walter Salles erneut eine US-Fassung mit Jennifer Connelly, Tim Roth und Shelley Duvall, was den |Heyne|-Verlag dazu veranlasste, auf den „Ring“-Zauber zu setzen, der hoffentlich erfreuliche Verkaufszahlen für das „Buch zum Film“ (das eigentlich nur das „Buch mit einer Geschichte zum Film“ ist) bedingt …
Anmerkung 2: „Dark Water“ mangatisch
Nicht enthalten sind in der deutschen Fassung von „Dark Water“ übrigens die Illustrationen des Künstlers Meimu, der in seiner japanischen Heimat als Superstar der dortigen Manga-Szene gilt. Besagter Meimu hat auch eine reine Manga-Version von „Dark Water“ gestaltet, die in Deutschland der |Egmont|-Verlag 2005 auf den Markt bringt.
Anmerkung 3: „Dark Water“ verwässert
Eine besondere Erwähnung „verdient“ die unrühmliche Gestaltung, die der |Heyne|-Verlag „Dark Water“ angedeihen ließ. Hier sollte sehr offensichtlich ein ursprünglich recht schmales Buch „auf Umfang gebracht“ werden. Durch breite Ränder und den sehr großzügigen Einsatz von Vorsatzblättern zu den einzelnen Kapiteln wird der Band mehr schlecht als recht auf knapp über 300 Seiten gepumpt, wo 200 vermutlich gereicht hätten. Die Kosten für die Differenz übernimmt wohl oder übel der Leser …
Kôji Suzuki, der „Stephen King aus Japan“ (ein Etikett der Werbestrategen) wurde 1957 in Hamamatsu (Präfektur Shizuoka) geboren. Bereits in jungen Jahren begann er zu schreiben und gewann 1990 als Absolvent der |Keio University| in Tokio einen (japanischen) „Fantasy Novel Award“ für seinen Roman „Rakuen“, was aber seiner dümpelnden Karriere kaum Auftrieb gab. Das änderte sich erst, als Suzuki 1991 die Welt der Phantastik um ein verfluchtes Videoband bereicherte: Die „Ring“-Saga war geboren. Aus einem Geheimtipp wurde Gruselvolkes Eigentum, als Regisseur Hideo Nakata 1998 den Roman verfilmte. Trotz vieler Veränderungen wurde „Ring“ zum Erfolg, der selbstverständlich mehrfach fortgesetzt wurde sowie die übliche verwässerte Hollywood-Interpretation erfuhr.
Suzuki selbst erweiterte den „Ring“-Erstling zur Romantrilogie, der er noch einen vierten Band mit Kurzgeschichten folgen ließ. Acht Millionen Exemplare soll er inzwischen verkauft haben, was zweifellos auch der geschickten Vermarktung zu verdanken ist: Suzukis Werke sind als Buch, Film und Manga quasi allgegenwärtig.
Jürgen Müller (Hg.) – Filme der 60er

Jonathan Latimer – Der enthauptete Großonkel
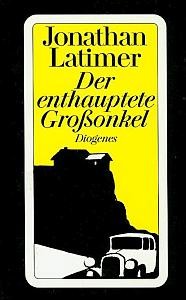
Jonathan Latimer – Der enthauptete Großonkel weiterlesen
Gardner, Erle Stanley – Furien im Finstern
Bertha Cool, schwergewichtige Chefin einer kleinen Detektei, ist noch missgestimmter als üblich. Ihr Partner Donald Lam hat sie versetzt – so sieht Berta das – und sich der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika angeschlossen: Die Welt befindet sich in diesem Jahr 1942 im Krieg, und Lam will seine Bürgerpflicht erfüllen.
Für solchen Idealismus hat Berta Cool kein Verständnis. Sie muss feststellen, wie sehr ihr der gewitzte Lam im Geschäft fehlt. Ihrer Geldgier tut dies keinen Abbruch, aber sie sieht sich gezwungen, jetzt wieder selbst auf der Straße Detektivarbeit zu leisten. Schlimmer noch: Der aktuelle Auftrag, der zunächst nach leicht verdientem Lohn aussah, übersteigt womöglich Bertas kriminalistische Fähigkeiten!
Der blinde Straßenhändler Rodney Kosling hat sie engagiert. Ihm ist ein merkwürdiger Unfall aufgefallen: Josephine Dell, eine junge Frau, mit der er regelmäßig an seinem Stand zu plaudern pflegte, wurde von einem Wagen angefahren und vom Unfallfahrer mitgenommen. Seitdem ist sie verschwunden. Kosling macht sich Sorgen und möchte die Frau suchen lassen.
Menschenfreunde sind Berta stets verdächtig. Trotzdem übernimmt sie den Fall, der sich rasch als heikel entpuppt. Zwar findet sie Josephine Dell, aber viel interessanter findet sie den plötzlichen Tod des alten Harlow Milbers. Der war Josephines Arbeitgeber und außerdem schwer reich. Er hinterlässt ein seltsames Testament, das seine Haushälterin und deren Familie begünstigt. Milbers einziger Verwandter, sein Neffe Christopher, ist darüber wenig erfreut. Ist das Testament gefälscht? Wenn Berta dies nachweisen kann, winkt ihr ein hohe „Gewinnbeteiligung“!
Aber es ist wie verhext: Was Berta auch einfädelt, es geht schief. Ständig stolpert sie über den undurchsichtigen Versicherungsbetrüger Jerry Bollman – und schließlich über dessen Leiche. Für den misstrauischen Polizisten Sellers ist Berta die Hauptverdächtige. Ihre Bemühungen, sich zu rehabilitieren und trotzdem ihren finanziellen Schnitt zu machen, setzen eine verhängnisvolle Kette kriminalistischer Verwicklungen in Gang, die Wahrheit und Lüge immer fester verstricken, bis Berta sich in diesem Netz unrettbar zu verstricken droht …
Privatdetektive sind üblicherweise taffe Burschen, die vielleicht hier und da irren (oder übers Ohr gehauen werden), aber spätestens im Romanfinale vom Holzweg auf die Straße der Wahrheit einbiegen. Sie verstehen ihren Job, lassen sich nicht schrecken oder bestechen, folgen unbeirrbar ihrer Spur.
Genau das geschieht hier eben nicht. „Furien im Finstern“ (den dümmlichen deutschen Titel verdankt das vorliegende Werk dem zeitgenössischen Ullstein-Drang zur „Originalität“) ist im Grunde eine 160-seitige Umkehr der meisten Detektivkrimi-Klischees. Hier beobachten wir eine Schnüfflerfrau, der es an Energie und Furchtlosigkeit nicht mangelt. Leider kann ihre kriminalistische Fachkenntnis da nur bedingt mithalten. Außerdem vernebelt ausgeprägte Geldgier das Gespür und übertüncht Anzeichen, die einen Philip Marlowe längst gewarnt hätten, dass da etwas faul ist.
Aber Bertha Cool will nicht Gerechtigkeit, sondern Bares. Mit dem Eifer und dem diplomatischen Geschick einer Abrissbirne fällt sie über ihre Klienten her. Sie ist sich keineswegs zu schade, mit windigen Betrügern um Prämien zu rangeln. Was ihr dabei entgeht: Sie reiht sich nahtlos in einen Reigen mehr oder weniger geschickter Betrüger und Erbschleicher ein.
Mit faszinierender Sicherheit spinnt Autor Gardner sein Netz. Gauner gegen Gauner, die Fronten ändern sich ständig. Finstere Pakte werden geschlossen und sofort gebrochen. Wer gestern noch gegeneinander kämpfte, tut sich heute womöglich zusammen – und umgekehrt. Berta Cool mischt da skrupellos tüchtig mit.
Der Witz an der Sache ist ihre Blindheit dafür, wie sie, die mächtig ihre Klienten, Zeugen und die Polizei manipuliert, selbst in diverse Intrigen verwickelt wird, ohne es zu bemerken. Da ist es nur gut, dass Donald Lam während eines kurzen Heimaturlaubs den kunstvoll verwickelten Fall aufzudröseln vermag.
Bis es so weit ist, hat der Leser einen Riesenspaß gehabt, denn er (und sie) ist zusammen mit Berta Cool tüchtig an der Nase herumgeführt worden. Die Mosaiksteinchen purzeln an ihre Plätze und enthüllen wider Erwarten ein logisches Gesamtbild. Wieder einmal bestätigt sich, dass die Cool/Lam-Romane so sauber geplottet sind wie Gardners Perry-Mason-Krimis. Trotzdem können sie womöglich noch besser gefallen, denn sie verfügen über eine angenehme Zusatzeigenschaft: Sie sind humorvoll. Damit ist nicht einmal der Slapstick-Witz der dampfwalzenartig auftretenden Bertha Cool gemeint. Vor allem weiß die ausgetüftelte Story zu gefallen, die den Namen „Krimikomödie“ verdient. Der Autor arbeitet zudem mit trockenem Wortwitz, der sogar die Übersetzung überlebt hat.
Mit Berta Cool ist Erle Stanley Gardner ein echter Klassiker gelungen, der sich ins Gedächtnis der Leser eingräbt. Selbstverständlich könnten politisch korrekte Spielverderber allerlei Einwände gegen diese Figur erheben: Berta ist ein wandelndes Klischee, zwar tüchtig, aber dick (= geschlechtslos), grob, laut und gierig. Grandios setzt sie ihren Fall in den Sand und muss von ihrem (männlichen) Partner gerettet werden, der selbst aus weiter Ferne zum Kern des Lügengespinstes durchdringt.
Wir sparen uns an dieser Stelle hochphilosophische Überlegungen darüber, ob Gardner sich eine selbstständige und erfolgreiche Frau etwa nur als Karikatur vorstellen kann. Nehmen wir stattdessen an, dass er einfach eine schräge Type entwarf, um seine Romane um die Detektei Cool & Lam möglichst interessant zu gestalten. Schließlich sind die anderen Figuren auch nicht gerade aus dem Leben gegriffen.
Außerdem kann Gardner einen dicken Pluspunkt kassieren: Seine Bertha Cool ist kein Engel mit goldenem Herzen, das sich unter der rauen Schale verbirgt. Bertha ist tatsächlich ein lupenreines Miststück, das zu Mitgefühl und Hilfsbereitschaft regelmäßig überlistet werden muss. Wenn sich ihr Geiz dann gegen sie wendet, stellt Gardner das nie als „gerechte Strafe“ eines moralinsauren Schicksals dar. Berta fällt der (blinden) Tücke des Objekts anheim, was sehr viel überzeugender wirkt.
Der eigentliche Kriminalist des Teams ist ohnehin Donald Lam. Berta Cool weiß trotz ihrer ewigen Verbalattacken sehr gut, was sie an ihm hat, ohne dass sie sich dadurch nachgiebiger zeigen würde. Lam nimmt Bertha wie sie ist, was wohl die einzige Möglichkeit für eine fruchtbare Zusammenarbeit bietet.
Normalerweise ist Lam wie gesagt für die eigentliche Detektivarbeit zuständig. Er ermittelt vor Ort, während Bertha Cool in der Regel im Hintergrund wirkt, um von dort regelmäßig nach vorn zu drängen, wenn die Handlung der humorvollen Auflockerung bedarf. „Furien im Finstern“ stellt insofern eine Abweichung von der goldenen Regel dar, nach der die Leser einer Serie Veränderungen des gewohnten Schemas hassen. Gardners Rechnung geht indes auf: Bertha Cool trägt „ihren“ Roman spielend. Man wünscht sich sogar mehr Geschichten mit ihr im Mittelpunkt.
Erle Stanley Gardner wurde am 17. Juli 1889 in Malden, Massachusetts geboren. 1909 begann er Jura zu studieren. Dass er kein Bücherwurm war, belegt u. a. die Tatsache, dass ihn die Valparaiso University im US-Staat Indiana wegen einer Schlägerei hinauswarf. Gardner liebte den sportlichen Kampf; er boxte und arrangierte sogar illegale Ringkämpfe.
1910 eröffnete er seine erste eigene Kanzlei in Kalifornien. Aber das Geschäft ging schlecht, so dass Gardner auch als Handlungsreisender arbeiten musste. Außerdem entdeckte er die „Pulps“, billige Magazine, die in den 1920er aufkamen und einen unstillbaren Hunger auf Science-Fiction-, Horror-, Western- und Kriminalkurzgeschichten entwickelten. Gardner verfasste unter Pseudonymen wie A. A. Fair, Carleton Kendrake oder Charles J. Kenny eine Flut von Storys, u. a. für das berühmte „Black Mask Magazine“. Jeden dritten Tag trug er eine neue Geschichte zur Post, zwischen 1921 und 1933 verfasste er durchschnittlich eine Million Wörter pro Jahr – kein Wunder, dass er sich 1932 ein Diktaphon zulegte und seine Geschichten nunmehr diktierte und abtippen ließ.
1933 verfasste Gardner seinen ersten Roman, der gleichzeitig das Debüt Perry Masons wurde. Dieser war erfolgreich und bildete den Auftakt einer insgesamt 82-teiligen Serie, die bis 1973 lief. Trotzdem war Gardner ständig in Geldnöten. Deshalb reaktivierte er 1939 das Pseudonym A. A. Fair und erfand das ungleiche Detektivpaar Bertha Cool und Donald Lam, die bis 1970 29 ebenfalls sehr beliebte Abenteuer erlebten. Außerdem verfasste er neun Folgen einer weiteren Serie
Als Jurist blieb Gardner weiterhin aktiv. 1948 gründete er den „Court of Last Resort“, der Personen unterstützte, die womöglich einem Justizirrtum zum Opfer gefallen waren. Tatsächlich verhalf diese Einrichtung einer ganze Reihe von Unglücklichen zu Freisprüchen.
Hoch geehrt und von seinen Fans weiterhin treu gelesen, verstarb Erle Stanley Gardner – bis zuletzt fleißig diktierend – am 11. März 1970 auf seiner Farm in Temecula in Kalifornien.
Peter Millar – Schwarzer Winter
Theresa „Therry“ Moon, pflichtbewusste Nachwuchs-Reporterin der „Oxford Post“, kennt die inoffiziellen Absprachen und Mauscheleien, mit denen die örtliche Prominenz in Politik und Wirtschaft dafür sorgt, dass gutes Geld nicht an schafgleiche Bürger oder gar an das Pack der Armen und Chancenlosen verschwendet wird. Besonderes Augenmerk richtet Therry auf den windigen Bauunternehmer Geoffrey Martindale. Der lässt gerade ein ganzes Stadtviertel neu aus dem Boden stampfen. „Nether Ditchford“ soll die Siedlung heißen, eine Erinnerung an das verschwundene Dorf, das hier im Mittelalter stand. Dieser Auftrag ist lukrativ, Martindale skrupellos und aus seiner Sicht über das kleinliche Gesetz erhaben. Außerdem hat er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt; scheitert das Projekt, ist Martindale erledigt.
Doch Seltsames geht vor in Nether Ditchford. Obdachlose und Landstreicher werden aufgegriffen, die Symptome einer mysteriösen Krankheit zeigen, die sie grässlich verenden lässt. Man könnte meinen, sie seien der Pest zum Opfer gefallen, aber die ist in Europa schon lange ausgerottet. Der junge Assistenzarzt Rajiv Mahendra kennt die Pest aus seiner indischen Heimat, und der US-amerikanische Student Daniel Warren ist bei seinen Archivstudien auf eine Pfarrchronik aus Nether Ditchford gestoßen, in der geschildert wird, wie Anno 1349 praktisch die gesamte Bevölkerung an der Pest starb und in Massengräbern beigesetzt wurde.
Offenbar gibt es eine unheilvolle Verkettung zwischen den Todesfällen von einst und jetzt. Rajiv und Daniel, zu denen rasch Therry stößt, gehen der Frage nach, ob Martindale buchstäblich die Büchse der Pandora geöffnet hat, dies aber nun unterdrückt, um sein Bauprojekt nicht zu gefährden. Angesichts der Intensität, mit der plötzlich Mietmörder unser Trio verfolgen, spricht viel für diese Annahme …
Wir basteln uns einen Bestseller
Im herangereiften 21. Jahrhundert hat auch der Laie begriffen, dass unterhaltende Filme und Literatur wie Presspappe oder Gartenmöbel produziert werden. Die Spaßfabrikanten definieren „Kreativität“ als Versuch, aus dem nur unter Risiken zu befahrenden Meer der populären Unterhaltung die bewährten Elemente erfolgreichen Profitstrebens abzufischen, um diese Beute dann zu einem hoffentlich garantierten Blockbuster zu verleimen.
Was im Kino klappt, ist auch in der Literatur nicht unbekannt. Peter Millar führt es uns geradezu lehrbuchhaft vor. Er bedient sich einerseits aus dem Genre Historien-Roman, dessen Popularität ungebrochen ist. Ebenfalls gut im Trend (und nicht allzu lange in den Buchläden) liegen Wissenschaftsthriller, unter denen diejenigen besonders zahlreich sind, die tapfere Mediziner und neugierige Journalisten im Kampf gegen machtgeil-gierige Großkonzerne, irre Attentäter und scheußlich-gefährliche Weltuntergangs-Epidemien zeigen. Folgerichtig rührt Millar einen Arzt und einen Historiker in sein Romangebräu – vor allem der einst im Archivstaub wühlende Buchwurm hat in den letzten Jahren seine Thriller-Tauglichkeit bei der Aufdeckung zahlloser Vatikan-Verschwörungen unter Beweis gestellt. Hinzu kommt eine hübsche Frau, hier Journalistin, was berufsmäßige Neugier impliziert, die mordlüsterne Dunkelmänner garantiert und spannungsförderlich anzieht.
Was kann jetzt noch schief gehen? Zunächst einmal nichts, wenn man sich mit der Lektüre eines Abenteuers aus zweiter Hand begnügen möchte. Die Ausgangssituation verspricht durchaus einiges. Auch heute erzeugt allein der Klang des Wortes „Pest“ eine Gänsehaut; es scheint da so etwas wie eine kollektive Erinnerung zu geben. Dass es dafür Gründe gibt, lässt Millar erklärend einfließen: Allein zwischen 1347 und 1351 hat die Seuche in Europa schätzungsweise 25 Millionen Menschen getötet. Das war ein Drittel der damaligen Gesamtbevölkerung!
Der Autor als Thriller-Killer
Somit hat Millar eine wirkungsvolle Bedrohung aus der Vergangenheit als Aufhänger entdeckt. Jetzt geht er daran, den Pestschrecken in die Gegenwart zu tragen. Das ist gar nicht so einfach, denn das einstige Verderben ist heute heilbar. Kontinentweite Seuchenwellen können verhindert werden. Nur die Pestgruben von Nether Ditchford aufreißen zu lassen, genügt folglich nicht.
Deshalb konstruiert Millar ein Szenario, in dem die Pest erst einmal unbemerkt bleibt, damit sie sich ausbreiten kann. Dafür ist ihm nichts Besseres eingefallen als der Auftritt des weidlich bekannten Schlipsschurken, der Geld & Macht um jeden Preis ergattern will. Um sich schart er die üblichen Verdächtigen, d. h. eiskalte Killer & tumbe Totschläger.
Ihnen in den Weg stellen sich die ‚Guten‘. Sie sind idealistisch, jung, ansehnlich und tragen diese Eigenschaften quasi auf die Stirn tätowiert. Das ist auch wichtig, damit sie wenigstens ein bisschen Profil gewinnen. Denn Daniel, Therry & Rajiv haben als Figuren etwa so viel Substanz wie die Zappelmänner und -frauen deutscher TV-Thrillerserien. Sie denken und reden ausschließlich in Klischees, weil Verfasser Millar offensichtlich fürchtet, dass Originalität das möglichst breite Publikum verschrecken könnte.
Jede Figur ist auf ihre Art eine Zumutung. Daniel, der ‚Historiker‘, muss den schlauen aber versponnenen Träumer mimen, der in der Welt der Vergangenheit aufgeht. Das ist praktisch, da er mit traumwandlerischer Sicherheit jedes für die Handlung bedeutsame Dokument finden, jede Inschrift entziffern & jede mittelalterliche Analogie deuten kann. Der reale Wissenschaftler kann da nur neidisch werden.
Therry ist eine dieser politisch korrekten Überfrauen, die das Kino oder die Unterhaltungsliteratur minderer Güte terrorisieren. Selbstbewusst, ganz im Hier & Jetzt beheimatet, gesellschaftskritisch, selbstverständlich hübsch, aber deshalb erst recht tüchtig, nebenbei auf der Suche nach Mr. Right (Preisfrage: Wem wird in unserer Geschichte diese zweifelhafte Ehre zufallen?) und auch sonst eine schreckliche Nervensäge.
Unfug mit Botschaft
Darüber hinaus zwingt MillarTherry zu nicht endenden Tiraden über die Zersiedlung urbritischer Landschaftsidyllen. Wie besessen lässt er sie über skrupellose Bauunternehmer und Immobilienhaie wettern, die gute englische Wälder und Wiesen mit hässlichen, eigentlich unnötigen Neubausiedlungen überziehen. Mit Zahlen und ‚Beweisen‘ wird der Leser traktiert, den das herzlich wenig interessiert – wozu auch, da es mit der eigentlichen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat?
Rajiv tritt auf, weil „Schwarzer Winter“ aus einleuchtenden Gründen einen Mediziner im Team benötigt. Assistent muss er sein, weil er so zwar viel wissen aber wenig ausrichten kann. Außerdem ist Rajiv Inder und taugt deshalb als Proporz-Ausländer, was eine mögliche Verfilmung realistischer werden lässt. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt Millar damit, dass Rajiv ‚zufällig‘ daheim Erfahrungen mit der Pest sammeln konnte.
Bleiben die Schurken in diesem Spiel. Ach, sind Mr. Millars Bösewichte böse! Man zittert vor Angst – oder vor Lachen (Reaktionsvariante 3: Verdruss). Es ist zu putzig, wie uns der Verfasser Geoffrey Martindale als kultivierten Teufel weismachen möchte. Die Welt des Weißkragen-Verbrechens ist nach Millar höchst simpel strukturiert; er bezieht seine Kenntnisse offenbar aus dem Studium diverser John-Grisham-Verfilmungen. Weil das Böse à la Hollywood stets irgendwie übermenschlich daherkommt, reden, handeln und killen Martindale und seine Schergen in einem quasi rechtsfreien Raum. Die Polizei hält sich freundlicherweise zurück, damit Martindales Finsterlinge und unsere drei Musketiere ungestört ihre Klingen kreuzen können, bis endlich das vor allem durch seine papierraschelnden Nicht-Dramatik eindrucksvolle Finale kommt und dem unterhaltungsarmen Spuk endlich ein Ende bereitet.
Autor
Peter Millar gehört zur Gruppe jener Journalisten, die eines Tages beschließen, die Früchte ihres aufregenden Berufsalltags zu ernten bzw. in blanke Münze zu verwandeln. Wer zu den Brennpunkten der Weltgeschichte reist und darüber schreibt, hält sich ebenso oft wie fälschlich dazu prädestiniert, ein spannendes und glaubhaftes Garn zu spinnen.
Millar ist im Auftrag der „Sunday Times“ oder des „Evening Standard“ in der Tat weit herumgekommen: Berlin, Moskau, Paris, Brüssel listet die Kurzvita des Bastei-Verlags als Wirkungsstätten auf. Auch in Osteuropa ist er journalistisch aktiv gewesen. 1992 fasste er seine Erlebnisse während des Mauerfalls in einem Buch mit dem verheißungsvollen Titel „Tomorrow Belongs to Me: Life in Germany Revealed as Soap Opera“ zusammen. Diesen Erfahrungen verdanken wir außerdem den Histo-Thriller „London Wall“ (2005; dt. „Eiserne Mauer“).
Im Spionagemilieu ließ Millar 2000 seinen ersten Thriller spielen. „Stealing Thunder“ (dt. „Gottes Feuer“) bietet die übliche Holterdipolter-Hetzjagd zu Wasser, zu Lande und in der Luft, während ein historisch brisantes Rätsel – hier im Umfeld der ersten Atombombe – gelöst werden muss.
Mit seiner Familie lebt Millar in London sowie in Oxfordshire. Dort ist er – übrigens ein geborener Nordire – auch aufgewachsen, was das (Zuviel an) Lokalkolorit in „Schwarzer Winter“ erklärt.
Über seine Arbeit informiert (eher nicht) Millars (offenbar irgendwo im Rohbau steckengebliebene) Website.
Taschenbuch: 445 Seiten
Originaltitel: Bleak Midwinter (London : Bloomsbury 2001)
Übersetzung: Ulrike Werner-Richter
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: