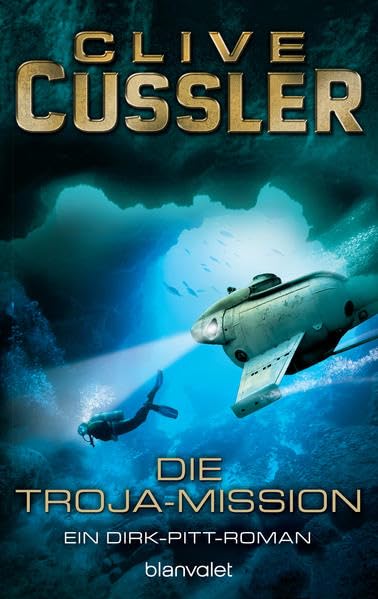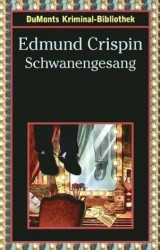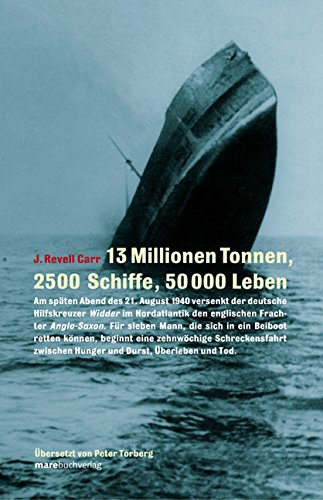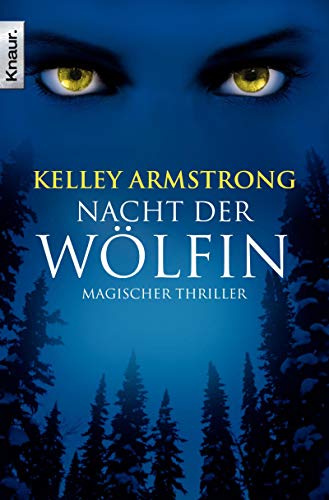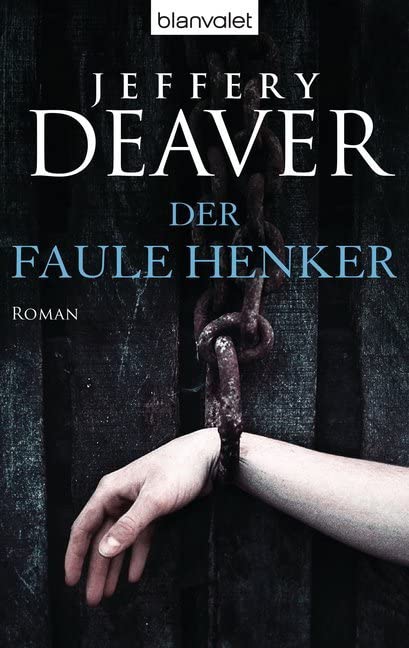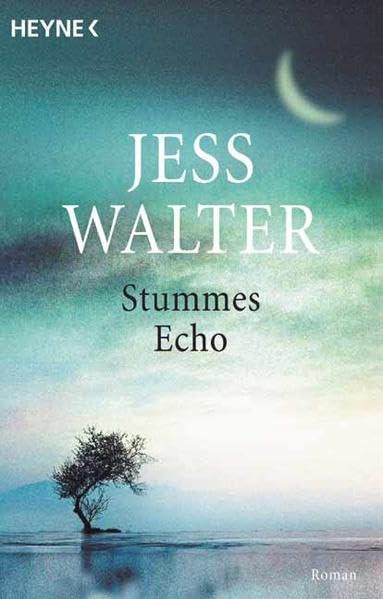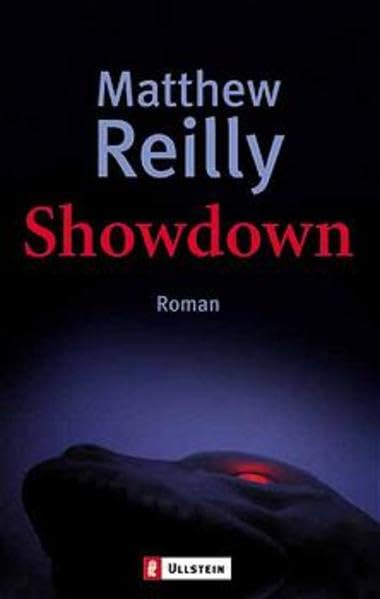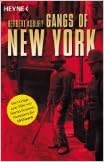Paradise ist ein winziger Flecken im US-Staat Michigan. Hierher ist der Ex-Baseballprofi und Ex-Polizist Alex McKnight nach diversen beruflichen und privaten Schicksalsschlägen gezogen und führt ein zurückgezogenes Dasein als Vermieter einiger Jagdhütten. Eine kurze Episode als Privatdetektiv endete ebenfalls in einem Fiasko: McKnight ist fertig mit der Kriminalistik und mit dem Leben.
Die selbst auferlegte Klausur endet, als Vinnie „Roter Himmel“ LeBlanc, McKnights indianischer Nachbar und Freund, ihn um Hilfe bittet. Sein Bruder Tom steckt wieder einmal in Schwierigkeiten. Er ist als Begleiter einiger Jäger in die kanadischen Wälder gezogen und dort verschwunden. McKnight soll LeBlanc bei der Suche helfen.
Der Freund schlägt ein; man macht sich auf zum Lake Agawaatese in der Provinz Ontario. Dort erfährt man Unerfreuliches: Tom ist in eine üble Gesellschaft gewalttätiger, heftig trinkender Zeitgenossen geraten, die offenbar dem Unterweltmilieu nahe stehen. Schlimmer noch: Der Jagdführer und seine fünf Begleiter sind spurlos verschwunden.
Alex und Vinnie beginnen beherzt mit Nachforschungen. Binnen kurzer Zeit haben sie die örtliche Polizei verärgert, die sich ungern von Detektiv spielenden Ausländern überrumpeln lässt. Doch als in einem Waldstück der sorgfältig versteckte Wagen der vermissten Jäger gefunden wird, muss auch der misstrauische Constable DeMers zugeben, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht.
Auf eigene Faust untersuchen Alex und Vinnie die einsam gelegene Hütte der Jagdgesellschaft. Dort finden sie Tom und seine Gefährten – grausam ermordet und nicht tief genug begraben. Der Schock ist noch nicht überwunden, da geraten sie in einen Hinterhalt. Ohne Waffen und Nahrung werden sie von unsichtbaren Mördern durch den Wald gehetzt, die alles daran setzen, die lästigen Mitwisser neben die anderen Leichen zu legen …
Womit nur der erste Höhepunkt dieses erstaunlichen Thrillers erreicht ist. Wo andere Autoren bereits auf die Zielgerade einbiegen, setzt Steve Hamilton erst richtig zum Höhenflug an. Noch mehrere aufregende Höhepunkt werden folgen, bis der Bodycount im Finale bei elf (!) Leichen steht.
Dabei bietet „Himmel voll Blut“ alles andere als eine simple Metzelstory. (Der Unheil verkündete Titel ist übrigens die Übersetzung eines indianischen Personennamens.) Selten gelingt es einem Kriminalschriftsteller, so viele Bluttaten als Kette bizarrer, aber in ihrer konsequenten Sinnlosigkeit beklemmender Ereignisse zu schildern. Die elf Menschen sterben sämtlich aus den „falschen“ Gründen. Die scheinbaren Schurken sind hier oft Opfer, im falschen Moment am falschen Ort, ihre Mörder eigentlich unzurechnungsfähig. Gewalt gebiert Gewalt: Eindrucksvoll weiß Hamilton diese uralte Binsenweisheit mit Leben zu erfüllen.
Die kanadische Wildnis stellt die grandiose Kulisse der schaurigen Handlung dar. Auch hier weicht Hamilton vom Klischee ab: „Natur“ ist für ihn kein Ort, der den Menschen Willkommen heißt. Ganz im Gegenteil; die Idylle verwandelt sich rasch in eine Hölle, geht ihr Besucher seiner Hilfsmittel und Waffen verlustig. Das schließt die indianischen Mitspieler unseres Dramas jederzeit ein. Sie sind eben keine „edlen Wilden“, die im süßlichen Einklang mit Mutter Erde am liebsten dem Rauschen der Bäume lauschen, sondern schätzen die Errungenschaft der ökologisch unkorrekten Zivilisation durchaus sehr.
Wie Volker Neuhaus (der „Himmel voll Blut“ auch übersetzt und den lakonischen Witz des Originals bewahrt hat) in seinem Nachwort schreibt, tritt Steve Hamilton in große Fußstapfen. Die Konfrontation des Entdeckers und Siedlers mit der unbekannten Natur ist ein Topos der nordamerikanischen Literatur. Kein Wunder, denn bis der riesige Kontinent in alle Richtungen „erobert“ war, gehörte die Auseinandersetzung mit wenig erfreuten Ureinwohnern, wilden Tieren, extremen Wetterverhältnissen und anderen Widrigkeiten zum Alltag in den USA und Kanada. Das musste zwangsläufig Spuren auch in der Kunst hinterlassen. Neuhaus nennt die „Lederstrumpf“-Saga (1823-41) von James Fenimore Cooper als ein Vorbild für „Himmel voll Blut“. Große Worte, aber Parallelen lassen sich in der Tat erkennen.
Diese Abenteuer-Tradition verknüpft Hamilton nun mit dem ebenfalls ehrwürdigen Genre des Detektivromans. Der „Private Eye“ tritt in den USA seit jeher agiler auf als sein europäischer Kollege. Er ist außerdem eher im gesellschaftlichen Randbereich zu finden. In gewisser Weise verkörpert er so den unabhängigen, für Recht & Ordnung sorgenden „Westerner“ der alten Pioniertage – ein Idealtyp, den es so wohl niemals gab, der aber dank Literatur und später Film zur gern eingesetzten Heldenfigur wurde.
Wobei dieser Held im 21. Jahrhundert kein strahlender mehr sein kann. Die Gegenwart ist zynisch geworden und schätzt ihre Idole mit Kratzern und Schwächen; das lässt sie „menschlicher“ wirken. Alex McKnight erfüllt diese Voraussetzungen perfekt. Er ist einsam, arm, ohne Rang und Namen. An einem öden Ort hat er sich verkrochen, nachdem seine Karriere gescheitert, jeder Neubeginn misslungen und sein Privatleben nicht mehr existent ist. Wie eine Maschine versucht er sein Leben zu führen, das allmählich aus der Bahn zu geraten beginnt.
Alex McKnight macht sich etwas vor: Er flüchtet vor dem Leben, aber das Leben wird ihn stets finden. Deshalb ist er eigentlich froh, als ihn Freund Vinnie um Hilfe bittet. Ein ausgeprägtes Helfersyndrom wurde McKnight ohnehin aufgeprägt – schon der Name verrät es dem Kundigen! Jetzt kann er seine brachliegenden Energien endlich wieder auf ein Ziel bündeln. Kein Wunder, dass er Vinnie mit manchmal masochistisch anmutender Leidensbereitschaft bis zum bitteren Ende folgt.
Auf seine Weise leidet Vinnie LeBlanc unter ähnlichen Problemen wie sein Freund. Er ist Indianer, was ihn in einem mittelmäßigen Roman als politisch korrektes Zerrbild hätte enden lassen: der gute amerikanische Ureinwohner, vom bösen Bleichgesicht in Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft verdrängt, betrogen und entmündigt.
Stattdessen ist Vinnie LeBlanc vor allem ein Mann, der in den USA lebt und zufrieden damit ist. Im Grenzgebiet zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada arteten die Auseinandersetzungen zwischen Weiß und Rot niemals so dramatisch aus wie im Westen. Deshalb leben beiden Rassen schon lange neben- und sogar miteinander. Nicht Rassismus ist daher Vinnie LeBlancs größtes Problem, sondern seine aufdringliche Verwandtschaft, vor der er aus dem Reservat geflüchtet ist, wo ein einträgliches Kasino ihm und seinem Stamm ein Leben in Wohlstand und Sicherheit bietet.
Die mit knochentrockenem Humor geführten Wortgefechte zwischen McKnight und LeBlanc gehören zu den Glanzlichtern des Romans. Sie verraten aber auch viel über die Sprachlosigkeit der Kulturen: Zwischen den „alten“ und den „neuen“ Amerikanern herrscht eher Waffenstillstand als Frieden.
Das gilt auch für das Verhältnis zwischen den US-Amerikanern und ihren kanadischen Nachbarn. Witze über Kanada gehören zum Standardrepertoire amerikanischer Komödien. Hamilton vermeidet jede Klamotte, aber er verschweigt nicht die Probleme, die aus der Rivalität zweier kulturell sehr unterschiedlicher Riesenstaaten entstehen, und nutzt sie geschickt für seine Story.
Steve Hamilton ist ein Mann, der entweder die Arbeit oder ein sicheres Einkommen liebt. Obwohl inzwischen als Schriftsteller erfolgreich, hat er seinen „richtigen“ Beruf nicht aufgegeben und ist weiterhin für den Konzern IBM tätig. Sein Herz gehörte – man liest dies wohl in jeder Autorenbiografie – jedoch seit jeher dem Fabulieren. Schon mit zwölf Jahren schickte er (erfolglos) eine erste Kurzgeschichte an das „Ellery Queen Mystery Magazine“. Seine berufliche Zukunft trieb ihn freilich wie bereits erwähnt in eine ganz andere Richtung.
Nach zehn Jahren Tätigkeit für IBM ließ sich der alte Traum vom Schreiben nicht länger unterdrücken. Hamilton belegte Kurse in einer Schreibwerkstatt. Als er damit begann, einen ersten Roman zu verfassen, ging er zielorientiert vor: Ein großer Verlag lobte für den besten Krimi eines Nachwuchs-Autoren einen Preis aus und – was noch wichtiger war – versprach die Veröffentlichung. Hamilton schrieb „A Cold Day in Paradise“ (1998; dt. „Ein kalter Tag im Paradies“), die ersten Alex McKnight-Geschichte, und gewann – auch solche Geschichten werden gern erzählt – den Wettbewerb!
Besagter Roman wurde auf Anhieb ein Verkaufserfolg. Die Kritiker liebten das Buch ebenfalls. „A Cold Day in Paradise“ gewann mit dem „Edgar Award“ und dem „Shamus Award“ gleich zwei der renommiertesten Thriller-Preise und stand auf der Vorschlagsliste für weitere.
Der Erfolg ist Steve Hamilton (der übrigens mit Frau und Familie im US-Staat New York lebt) seither treu geblieben, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich der Autor seit seinem gefeierten Erstling stetig gesteigert hat. „Blood in the Sky“, immerhin schon Band 5, gilt als der beste der Serie.
Steve Hamilton informiert über sich und sein Werk auf einer eigenen Website: http://www.authorstevehamilton.com
Die Alex-McKnight-Serie …
… erscheint in Deutschland in „DuMonts Kriminal-Bibliothek“:
1. A Cold Day in Paradise (1998; dt. „Ein kalter Tag im Paradies“) – KB Nr. 1103
2. Winter of the Wolf Moon (2000, dt. „Unter dem Wolfsmond“) – KB Nr. 1106
3. Hunting Wind (2001; dt. „Der Linkshänder“) – KB Nr. 1111
4. North of Nowhere (2002; dt. „Nördlich von Nirgendwo“) – KB Nr. 1121
5. Blood Is the Sky (2003; dt. „Himmel voll Blut“) – KB Nr. 1128
6. Ice Run (2004; noch kein dt. Titel)