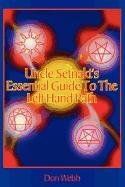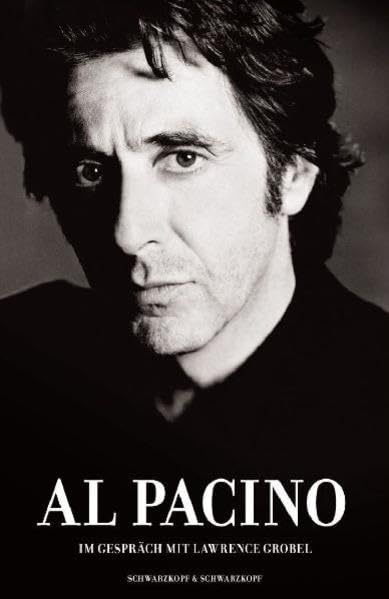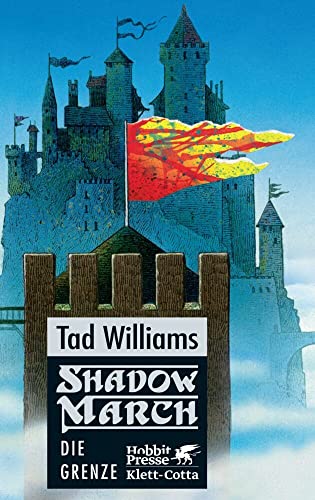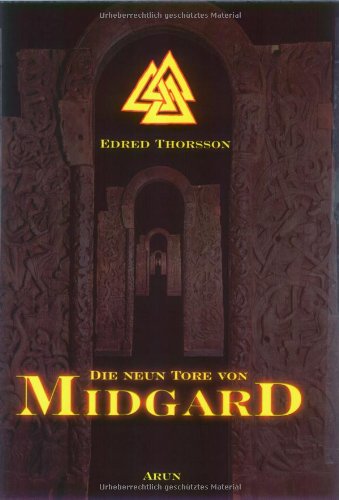Der profanen Öffentlichkeit ist der in Austin/Texas lebende Don Webb primär als Science-Fiction-Autor bekannt. Um einen kleinen Überblick seines schriftstellerischen Schaffens zu geben, seien hier exemplarisch „Spell for the Fullfillment of Desire“ (1996), „The Double. An Investigation“ (1998), „Essential Saltes. An Experiment“ (1999) und „Endless Honeymoon“ (2001) genannt. In deutscher Sprache ist von Don Webb bislang nur das seit geraumer Zeit vergriffene „Märchenland ist abgebrannt. Profane Mythen aus Milwaukee“ erschienen.
Weniger bekannt ist sein Status in der okkulten Welt als Vordenker des Setianismus – er bekleidete lange Zeit das Amt des High Priest im „Temple of Set“, bis er am 9.9.2002 von Zeena Schreck abgelöst wurde (inzwischen hat ToS-Gründer Michael Aquino das Amt wieder übernommen).
Setianismus ist eine religiöse Strömung des „Pfades zur Linken Hand“ bzw. „Left Hand Path“ (LHP) und versteht sich somit als strikte Abgrenzung zu den sog. „Weltreligionen“, welche eine Unterordnung oder sogar Auslöschung des menschlichen Individuums zugunsten eines metaphysischen Prinzips (Gott, Nirwana usw.) fordern. Die begriffliche Unterscheidung von linkshändigen und rechtshändigen Pfaden stammt ursprünglich aus dem Hindu-Tantra. Die linke Seite wird in Indien sowohl mit gesellschaftlichen Tabus als auch der dynamischen Energie des Shakti assoziiert. LHP steht im Gegensatz zum stärker verbreiteten „Right Hand Path“ (RHP) für die Bejahung der weltlichen Existenz und der Vergöttlichung des individuellen Ichs. Da die linke Hand ein interkulturell verständliches Symbol sein kann, ist der LHP gut als Universalbegriff geeignet, um westliche Strömungen wie etwa Saturngnosis oder eben Setianismus unter einer gemeinsamen Kategorie einzuordnen.
Im Zentrum des setianischen Interesses stehen persönliche Autonomie und willentliche Selbsterschaffung. Das mythologische Ideal dieses Prinzips ist der ägyptische Wüstengott Seth, welcher seine Geburt selbst einleitete und gegen kulturelle („städtische“) Normen opponiert, aber auch diejenigen Menschen, welche durch die Wüste reisen, beschützt. Seine Hauptkontrahenten sind die Dämonenschlange Apophis (das ungebändigte Chaos) und Osiris, der „sterbende Gott“ (mythologische Parallelen zwischen Osiris und Jesus Christus sind unverkennbar), welcher die Stasis repräsentiert. Ob Seth dabei als tatsächliche Entität oder als archetypisches Prinzip interpretiert wird, ist aus setianischer Sicht nebensächlich. Seth, der auch als „Fürst der Finsternis“ oder „Feind der Götter“ bezeichnet wird, sucht nicht nach Anbetung, sondern nach Individuen, die von „seiner Art“ sind. Der Logos Aionos von Seth ist „Xeper“, ein altägyptisches Verb, welches übersetzt in etwa „ich bin geworden“ bedeutet und rückwirkend die persönlichen Fortschritte eines Setianers bezeichnet. Dies nur als Erläuterung zu dem religiösen Umfeld, aus welchem Don Webb stammt (wer sich für diese Thematik interessiert, kann sich unter http://www.xeper.org näher informieren).
„Uncle Setnakt`s Essential Guide To The Left Hand Path“ ist jedoch mitnichten ein rein setianisches Buch. Don Webb gibt in dieser Abhandlung vielmehr – wie der Titel schon andeutet – einen Einblick in die allgemeine Praxis des (westlichen) Pfades zur Linken Hand. „Praxis“ ist hier der maßgebliche Begriff – das Buch soll weder umfassend über die kulturellen Hintergründe des LHP informieren, noch den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben. Diesen beiden Kriterien hat bereits Don Webbs Kollege Stephen Flowers in seiner theoretischen Abhandlung „Lords of the Left Hand Path“ erfüllt. Der „Essential Guide“ hingegen hat für den geneigten Leser nur dann einen echten Wert, wenn er nach der Lektüre die Ärmel hochkrempelt und die vorgestellten Praktiken konsequent realisiert. LHP ist keine Religion für die „schlecht weggekommenen“, sondern ein Pfad für Individualisten, die bereit sind, für ihr persönliches Glück hart zu arbeiten – dies macht Don Webb unmissverständlich klar.
Dennoch kommt auch der Humor nicht zu kurz, denn LHP soll in erster Linie Lebensfreude bereiten. „Uncle Setnakt“ ist ein Pseudonym, unter welchem Don Webb einst eine humoristische Kolumne namens „Uncle Setnakt says“ schrieb, da er es leid war, die Prinzipien des LHP ausschließlich in wissenschaftlicher (und somit häufig auch ziemlich trockener) Manier zu verdeutlichen. Im „Essential Guide“ setzt „Onkel“ Webb diese Tradition fort.
Das Buch gliedert sich in vier Hauptteile. Der erste Teil, „The Nature and Goals of the Left Hand Path“, liefert die theoretische Basis für die nachfolgenden Kapitel. Don Webb erläutert hier, was Initiation im Sinne des LHP ist und wie sie funktioniert. Er diskutiert u.a. das Prinzip individueller Souveränität, die Position des Ichs im Kosmos, die Psychologie der Initiation sowie ihre „Tugenden“ und „Laster“, das Wesen der Magie und eine inhaltliche Abgrenzung zum Pfad zur Rechten Hand (RHP).
Der zweite Teil, „Practise“, vermittelt einen Katalog von LHP-konformen Aktivitäten und persönlichen Charaktereigenschaften, welche die Initiation eines LHP-Adepten begünstigen oder sogar erst ermöglichen. Wer bereits auf diesem Pfade unterwegs ist, wird garantiert erkennen, dass er bereits einige der genannten Dinge in sein Leben integriert hat.
Der dritte Teil, „The Grand Initiation“, nimmt rund 40 Seiten ein. Es handelt sich dabei um eine Art Einweihungsritus, welchen Don Webb persönlich entwickelt hat. Er ist nicht obligatorisch, aber wer eine größere Herausforderung sucht, und Gefallen an Webbs Ritualen gefunden hat, wird hier sicherlich etwas für sich herausziehen können. Zusätzlich kann der Leser hier etwas über das Konzept von Xeper erfahren. Die „Grand Initiation“ richtet sich allerdings an Fortgeschrittene, weshalb es mir etwas unklar ist, weshalb Don Webb sie nicht als letztes Kapitel oder Anhang verwendet hat.
Der vierte und letzte Teil, „Resources“, vermittelt dem Leser ein paar nützliche Werkzeuge für seine persönliche Initiation.
„Onkel Setnakts Handorakel“ ist dabei noch eher als Gimmick zu sehen, denn der Initiand kann hiermit Lösungsansätze für seine Probleme erwürfeln. Wer dem mit einem ironischen Augenzwinkern begegnen kann, wird jedoch durchaus mit ein paar konstruktiven Ideen beglückt werden. Ferner vermittelt Don Webb ein paar wirklich gute Lesetipps und erklärt exemplarisch anhand einer kurzen Geschichte, wie der Weg einer oder eines Initiierten verlaufen kann. Ein paar FAQ zum LHP können Neuligen dabei helfen, ihre eigene Position präziser zu bestimmen. Fortgeschrittene werden schließlich in der Lage sein, eine für sie selbst passendere Literatur- oder FAQ-Liste zu erstellen – und somit die Komplexität des LHP erweitern.
Abschließend gibt Don Webb einen kurzen Einblick in die Lehren des Temple of Set. Er will damit jedoch keinesfalls missionieren, sondern ein gutes Beispiel für eine renommierte LHP-Institution geben. Man kann den LHP nur für sich selbst beschreiten, aber ab einem gewissen Punkt benötigt jeder Initiand eine professionelle Schulung durch andere, wenn er oder sie nicht stagnieren will.
Es scheint mir evident zu sein, dass ein solches Buch polarisieren muss – jeder muss selbst herausfinden, ob er oder sie dem LHP etwas abgewinnen kann. Don Webbs „Uncle Setnakt`s Essential Guide To The Left Hand Path“ ist neben Frank Lerchs „Nightworks“ jedenfalls definitiv das beste praxisorientierte Buch über den Pfad zur Linken Hand, welches mir bislang untergekommen ist. Wie Stephen Flowers treffend in seiner Einleitung bemerkt:
„[Don Webb] reiht nicht einfach nur Wörter aneinander, um seinen Lesern Vergnügen zu bereiten und sie zu unterhalten – obgleich er dieses auch tut – er bietet dir mit diesem Führer das größte Abenteuer an, welches das Leben zu bieten hat.“
Taschenbuch: 120 Seiten
ISBN-13: 9781885972101
Der Autor vergibt: