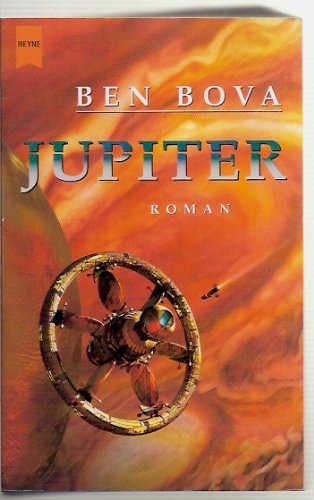Gibt es intelligentes außerirdisches Leben auf dem Riesenplaneten Jupiter? Und falls ja, darf man dann darüber sprechen? Eine knifflige politisch-religöse Frage, mit der sich der Astrophysiker Grant Archer auseinandersetzen muss – denn die christlichen und islamischen Fundamentalisten der Erde betrachten intelligente Aliens als Gotteslästerung.
Während in „Venus“ die dramatische Handlung derart überwog, dass die menschlichen Klischees das wissenschaftliche Interesse erdrückten, gelingt es Bova in „Jupiter“, das Ruder herumzureißen und einen ordentlichen Roman über eine lebensgefährliche Forschungsexpedition ins Innere des Riesenplaneten abzuliefern.
Der Autor
Ben Bova ist Jahrgang 1932 und ein verdammt erfahrener Bursche. 1956 bis 1971 arbeitete er als technischer Redakteur für die NASA und ein Forschungslabor, bevor er die Nachfolge des bekanntesten Science-Fiction-Herausgebers aller Zeiten antreten durfte, die von John W. Campbell. Campbell war die Grundlage für das „Goldene Zeitalter der Science-Fiction“, indem er mit seinem Magazin „Analog Science Fiction“ jungen Autoren wie Asimov, Heinlein, van Vogt und anderen ein Forum gab. Hier entstanden der „Foundation“-Zyklus und andere Future-History-Zyklen.
Für seine Herausgeberschaft von |Analog| wurde Bova sechsmal (von 1973-79) mit einem der beiden wichtigsten Preise der Science-Fiction ausgezeichnet, dem |Hugo Gernsback Award|. Von 1978-82 gab er das Technik-&-Fiction-Magazin „Omni“ heraus. 1990-92 sprach er für alle Science-Fiction-Autoren Amerikas in seiner Eigenschaft als Präsident der Berufsvereinigung. Seit 1959 hat er eigene Bücher veröffentlicht, die sich oftmals an ein jugendliches Publikum richten, darunter die Kinsman- und Exiles-Zyklen.
Ebenso wie Robert A. Heinlein und Larry Niven ist Bova ein Verfechter der Idee, dass die Menschheit den Raum erobern muss, um überleben zu können. Und dies wird nur dann geschehen, wenn sich die Regierung zurückzieht und die Wirtschaft den Job übernimmt. Der Brite Stephen Baxter hat in seiner Multiversum-Trilogie389 diese Idee aufgegriffen und weiterentwickelt.
1992 begann Bova mit der Veröffentlichung seines bislang ehrgeizigsten Projekts: die Eroberung des Sonnensystems in möglichst detaillierter und doch abenteuerlicher Erzählform: „The Grand Tour“. Folgende Bände sind bislang erschienen:
The Grand Tour
1 Powersat (2005)
2 Empire Builders (1993)
4 Mars (1992)
Deutsch: Mars. Übersetzt von Peter Robert. Heyne SF&F #6332, 1999, ISBN 3-453-16174-2.
6 Return to Mars (1999)
Deutsch: Rückkehr zum Mars. Übersetzt von Peter Robert. Heyne SF&F #6375, 2001, ISBN 3-453-18769-5.
8 Jupiter (2000)
Deutsch: Jupiter. Übersetzt von Walter Brumm. Heyne SF&F #6416, 2002, ISBN 3-453-21349-1.
11 Saturn (2003)
Deutsch: Saturn. Übersetzt von Martin Gilbert. Heyne SF&F #6467, 2004, ISBN 3-453-87916-3.
12 Titan (2006)
14 Mercury (2005)
15 Mars Life (2008)
16 Venus (2000)
Deutsch: Venus. Übersetzt von Martin Gilbert. Heyne SF&F #6388, 2002, ISBN 3-453-19677-5.
18 Leviathans of Jupiter (2011)
19 Farside (2013)
20 Earth (2019)
Tales of the Grand Tour (2004)
A Grand Tour Collection (Sammelausgabe von 10 Romanen und einem Erzählband; 2018)
The Asteroid Wars:
1 The Precipice (2001)
Deutsch: Der Asteroidenkrieg. Übersetzt von Martin Gilbert. Heyne SF&F #6446, 2003, ISBN 3-453-87071-9.
2 The Rock Rats (2002)
Deutsch: Asteroidensturm. Übersetzt von Martin Gilbert. Heyne SF&F #6482, 2004, ISBN 3-453-52013-0.
3 The Silent War (2004)
Deutsch: Asteroidenfeuer. Übersetzt von Martin Gilbert. Heyne SF & F #52103, 2005, ISBN 3-453-52103-X.
4 The Aftermath (2007)
The Asteroid Wars (Sammelausgabe von 1–3; 2004)
Es fehlen also noch Romane über die äußeren Planeten Neptun, Uranus und Pluto.
Diese Auswärts-Bewegung spiegelt sich im Werk anderer Science-Fiction-Autoren. So hat der Schotte Ken MacLeod mit „Das Sternenprogramm“ (Rezension), „Die Mars-Stadt“ und „Die Cassini-Division“ einen ähnlichen Zyklus vorgelegt. Allerdings ist seine politische Überzeugung der Ben Bovas genau entgegengesetzt: MacLeods Figuren sind Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten!
Handlung
Die Fundamentalisten
Am Ende des 21. Jahrhunderts ist der religiöse Fundamentalismus auf der ganzen Welt die dominante politische Strömung. In den USA gibt die so genannte Neue Ethik (NE) den Ton an, mit dem Argument, dass der Mensch so verantwortungslos wie bisher nicht mehr mit der göttlichen Schöpfung umspringen könne – die zehn Milliarden Erdenbewohner müssten endlich die göttlichen Gebote beachten. Die NE verbreitet die Lehre des Kreationismus: Gott schuf die Welt in sechs Tagen und den Menschen nach seinem Ebenbild. Die Wissenschaft des Menschen darf nicht mehr alles erforschen, geschweige denn „Irrlehren“ wie Darwins Evolutionstheorie verbreiten.
Doch beunruhigende Nachrichten kommen von der Jupiterstation Gold: Dort gehen ungenehmigte Dinge vor, womöglich gefährliche. Als der junge und frisch verheiratete Astrophysiker Grant Archer daher zum NE-Regionaldirektor Beech berufen wird, der ihm befiehlt, zum Jupiter zu fliegen, ist er sich sicher, dass ein Riesenfehler gemacht wird. Er kommt sich vor wie Herr K. in Kafkas „Prozess“. Zu allem Überfluss soll er als Spion der NE zum Jupiter fliegen.
Doch alle Proteste fruchten nichts. Während seine Frau Marjorie für die Friedenstruppen auf der Erde arbeitet, muss Grant zur Jupiterstation – allein die langweilige Hinreise dauert Monate. Und das Leben auf der Station wird von einem Diktator namens Dr. Wo wie weiland Käptn Ahab [(„Moby Dick“) 1144 regiert. Besser, man legt sich nicht mit ihm an. Wie Ahab hat auch Dr. Wo ein Beinproblem: Nach einem schweren Unfall mit der bemannten Jupitersonde sind seine beiden Beine fast vollständig gelähmt. Doch mit Hilfe von Training und implantierten Biochips kann Dr. Wo durchaus stehen.
Das Geheimnis
Aha, eine geheime Tauchsonde! Das war also das unbekannte Gebilde, das Grant beim Anflug auf die Station an deren Ring gesehen hatte. Und was sucht Dr. Wo mit der Tauchsonde? Natürlich außerirdisches Leben. Solange dieses nicht intelligent ist, ist das nicht verboten. (Man merkt hier schon die Absurditäten der Neuen Ethik.) In der gigantischen Atmosphäre des Riesenplaneten hat man bislang die schwebenden Medusen entdeckt, die schon Arthur C. Clarke in seiner Novelle „Treffen mit Medusa“ beschrieben hatte.
Doch weit unterhalb der Lebensebene der Medusen hat Dr. Wo einen flüssigen Ozean entdeckt und Aufnahmen von blinkenden Lichtern gemacht. Also muss jetzt eine zweite Expedition nachsehen, was es mit diesen Lichtern auf sich hat. Nachdem Grant sich bewährt hat und als Wissenschaftler auf der Station anerkannt ist, nimmt ihn Dr. Wo – quasi als Ritterschlag – in sein Tauchteam auf. Nachdem jedoch der zweite Tauchversuch wegen eines vergifteten Mitglieds (etwa ein Anschlag verkappter NE-Fanatiker an Bord?) abgebrochen werden musste, rekrutiert Dr. Wo den jungen Grant, der sich als Missionstechniker schon mit dem Ablauf usw. auskennt.
Die Mission
Jetzt geht es also los! Endlich kann Grant eine fremde Welt selbst erforschen! Doch er hat eine Scheißangst. Denn erstens atmet man in der Sonde wegen des immensen Außendrucks nicht Luft, sondern eine kalte schleimige Flüssigkeit namens Perfluorcarbon (genau wie Ed Harris in James Camerons „Abyss“) – bei der Umstellung von Luft auf PFCL steht man Todesängste durch. Und zweitens scheint die Kapselkommandantin, Dr. Krebs, nicht ganz in Ordnung zu sein: Dass sie eine Diktatorin ist, ist okay: kennt man schon von Dr. Wo. Dass sie einen nicht sieht, wenn sie nicht per Biochip mit dem Bordcomputer verbunden ist, ist da schon etwas beunruhigender.
Dafür fühlt man sich dann aber wie Gott!, findet Grant. Denn durch die implantierten Biochips ist sein Gehirn direkt mit den Bordsystemen verbunden. Sozusagen im Cyberspace spürt er die Power des Reaktors und der Triebwerke. So gerüstet, geht’s ab zu Grants turbulentester Tauchfahrt seines Lebens.
Leviathan
Ich verrate hier nichts Geheimes, wenn ich euch Leviathan vorstelle, das intelligente außerirdische Lebewesen, das mit seiner Sippe den Jupiterozean durchschwimmt. Leviathan wird in mehreren kurzen Kapiteln schon am Anfang des Buches vorgestellt. Er ist ein Gestaltwesen, das aus einer Aggregation spezialisierter Einzelwesen besteht. Manche seiner Bestandteile sind also für die Fortbewegung zuständig, andere für die Nahrungsaufnahme, wieder andere für die intellektuellen Funktionen.
Da Leviathan – benannt nach dem mythischen Meereswesen aus der Bibel – ein neugieriger junger Bursche ist, hat er sich ein wenig zu weit von der Herde entfernt. Er hat schon von der ersten Sonde gehört, die im Ozean aufgetaucht ist. Das Schicksal (und der Autor) will es, dass Leviathan auf die menschliche Tauchkapsel trifft – eine Begegnung, die das Sonnensystem verändern wird und Grant Archer, den NE-Spion, vor eine schwere Entscheidung stellt.
Mein Eindruck
„Jupiter“ weist also durchaus eine plausible und vor allem im zweiten Teil spannende Handlung auf, die so manchem Science-Fiction-Freund schmecken dürfte: Auf so spannende Missionen durfte man in letzter Zeit lange warten, zumal wenn sie mit so fundierten Erkenntnissen angereichert sind. Natürlich sind Medusen, Leviathane und Jupiterhaie erfunden – dichterische Freiheit. Sie sind ja das Salz in der Suppe, die der Mission des Grant Archer die Krone aufsetzen.
Man muss kein gläubiger Christ sein, um die christliche Einstellung Grants akzeptieren oder gar tolerieren zu können. Auch die Zitate aus den Psalmen, die jedem der fünf Buchteile als Motto vorangestellt sind, stören nicht allzu sehr – sie verleihen der Story das Flair der fünfziger Jahre, als die Welt noch halbwegs in Ordnung war (und einige der besten Science-Fiction-Geschichten geschrieben wurden).
Wissenschaft zwischen Wahrheitsfindung und politischer Verantwortung – so lautet der grundlegende Konflikt, auf den Punkt gebracht, mit dem sich der Autor in diesem Roman beschäftigt. Der Konflikt wird in dem Helden der Handlung, Grant Archer, exemplarisch ausgetragen. Von den Fundamentalisten der NE als Spion entsandt, sieht sich der Wissenschaftler doch auch der Neugierde und dem Forschen nach Wahrheit verpflichtet. Und was noch wichtiger ist: In der Arbeit mit einem intelligent gemachten Gorillaweibchen entwickelt er ein Verantwortungsgefühl für nichtmenschliche Intelligenz. Grant kann dies durchaus mit seinem christlichen Glauben vereinbaren, dann er sagt sich, dass auch dies zu Gottes Werk gehört – und wer ist der Mensch, dass er über Gottes Werke zu Gericht säße?
So könnte also auch ein guter Roman des frühen Heinlein (zwischen 1947 und 1958) aussehen, wenn er denn weiterschriebe. Die Missionsvorbereitung und die Jupitermission selbst haben mich an etliche Erkundungs-Storys erinnert, natürlich an „Treffen mit Medusa“, aber auch an das beklemmende und furchterregende „Projekt Luna“ (Rogue Moon) des Amerikaners Algis Budrys. Da merkt man, dass die Erkundungsfahrt in eine so fremde Welt wie Jupiter auch eine Fahrt ins Herz der Finsternis sein kann – und damit ist nicht nur die äußere Finsternis gemeint. Die Auseinandersetzung mit der blinden Kapselkommandantin erzeugt ein Gefühl der Paranoia, wie es wohl an Bord so manchen U-Boots vorkommen könnte. Es gemahnt an die Stimmung auf der „Pequod“, dem todgeweihten Schiff des buchstäblich verdammten Käptn Ahab in „Moby Dick“. Motive dieses Meisterwerks von Melville ziehen sich durch den ganzen Roman und wären eine nähere Untersuchung wert.
Unterm Strich
„Jupiter“ mag zwar manchen logischen Schwachpunkt aufweisen (dichterische Freiheiten), doch bietet der Roman insgesamt hohe Spannung, die aus einer (menschlich und wissenschaftlich) plausiblen Handlung erzeugt wird, die vor einer möglichen Welt des Fundamentalismus als Hintergrund spielt. Ich jedenfalls konnte das Buch auf den letzten hundert Seiten – der Beschreibung der Mission – nicht mehr aus der Hand legen. Ich denke, dafür lohnt sich der Kauf.
Leute, denen sich beim Wort „Gott“ die Zehennägel aufrollen, sollten aber tunlichst die Finger davon lassen.
Taschenbuch: 526 Seiten
Originaltitel: Jupiter, 2000
Aus dem US-Englischen übertragen von Walter Brumm
ISBN-13: 9783453213494
www.heyne.de
Der Autor vergibt: