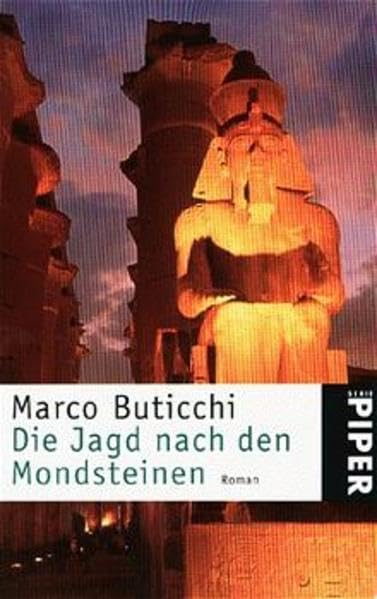Die „Mondsteine“: drei Stelen, gegossen aus purem Gold in menschenähnliche Gestalt, doch mit ‚Köpfen‘, die wie der zunehmende, der volle und der abnehmende Mond geformt sind. Die Entstehungsgeschichte der wertvollen Stücke ist ungeklärt; schon als sie im 1. Jahrhundert nach Christus erstmals schriftlich erwähnt werden, gelten sie als uralt. Entstanden sein sollen sie einst in der kleinen römischen Stadt Luna anlässlich des Todes eines Hohen Priesters, den die Göttin Minerva höchstpersönlich ins Jenseits entrückt haben soll. Als Erinnerung an diese Himmelfahrt blieben die Mondstelen zurück. Sie wurden von der Familie besagten Priesters geborgen und seither vom Vater an den ältesten Sohn weitergegeben.
So lautet jedenfalls die Geschichte, die Iunius von Luna seinem General und Freund Marcius erzählt, nachdem es im Jahre 77 n. Chr. an ihm ist, die goldenen Statuen zu hüten. Iunius hat sich auf zahlreichen Feldzügen ausgezeichnet, die das mächtige Römische Imperium unter Imperator Vespasian gegen die Germanen führte. Bis zum Tribun hat es Iunius gebracht, der nun er seinen General in die Hauptstadt Rom begleitet, wo dieser ein hohes politisches Amt anstrebt.
Freilich stellen Marcius und sein Ratgeber fest, dass die Schlachtfelder Germaniens nicht annähernd so heimtückisch sind wie das politische Parkett von Rom. Intrigen und Verrat, aber auch die verbotene Liebe zur Vestalin Clelia werden Iunius die Freiheit, sein Ansehen, fast das Leben und die Mondsteine kosten. Doch es ist, wie Iunius‘ Vater es dem Sohn überlieferte: Eine geheimnisvolle Kraft sorgt dafür, dass die drei Statuen immer zu ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückkehren.
Die Macht der Mondsteine muss sich in den folgenden Jahrhunderten mehr als einmal bewähren. Immer wieder verschwinden sie, stürzen die Nachfahren des Iunius in aufregende Abenteuer oder gar ins Verderben. Sie tauchen im spanischen Südamerika des beginnenden 17. Jahrhunderts auf, nur um wenig später mit einem Schatzschiff des Königs in den Fluten der Karibischen See zu versinken. Dreihundert Jahre später entdeckt sie dort ein reicher deutscher Globetrotter, dem nichts Besseres einfällt, als sie seinem Idol als Geschenk zu überreichen – einem aufstrebenden Politiker namens Adolf Hitler …
Breit getretener (Historien-) Quark
„Die Jagd nach den Mondsteinen“ ist ein Roman, dessen Titel ein wenig missverständlich ist. Niemand jagt die wertvollen Statuen jemals wirklich; ihr hervorstechendes Merkmal ist ja ihre seltsame Fähigkeit, stets wie durch Zauberhand auf der Bildfläche zu erscheinen und wieder zu verschwinden. Dabei bleiben sie völlig passiv. Unruhig sind höchstens die Ereignisse, die sich in ihrem Umfeld abspielen, ohne mit ihnen direkt zu tun zu haben.
Zweitausend Jahre Geschichte werden erzählt, wobei sich der Autor klugerweise auf einige Episoden beschränkt. „Die Jagd nach den Mondsteinen“ ist dennoch ein dickes Buch. Das ist typisch für den Historienroman, der sich zu einem guten Teil selbst erzählt, da die Kulisse bereits ‚steht‘ und nur ausgestaltet werden muss. Dennoch könnte die „Jagd“ deutlich kürzer ausfallen. Neuling, der er als Autor ist, legt Marco Buticchi mehrere Handlungsstränge an, die er nur lose verklammert aber im Grunde nie wirklich miteinander verwebt.
Noch am besten entwickelt ist die fiktive Biographie des Römers Iunius, während die Episode um den Schiffbruch der „Santa Esmeralda“ im Jahre 1622 ihre aufwändig eingeführten Figuren wie nebenbei aus der Handlung entlässt. Noch auffälliger wird das Fehlen einer durchkonstruierten Erzählstruktur in der Nebenhandlung um „U 115“ im Jahre 1945, die für das eigentliche Geschehen völlig überflüssig ist.
Unterhaltung: trivial aber bunt
Lässliche Sünden, möchte man meinen, kann „Die Jagd nach den Mondsteinen“, als Romandebüt des Archäologen und Weltreisenden Marco Buticchi (geb. 1957) doch mit farbigen Charakteren und vorzüglich recherchierten Schauplätzen aufwarten. Das sichtlich aber nicht aufdringlich eingeflossene Fachwissen harmoniert mit dem Charme der entwaffnend unbekümmerten Mär. Von der Rekonstruktion des imperialen Rom bis zur Darstellung einer modernen Tiefsee-Wrackbergung wirkt das Geschehen stimmig und wird durch permanente Bewegung in Schwung gehalten
Die simple Figurenzeichnung nicht gar zu störend ins Gewicht. Natürlich sind sämtliche weiblichen Hauptfiguren politisch korrekt aktiv und selbstbewusst, darüber hinaus aber auch bildhübsch und – nach jeweils reiflicher Überlegung – für ein erotisches Intermezzo zu begeistern, was im Lektürefluss immer wieder für romantische (oder – je nach Interpretation – retardierende) Einschübe sorgt. So etwas würde sich im Kino oder Fernsehen – eine drei- bis vierteilige Mini-Serie sollte es werden – gewiss gut machen. Die Bösen sind dagegen niederträchtig und hässlich und halten sich gern im Schatten auf, bis sie zu allen Zeiten zuverlässig die Gerechtigkeit ereilt: Buticchi hält nichts von zu viel Realität; in seiner Geschichte hat er das Sagen und sorgt dafür, dass wenigstens hier das Gute triumphiert.
Aus den Nähten gequollen
Bei aller barocken Pracht ist Buticchi seine Geschichte indes an einigen Stellen außer Kontrolle geraten. Bereits die Geschichte des Iunius schwelgt allzu gern in Anekdoten, die den Fachmann erfreuen, während sie den Erzählfluss deutlich hemmen. Dazu schleicht sich Rührseligkeit dort ein, wo eigentliche große Gefühle vermittelt werden sollen; hier liegen eindeutig nicht Buticchis Stärken!
Die Pferde sind mit dem Verfasser dort durchgegangen, wo er wagemutig aber ungeschickt den Historienroman mit dem Politthriller zu vermischen versucht. Er schreckt nicht einmal davor zurück, aktuelles Weltgeschehen als Folge finsterer Machenschaften entsprechender Geheimbünde umzudeuten. Dabei gerät Buticchi eindeutig auf Terrain, das er besser hätte meiden sollen.
Die finale Rettung der Erde in den Tiefen des Alls – nun wildert der Autor im Genre Science Fiction – liest sich in ihrer Unbeholfenheit noch recht amüsant. Kritischer ist aber Buticchis Leichtfertigkeit im Umgang mit der jüngeren Zeitgeschichte zu werten.
Die nun wieder!
Das „Dritte Reich“ und die Nazis bilden seit Jahrzehnten einen soliden Stützpfeiler der modernen Unterhaltungsindustrie. Dabei gilt es zu differenzieren, was vielen Kritikern nicht gelingt: zwischen den historisch belegten, furchtbar banalen Massenmördern und „den Nazis“, die in der Literatur, im Film, im Comic usw. die Rolle des ultimativen Bösen spielen.
Diese Nazis haben mit ihren realen Vorbildern so gut wie nichts gemeinsam, was sehr schön in den „Indiana-Jones“-Filmen deutlich wird. Meist wird das schon in einer trivial übertriebenen Darstellung deutlich. Dennoch reagiert man hierzulande natürlich empfindlicher als im Ausland auf allzu große Freiheiten.
Buticchi konnte jedenfalls der Verlockung nicht verzichten, Hitler und Konsorten in die Handlung einzuflechten. Musste er den „Führer“ aber wirklich aus den Ruinen Berlins in die Vereinigten Staaten fliehen und ihn dort als wohlhabenden Rinderzüchter seinen Lebensabend genießen lassen? (Buticchi lässt leider offen, was er dort getrieben haben mag – regelmäßig eine Herde nach Paraguay getrieben und dort mit Dr. Mengele die BSE-Seuche ausgebrütet, um auf den Trümmern einer rinderfreien Welt ein „Viertes Reich“ zu gründen?) Das ist einfach lächerlich, im Rahmen der Handlung definitiv überflüssig und wird zudem mit einem weiteren Schwall atemlos vorgetragener „sensationeller“ Enthüllungen verramscht.
In welchem Maße der Kolportage-Charakter des Romans durch die bestenfalls solide, (zu) oft jedoch hausbackene oder sogar verfälschende Übersetzung unnötig verstärkt wird („‚Leb wohl, wunderschöne Laura‘, hörte sie die verrückt gewordene Stimme des Manns sagen“), muss offen bleiben.
Kennen wir das nicht?
Interessant sind die offensichtlichen inhaltlichen Parallelen des Iunius-Erzählstranges mit der Handlung des Erfolgsfilms „Gladiator“ (2000). Buticchi ist eindeutig früher an die Öffentlichkeit getreten als Ridley Scott, der sich hier möglicherweise ‚inspirieren‘ ließ. Andererseits hat Hollywood die Geschichte vom unbescholtenen Mann, der unschuldig zum Sklaven wird und sich in der Arena wiederfindet, schon früher (z. B. in „Ben Hur“, 1926 und 1959, oder „Barrabas“, 1961) und seither immer wieder (siehe „Spartacus“) gern erzählt, so dass dieses Motiv wohl verselbstständigt hat.
Grundsätzlich ist „Die Jagd nach den Mondsteinen“ ein Abenteuer, das sich mit dem oft überstrapazierten Attribut „prall“ gut beschreiben lässt und viele oberflächliche aber vergnügliche Lektürestunden garantiert. Nach einem Sinn in dem bunten Tumult zu fahnden, den die Geschichte darstellt, sollte man allerdings vermeiden.
Taschenbuch: 540 Seiten
Originaltitel: Le Pietre della Luna (Mailand : Longanesi & C. 1997)
Übersetzung: Christel Galliani
http://www.piper.de
Der Autor vergibt: