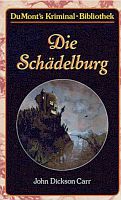Trutzig ragt Burg Schädel unweit von Koblenz hoch über dem Rhein auf, wo sie vor einem halben Jahrtausend ein gefürchteter Hexenmeister errichten ließ. Der verrufene Ort wurde zum idealen Heim für den großen Bühnenmagier Maleger, der privat ein Ekel und Sonderling. 1913 – vor 17 Jahren – ist er während der Anreise zur Burg angeblich in den Fluss gestürzt, aus dem man seine ebenso angebliche Leiche zog.
Burg Schädel ging an Myron Alison, den berühmten Schauspieler, und seinen Freund, den Finanzmagnaten Jérôme D’Aunay. Viel Freude bereitete ihnen das Erbe nicht. Alison fand man kürzlich unterhalb der Mauern; man hatte ihn angeschossen, mit Benzin übergossen und angesteckt. Als lebende Fackel taumelte er über die Zinnen, während ein gespenstischer Schatten dies beobachtet haben soll.
D’Aunay heuert einen der besten Kriminalisten Europas an: Henri Bencolin ist eigentlich Chef der Pariser Kriminalpolizei, aber das Rätsel lockt ihn. Begleitet wird er von seinem Assistenten Jeff Marle, dem sich während der Anreise in Deutschland der Journalist Brian Gallivan offenbarte. Er hatte einst als Manager für Maleger gearbeitet. An dessen Tod mag er nicht glauben; der alte Fuchs könnte sein Ende vorgetäuscht haben und seither auf der Burg sein Unwesen treiben.
Alisons Haus unterhalb der Burg ist nicht nur das Heim diverser Familienangehöriger, sondern wird auch von Freunden beiderlei Geschlechts bewohnt. Alle Anwesenden sind verdächtig. Der Verstorbene hütete gefährliche Geheimnisse, und auch D’Aunay weiß mehr, als er zugeben will. Bencolins alter Gegenspieler, der deutsche Kriminalist Baron Sigmund von Arnheim, erscheint auf der Bildfläche und nimmt an einer nächtlichen Begehung von Burg Schädel teil. Dort stößt man auf die in Ketten aufgehängte Leiche des Verwalters: ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Ermittler besser beeilen, bevor der gespenstische Täter für weitere Opfer sorgt …
Stimmung vor Logik
Alte Burgen in romantisch-spukhafter Landschaft: Sie waren John Dickson Carrs lebenslange Leidenschaft Er verwandelte sie vor allem in seinen großen Jahren in Schauplätze spektakulär vertrackter Rätsel-Krimis, in denen sehr lebendige Mörder und rachsüchtige Gespenster scheinbar Seite an Seite ihr Unwesen trieben.
Die Liebe des Verfassers zu solchen Stätten spricht aus jeder Zeile der „Schädelburg“. Gerade 25 Jahre alt war John Dickson Carr, als dieses Buch – sein drittes – 1931 erschien. Diese Tatsache sollten sich allzu strenge Kritiker vor Augen halten. Vor allem im Hinblick auf einen ‚logisch‘ aufgebauten Plot bietet die „Schädelburg“ dem Puristen in der Tat Anlass zum Stirnrunzeln. Herausgeber Volker Neuhaus weist in seinem informationsreichen Nachwort u. a. auf Carrs absolute Unkenntnis der deutschen Polizeiorganisation hin.
Jedes Ding hat indes bekanntlich zwei Seiten. Der absurde Plot wirkt im Verbund mit der absoluten Künstlichkeit der Kulisse wieder reizvoll. „Die Schädelburg“ erzählt wie so mancher frühe Carr-Roman eine Geschichte, die der Realität örtlich wie zeitlich völlig enthoben scheint. Der Autor kannte Deutschland zwar, denn er bereiste gern Europa, doch er ignorierte die Realität zugunsten einer Fantasie, die in einem romantischen Niemandsland spielt, dessen Bürger ständig traurige Volksweisen singen, Bier trinken und Butterbrote essen.
Geisterburg als Tatort
Burg Schädel ist aus heutiger Sicht die Karikatur eines Spukschlosses. Keinem Burgherrn fiele es ein, eine Festung in der Gestalt eines Totenschädels zu erbauen; in der Vergangenheit stand vernünftig der Verteidigungsaspekt im Vordergrund. Doch zur Geschichte, die man uns präsentiert, passt der bizarre Ort ausgezeichnet.
Man nennt John Dickson Carr einen Meister des „Locked-Room-Mysterys“: In einem von innen fest verschlossenen Raum ereignet sich ein Mord, der eigentlich unmöglich ist, da kein Täter anwesend ist und keine Spuren auf den Tathergang entdeckt werden können. Burg Schädel ist in gewisser Weise ein solcher Raum, obwohl Carr uns schon ein Gewirr von Geheimgängen offenbart. Das Rätsel ist kompliziert und muss im Finale umständlich aufgelöst und erklärt werden. Es ist überaus dramatisch und spannend aber schwer nachvollziehbar.
Ein allzu selbstbewusster Ermittler
Der privat ermittelnde Detektiv ist seit Edgar Allan Poes Auguste Dupin eine Gestalt, die Genie und skurriles Auftreten verbindet. Die Fälle, an denen der normale, womöglich verbeamtete Polizeiermittler – hier verkörpert vom arg in die Rolle des Esels gedrängten Kommissar Konrad – scheitert, erfordern quasi zwangsläufig den Auftritt eines in Wort und Tat außergewöhnlichen Menschen. Auf Henri Bencolin trifft diese Charakterisierung ganz sicher zu.
Er gehört zu den Detektiv-Gestalten, mit deren Charakterisierung es ihr geistiger Vater ein wenig übertrieben hat. Nicht umsonst schrieb er nur fünf Bencolin-Romane, bevor Carr ihn durch den leutseligen, red- und bierseligen Dr. Gideon Fell ersetzte, der 23 Mal zum Einsatz kam: Bencolin ist ein unsympathischer Zeitgenosse – kalt und arrogant in dem Sinn, dass er seine Mitmenschen sehr genau fühlen lässt, wie genial er ist, während sie es nicht sind. Seine Mephisto-Frisur und der dazu passende Bart trennen ihn schon äußerlich vom ‚plebs‘.
Mitgefühl ist ihm fremd; höchstens heuchelt er es, wenn es seinen Ermittlungen nützt. Die allein sind ihm wichtig. Bencolin ist ein Kopfmensch, der die gemeine Welt als lästig und das Rätsel als Herausforderung betrachtet. Nicht einmal das Recht ist ihm wichtig; er urteilt aus selbst erteilter Befugnis, sodass die Morde auf der Schädelburg letztlich ungesühnt bleiben.
Privatvermögen und Ruf machen Bencolin völlig unabhängig; wie sonst könnte ein Mann in seiner hohen Position sein Amt einfach im Stich lassen, um im Ausland einem Phantom hinterher zu jagen? Hier erinnert Bencolin stark an Joseph Fouché (1759-1820), der unter Napoleon Bonaparte als Polizeiminister (1799-1802 sowie 1804-1810) ‚diente‘, über ein verzweigten Netzes von Spionen und Spitzeln verfügte und quasi selbst definierte, worin seine Tätigkeit bestand.
Der Ermittler benötigt einen Vermittler
Noch etwas ungelenk zeigt sich Carr in der Kunst, seinen Detektiv zwar allein ermitteln zu lassen, jedoch gut getimt diverse Andeutungen zu machen – Brosamen für die Leser, die sich so unterstützt ihre eigenen Gedanken machen können. Aber Bencolin gönnt uns nicht einmal das; er brummt gern Ominöses in seinen Bart, mit dem sich freilich gar nichts anfangen lässt. Um den Kontakt zum Leser nicht völlig abreißen zu lassen, bedient sich Carr eines alten Tricks. Er stellt dem überlebensgroßen Bencolin den menschlichen Jeff Marle gegenüber. Der ist nicht nur unser Erzähler, sondern auch Bencolins Chronist und Watson und äußert in dieser Eigenschaft diejenigen Fragen, die sich auch dem Leser stellen.
Bencolin dreht auf, als Baron von Arnheim die Bildfläche – oder Bühne – betritt. Konkurrenz schätzen sie alle nicht, die großen Detektive der Literaturgeschichte. Von Arnheim scheint dem großen Bencolin ebenbürtig zu sein, was die Spannung steigern soll. Wer wird das Rennen machen, d. h. den Fall lösen? Eine rhetorische Frage, denn natürlich hält sich Carr an die Konventionen: Bencolin ist sein Held, obwohl er zwischenzeitlich um der Dramatik willen gar keine gute Figur macht. Von Arnheim bleibt der „hässliche Hunne“ mit Stiernacken, Monokel und dem Hang zum Hackenschlagen.
Weniger verdächtig als abgedreht
Ein Haushalt voller Verdächtiger ist ein weiteres Muss des Rätsel-Krimis. Auch hier hält Carr die Fäden nicht so straff in der Hand wie in späteren Werken. Er präsentiert uns das reinste Panoptikum unzurechnungsfähiger Zeitgenossen, die sich in Wort und Tat so überspannt und übertrieben geben, dass es ans Lächerliche zumindest grenzt.
Lesespaß verbreitet dieses Buch trotzdem. Carr kann auf den Nostalgie-Faktor setzen. Angesichts des Alters des „Schädelburg“-Garns fällt es leicht, über die beschriebenen Mängel hinweg zu sehen. Die Geschichte ist spannend und atmosphärisch wie ein schwarzweißer Film aus den 1930er Jahren: Ausstattung, Dramaturgie und Darstellerkunst sind veraltet, haben aber gerade dadurch ihren eigenen Reiz gewonnen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat sich Carr selbst vom zeitgenössischen Kino inspirieren lassen. Filme wie „The Cat and the Canary“ (1927; dt. „Spuk im Schloss“), „Frankenstein“ (1931) oder „The Old Dark House“ (1932; dt. „Das Haus des Grauens“) spiegeln wider, wie man sich eine (leider bzw. seltsamerweise nie realisierte) Verfilmung der „Schädelburg“ vorstellen müsste.
Autor
John Dickson Carr (1906-1977), der so wunderbare englische Kriminalromane schrieb, wurde im US-Staat Pennsylvania geboren. Europa hatte es ihm sofort angetan, als er 1927 als Student nach Paris kam. Carrs lebenslange Faszination richtete sich auf alte Städte, verfallene Schlösser, verwunschene Plätze. Die fand er nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland und Großbritannien, die von ihm eifrig bereist wurden.
1933 siedelte sich Carr in England an, wo er bis 1965 blieb. Volker Neuhaus weist in seinem Nachwort zur „Die schottische Selbstmordserie“ (DuMont’s Kriminal-Bibliothek Bd. 1018) darauf hin, dass seine Kriminalromane so lebendig und scharf konturiert wirken, weil hier ein Fremder seine neue Heimat erst entdecken musste und ihm dabei Dinge auffielen, die den Einheimischen längst zur Selbstverständlichkeit geworden waren.
Carr fand schnell die Resonanz, die sich ein Schriftsteller wünscht. Ihm kam zugute, dass er nicht nur gut, sondern auch schnell arbeitete. Obwohl ihm kein langes Leben vergönnt war, verfasste Carr ungefähr 90 Romane – übrigens nicht nur Thriller. Seine Biografie des Sherlock-Holmes-Vaters Arthur Conan Doyle wurde 1950 sogar mit einem Preis ausgezeichnet. Da hatte man Carr bereits in den „Detection Club“ zu London aufgenommen, wo er an der Seite von Agatha Christie, G. K. Chesterton (der das Vorbild für Gideon Fell wurde) oder Dorothy L. Sayers thronte. 1970 zeichneten die „Mystery Writers of America“ einen bereits schwerkranken Carr mit einem „Grand Master“ aus – der höchste Auszeichnung, die in der angelsächsischen Krimiwelt vergeben wird.
Zu John Dickson Carrs Leben und Werk gibt es eine Unzahl informativer Websites; an dieser Stelle sei nur auf diese verwiesen, die dem Rezensenten besonders gut gefallen hat.
Taschenbuch: 219 Seiten
Originaltitel: Castle Skull (New York : Harper & Brothers Publishers 1931)
Übersetzung: Karl H. Schneider
http://www.dumont-buchverlag.de
Der Autor vergibt: