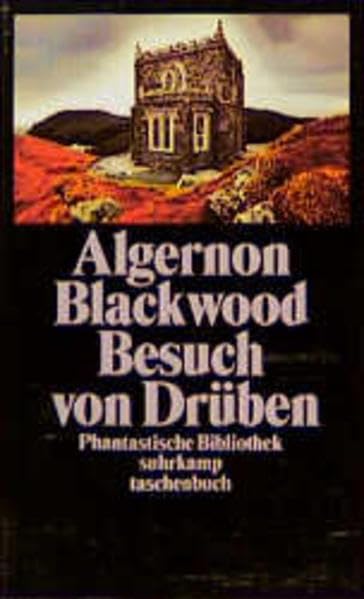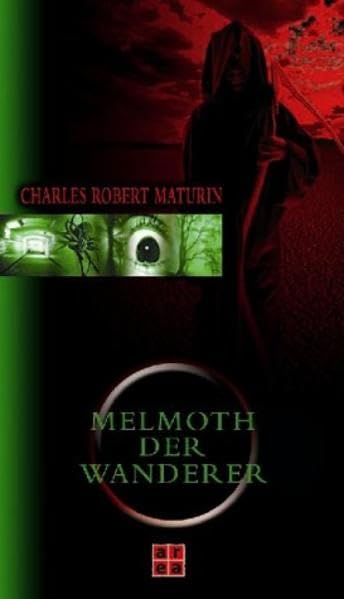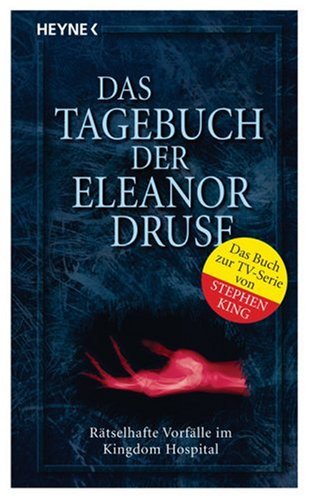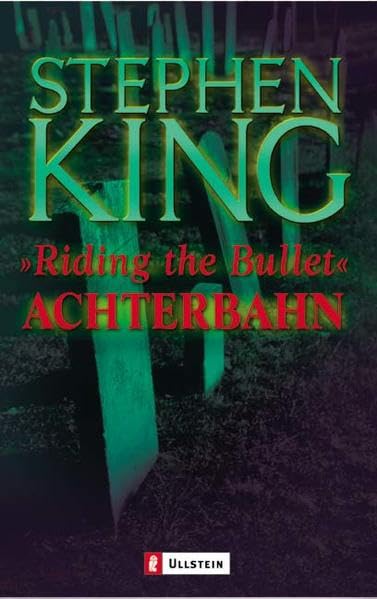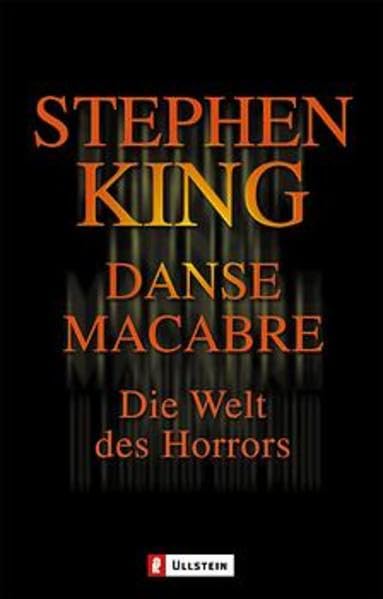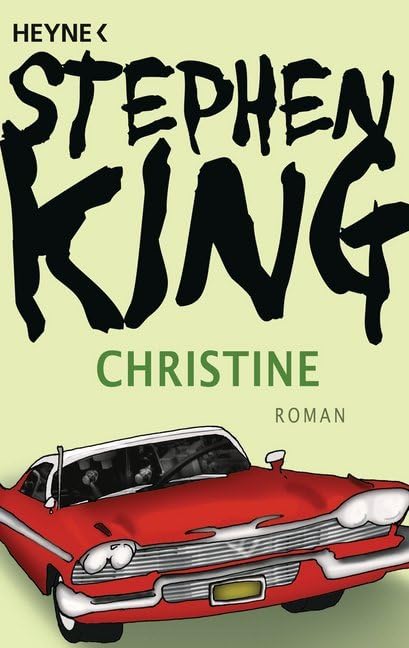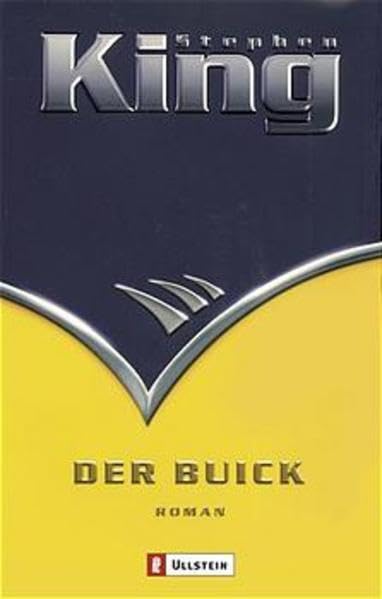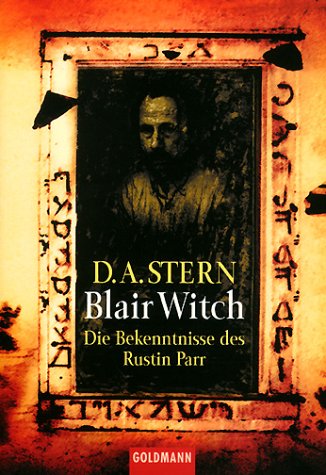Eine Sammlung acht klassischer Gruselgeschichten, die zum Besten gehören, was das Genre zu bieten hat:
– Der Horcher (The Listener, 1907), S. 7-43: Der arme Schriftsteller bezieht eine ungewöhnlich billige Wohnung. Allerdings muss er die feststellen, dass der tragisch aus dem Leben geschiedene Vormieter sein Domizil noch nicht verlassen hat.
– Die Spuk-Insel (A Haunted Island, 1899), S. 44-64: Auf eine Insel in der Wildnis Kanadas zieht sich ein Student zurück, um fern aller Ablenkung zu lernen. Dies missglückt, weil ihm geisterhafte Indianer auflauern.
– Besuch von Drüben (Keeping His Promise, 1906), S. 65-82: Nach vielen Jahren treffen die Freunde Marriott und Field sich wieder. Erst spät erinnert Marriott sich ihres alten Schwurs: Wer zuerst stirbt, kommt den Überlebenden besuchen.
– Gestohlenes Leben (With Intent to Steal, 1906), S. 83-110: Der große Abenteurer Shorthouse erfährt von einer Scheune, in der es umgeht. Für den neugierigen Geisterjäger und seinen Gefährten beginnt eine Nacht, an die sie noch lange denken werden – falls sie überleben.
– Kein Zimmer mehr frei (The Occupant of the Room, 1909), S. 111-121: Minturn ist froh, in dem überfüllten Schweizer Hotel noch ein Zimmer zu bekommen. Die Vormieterin ist vor ein paar Tagen auf einer Bergwanderung verloren gegangen, doch in der Nacht zeigt sich, dass sie dem müden Reisenden näher ist als diesem lieb sein kann.
– Ein gewisser Smith (Smith: An Episode in a Lodginghouse, 1906), S. 122-141: Es ist aufregend, ein Haus zu bewohnen, in dem ein Hexenmeister seine magischen Künste betreibt; das gilt ganz besonders dann, wenn dieser mächtigere Geister heraufbeschwört, als er unter Kontrolle zu halten vermag.
– Seltsame Abenteuer eines Privatsekretärs in New York (The Strange Adventures of a Private Secretary in New York, 1906), S. 142-181: Der wackere Shorthouse (s. o.) soll für seinen Brotherrn einen Erpresser austricksen. Dieser lebt in einem überaus einsam gelegenen Haus und lauert bereits darauf, seinem Gast den Aufenthalt unvergesslich zu gestalten.
– Griff nach der Seele (A Psychical Invasion, 1908), S. 182-246: Ein übereifriger Schriftsteller versucht, seinen geistigen Horizont mit Hilfe von Drogen zu erweitern; tatsächlich öffnet er die Pforte zu einer Dimension böser Geister, von denen ihm einer nun im Nacken sitzt. Dr. John Silence, der berühmte Psychologe und Fachmann für das Okkulte, nimmt sich des Falles an.
Wo Geister richtig zur Sache gehen
Diesen „Besuch von drüben“ laden wir uns gern ein, wenn die Nächte wieder länger werden und zum Lesen einladen. Hier spukt es noch richtig, weil für den Verfasser nie der Wunsch, sich bei der Literaturkritik, die handgreiflich auftretende Gespenster nicht sonderlich schätzt, lieb Kind zu machen, im Vordergrund stand. Stattdessen wollte Algernon Blackwood sein Publikum unterhalten, ohne es gleichzeitig als Schar dummer Tröpfe abzuqualifizieren, denen es nur einen möglichst großen Schrecken einzujagen gilt.
Blackwoods Erzählungen sind deshalb spannend und unterhaltsam, denn ihr Verfasser war kein versponnener, weltabgeschieden hausender, sondern ein neugieriger, weit gereister Mann, der fest mit beiden Beinen im Leben stand. In gewisser Weise spiegelt „Besuch von Drüben“ sogar Blackwoods Biografie wider. Unglücklichen Familienverhältnissen entfliehend, reiste der junge Algernon nach Kanada („Die Spuk-Insel“, seine erste und schon meisterhafte Geistergeschichte überhaupt!) und ging später in die Vereinigten Staaten („Seltsame Abenteuer eines Privatsekretärs in New York“), wo er sich u. a. als Farmer, Hotelier, Journalist und Schauspieler versuchte. 1899 kehrte er nach England zurück, unternahm aber auch später ausgedehnte Europareisen („Kein Zimmer mehr frei“). Die daraus resultierenden Erfahrungen flossen in sein Werk ein: Jedem Leser ist sogleich klar, dass Blackwoods kanadische Wildnis oder seine Alpendörfer keine Hirngespinste sind.
Ist da noch etwas?
Diese Ortskenntnisse werden ergänzt durch ein immenses Wissen des Okkulten und Übersinnlichen, für das sich Blackwood seit seiner Kindheit brennend interessierte. Im Jahre 1900 trat er dem „Hermetic Order of the Golden Dawn“ bei, was seine mystischen Kenntnisse enorm erweiterte; „Ein gewisser Smith“ zeigt einen Magier bei der Arbeit, die dem Verfasser zumindest theoretisch vertraut war.
Hinzu tritt schließlich die Faszination über die neue, noch höchst umstrittene Wissenschaft der Psychologie. Blackwood glaubte an eine Welt des Okkulten, die bevölkert wird von bösen oder besser: der menschlichen Moral nicht unterworfenen, fremdartigen Geistwesen auf der einen und den klassischen Gespenstern auf der anderen Seite – Manifestationen im Leben wie im Tode kraftvoller, von starken Emotionen getriebener Seelen oder auch nur den Gefühlen selbst, die sich durchaus selbstständig machen und blindwütige („Gestohlenes Leben“) oder ziellose („Kein Zimmer mehr frei“), aber nicht wirklich intelligente Phantome formen können.
Alle diese Wesen leben normalerweise in ihrer eigenen Sphäre. Dort können sie zufällig gestört oder angelockt („Griff nach der Seele“), aber auch gezielt gerufen werden („Besuch von Drüben“, „Ein gewisser Smith“). Das theoretische Fundament, wie es hier skizziert wurde, lässt Blackwood in „Griff nach der Seele“ stellvertretend Dr. John Silence, „Physican Extraordinary“ – eine Mischung aus Sigmund Freud oder C. G. Jung und Sherlock Holmes – erläutern. Blackwoods Konzept ist auch deshalb zu interessant, weil es schon deutlich die Grenzen der klassischen viktorianischen Schauerliteratur sprengt, die das Gespenstsein primär als Strafe für diverse Verfehlungen wertete, derer sich der Geist im Leben strafbar gemacht hatte.
Geister klassisch und modern
Der frühe Blackwood ist noch nicht gänzlich frei von dieser Haltung: Der unglückliche Blount in „Der Horcher“ hat sich seinem schrecklichen, ohne jedes eigene Verschulden erlittenen Schicksal durch Selbstmord entzogen. Weil er so Gott, der aus unerfindlichen Gründen ein natürliches aber qualvolles Ende für ihn vorgesehen hatte, ins Handwerk pfuschte, muss er seine nun doppelt elende Existenz im Tode fortsetzen: ein wahrlich alttestamentarische Weltsicht, die im Kontext freilich nicht zwangsläufig befürwortet, sondern von Blackwood, dem Okkultisten, der wahrlich kein Bilderbuch-Christ war, auch angeprangert wird.
Ein wenig aus dem Rahmen fällt die Story „Seltsame Abenteuer eines Privatsekretärs in New York“. Hier lässt Blackwood das Grauen nicht schleichend auftreten, sondern entwirft – dem amerikanischen Schauplatz wohl angemessen – eine aktionsbetonte, teilweise witzig überzogene Grusel-Groteske im Stile Edgar Allan Poes. Zur Abwechslung wird nichts erklärt, sondern einfach nur geschildert. Dem Leser bleibt es dieses Mal selbst überlassen, sich einen Reim auf die Erlebnisse des unerschrockenen Jim Shorthouse zu machen.
Leider wird bei dieser Gelegenheit einer der weniger angenehmen Wesenszüge Blackwoods offenbar: Die Figur des Juden Marx trägt unverkennbar antisemitische Züge. Sollte dies keine ‚Zugabe‘ des Übersetzers sein, hätte der Verfasser der latenten, alltäglichen Judenfeindlichkeit der britischen Gesellschaft ein Denkmal gesetzt, so wie wenige Jahre später Hollywood Amerikas Indianer in aller vermeintlichen Unschuld als blutrünstige Wilde und Bilderbuch-Bösewichte zu missbrauchen begann. Unerfreulich bleiben die für die Geschichte völlig unnötigen und daher noch deutlicher ins Auge stechenden Unterstellungen aber allemal.
Autor
1869 wurde Algernon Blackwood in Shooter’s Hill in der Grafschaft Kent (heute ein Teil Londons) geboren. Seine Eltern gehörten einer strengen calvinistischen Splittergruppe an, doch Algernon betrachtete die ‚etablierten‘ Religion skeptisch. Er verließ sein behütetes aber gefühlskaltes Elternhaus, sobald er volljährig war, und emigrierte nach Kanada. Später ging er in die Vereinigten Staaten und versuchte sich u. a. als Farmer, Hotelier, Journalist und Schauspieler. Die während dieser Lehr- und Wanderzeit gewonnenen Erfahrungen, die er später auf ausgedehnten Europareisen vertiefte, flossen in Blackwoods schriftstellerische Arbeit ein, mit der er 1899, dem Jahr seiner Rückkehr nach England, begann.
In rascher Folge veröffentlichte Blackwood mehrere Sammlungen mit Kurzgeschichten, die sich mit dem Okkulten und Übersinnlichen beschäftigten. Auch hier konnte er auf persönliche Kenntnisse zurückgreifen. Schon als 17-jähriger hatte Blackwood in Kent die Sagen und Mythen seiner Heimat studiert und sich mit den Lehren der klassischen Okkultisten und Kabbalisten vertraut gemacht. Im Jahre 1900 trat Blackwood dem berühmten „Hermetic Order of the Golden Dawn“ bei.
Natur- und Elementargeister, verschüttete Erinnerungen, Wiedergeburt: Dies sollten die Themen sein, auf die Blackwood in seinen Geschichten immer wieder zurückkam. Sie belegen außerdem sein Interesse an der neuen, noch höchst umstrittenen und daher umso faszinierenderen Wissenschaft der Psychoanalyse.
Die Hypothese, dass Geister – sollte es sie denn geben – nicht einfach ‚sind‘, sondern Ausgeburten der menschlichen Psyche sein könnten, floss rasch in die Arbeiten zeitgenössischer Schriftsteller eine. Blackwood gehörte zu den Pionieren, die einen psychologischen Blick auf die Welt des Okkulten warfen. Besonders deutlich manifestierte sich dies in der Figur des „Physican Extraordinary“ Dr. John Silence (1908), der sich am Vorbild Sigmund Freud orientierte, aber mit dem okkulten Wissen seines Schöpfers ausgestattet war.
Algernon Blackwood starb hoch betagt und als Schriftsteller halb vergessen 1951. Im letzten Jahrzehnt seines Lebens war (der 1949 geadelte) alte Mann jedoch als Radiosprecher und Hörspielautor noch einmal ungemein populär geworden. Blackwood hinterließ etwa 200 Kurzgeschichten und 14 Romane, dazu Schau- und Hörspiele, Gedichte und Liedtexte.
Die Algernon-Blackwood-Sammlungen des Suhrkamp-Verlags:
(1969) Das leere Haus (TB 30 u. 1664/Phantastische Bibliothek 12 u. 339)
(1970) Besuch von Drüben (TB 411 u. 2701/Phantastische Bibliothek 10 u. 331)
(1973) Der Griff aus dem Dunkel (TB 518/Phantastische Bibliothek 28)
(1982) Der Tanz in den Tod (TB 848 u. 2792/Phantastische Bibliothek 83 u. 355)
(1989) Die gefiederte Seele (TB 1620/Phantastische Bibliothek 229)
(1993) Rächendes Feuer (TB 2227/Phantastische Bibliothek 301)
Taschenbuch: 247 Seiten
Originalausgabe
Übersetzung: Friedrich Polakovics
http://www.suhrkamp.de
Der Autor vergibt: