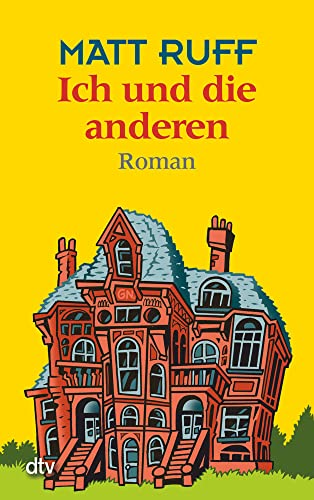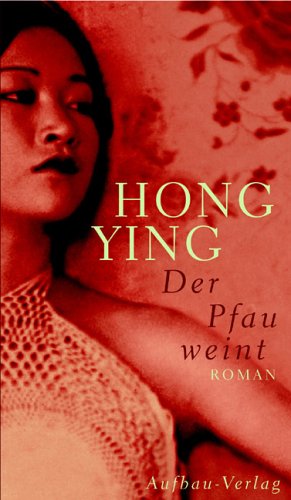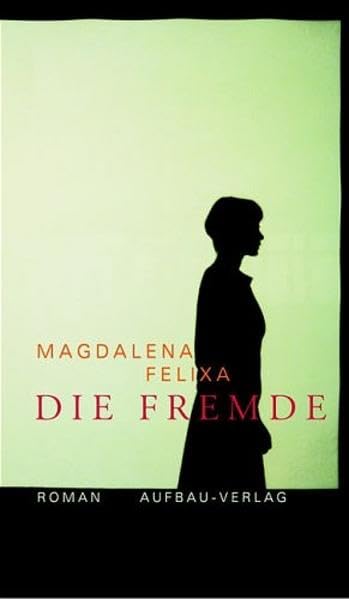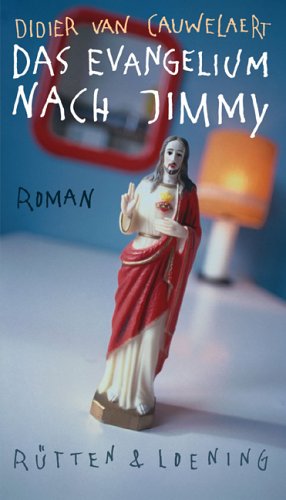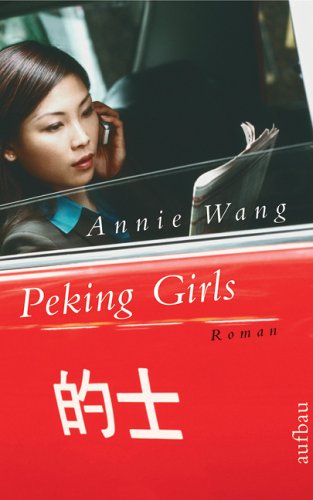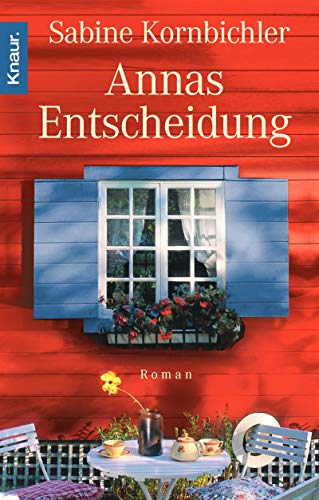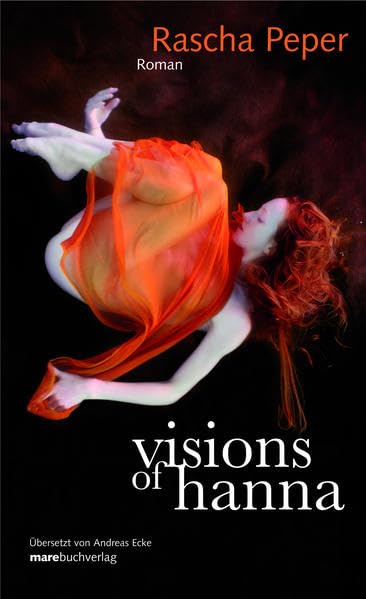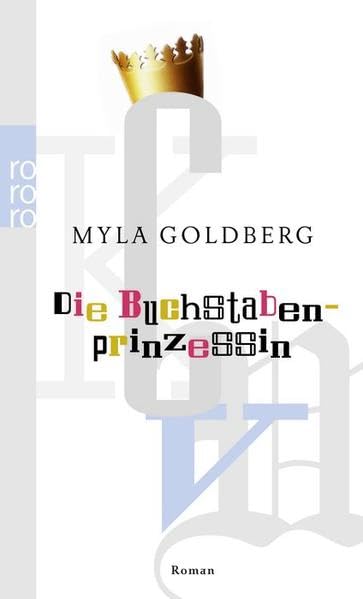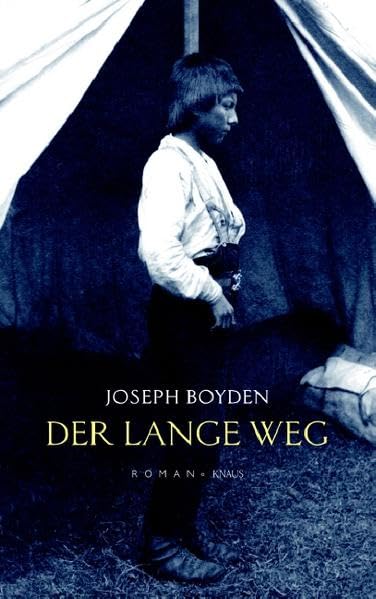Zwei Jahre hat sich Melissa P. Zeit gelassen, um den Nachfolger zu ihrem heiß diskutierten, erotischen Tagebuch [„Mit geschlossenen Augen“ 2733 zu schreiben. Nun ist es da und in Anbetracht des jungen Alters der Autorin – sie wird dieses Jahr einundzwanzig – stellt man sich die Frage, ob sich „Siziliens Lolita“ weiterentwickelt hat.
„Dich lieben“ ist nach eigenen Angaben ebenfalls autobiografisch, aber nicht in Tagebuchform. Stattdessen präsentieren sich die kurzen, abgehackten und dadurch zusammenhangslos wirkenden Kapitel als Briefe an ihre Mutter. Allerdings dauert es seine Zeit, bis man herausfindet, wer das Du im Buch überhaupt ist. Erst zur Hälfte wird der Mutter-Tochter-Bezug klar, was dem Buch nicht unbedingt gut tut. Zu verwirrend sind die kurzen Episteln, deren Inhalte keinerlei Konzept zu folgen scheinen.
Worum geht es überhaupt? Das lässt sich nicht so einfach erkennen. Im Großen und Ganzen wird die Beziehung von Melissa und Thomas beschrieben, die einen zerstörerischen Charakter annimmt, als Melissa eine SMS von einem Mädchen namens Viola auf Thomas Handy entdeckt. Sie beginnt sich Rachefantasien für das Mädchen auszudenken – aus Liebe zu Thomas – und geht so weit, dass sie Thomas verlassen muss, weil sie ihn so sehr liebt.
Und wieso sollte das Melissas Mutter interessieren? Gute Frage. Vielleicht, weil sie neben dem aktuellen Strang auch immer wieder Kindheitserlebnisse einwebt, die sie recht plastisch und schön zu beschreiben weiß. Allerdings klingen einige der Episoden wie eine pathetische Abrechnung mit der eigenen Kindheit.
Wer erwartet, dass Fräulein Paranello mal wieder aus dem Bettkästchen plaudern wird, liegt überraschendweise daneben. Ihre sexuellen Eskapaden hat sie zurückgefahren, stattdessen beschreibt sie hauptsächlich ihr düsteres Innenleben, erzählt Geschichtlein aus ihrer Kindheit und lässt alles andere außen vor. Das tut dem Buch nicht gerade gut, denn Melissas zähes Gefühlsleben, in dem es nur wenig Veränderung gibt, langweilt noch mehr als ihre jugendliche Nymphomanie von damals.
Was den bunten Ringelreigen aneinandergereihter Langeweile alias Briefe an eine Mutter noch schlimmer macht, ist das Ende. Hier beschreibt sich Melissa P. als ein Mädchen, das vor Liebe verrückt geworden ist und dazu benutzt sie märchenhafte Elemente wie zum Beispiel eine Libelle für das Gefühl der Eifersucht. Das Buch endet schließlich in einem abstrakten Ende, bei dem der Leser überhaupt nicht mehr durchblickt, was nun Wahrheit und was Traum ist. Ob die Autorin dadurch bezweckte, den Leser an ihrem leicht wahnsinnigen Ich teilhaben zu lassen? Nun gut. Das wäre eine Erklärung, allerdings sollten derartige Passagen trotzdem eine gewisse Struktur besitzen, die es dem Leser erlauben durchzublicken.
Der Inhalt ist folglich beinahe noch weniger gelungen als der Debütroman. In dem gebundenen Büchlein mit knapp 125 Seiten passiert so gut wie gar nichts. Das einzig Nette sind die Kindheitserinnerungen, die schön beschrieben werden und eine gute Identifikationsmöglichkeit bieten. Außerdem gibt es hier einige Momente, bei denen man sich denkt: Ja, das könnte ich auch so gesagt haben.
Der aktuelle Erzählstrang dagegen ist konfus, langweilig und alles andere als überzeugend. Melissas Gefühlsleben weist keine Struktur auf, kein Anfang, kein Ende, sondern ist nur ein gleichbleibender düsterer Sumpf negativer Gedanken. Es ist nicht so, als ob man nicht auch darüber schreiben könnte, allerdings haben das andere Leute schon besser gemacht.
Wie das? Na ja, vermutlich haben sie einfach einen angenehmeren Schreibstil verwendet. Man muss der Autorin zwar zugestehen, dass durchaus eine Steigerung stattgefunden hat, aber auch wenn sie an einigen Stellen wirklich sehr schön auf den Punkt kommt, ist das Gros der Seiten doch eher Reißwolfnahrung. Den mädchenhaften Tagebuchstil hat sie jedenfalls abgelegt. Stattdessen versteigt sie sich in einer erhabenen, teils schwülstigen Sprache, die von einem riesigen Haufen meist geschmackloser Metaphern beinahe erdrückt wird.
|“Meine Eierstöcke sind zwei in der Luft hängende Kichererbsen. Eine ist größer als die andere und hängt tiefer, da sich meine Regel ankündigt. Eine zähe rote Flüssigkeit wälzt sich darin wie in den Automaten mit Fruchtsaft. […] Das Herz. Das Herz klopft in seiner Nylonstrumpfhüle von der Art, wie sie sich Bankräuber übers Gesicht ziehen. Ein kleines Präservativ zum Schutz vor dem Leben.“| (Seite 29)
Melissa P. legt des Öfteren eine solche bemühte Pseudointellektualität an den Tag, dass man das Buch nur noch zuklappen möchte. Möglicherweise hat sie Potenzial. Man kann auf jeden Fall ein Gehirn und einen gewissen Wortschatz erahnen, allerdings ist auf weiten Strecken nicht viel davon zu spüren. Vielleicht wäre es besser gewesen, Madame Paranello noch eine Weile wie einen guten Wein reifen zu lassen anstatt ihr spärliches Talent unter Zuhilfenahme eines Skandals namens „Mit geschlossenen Augen“ zu verschleudern.
http://www.rowohlt.de