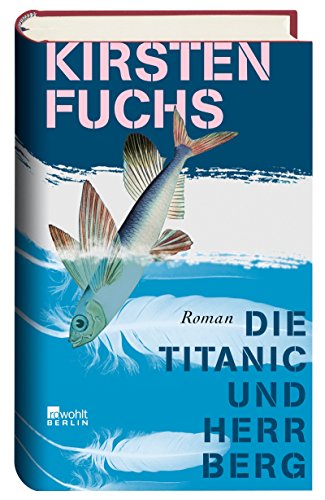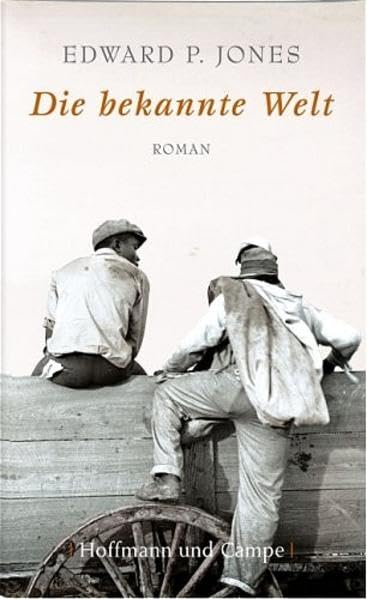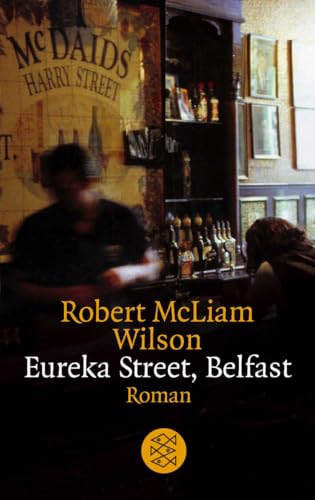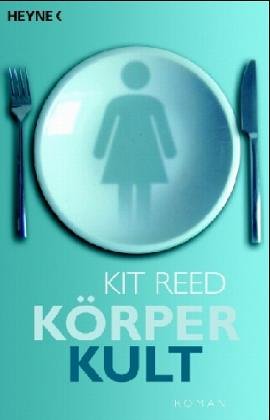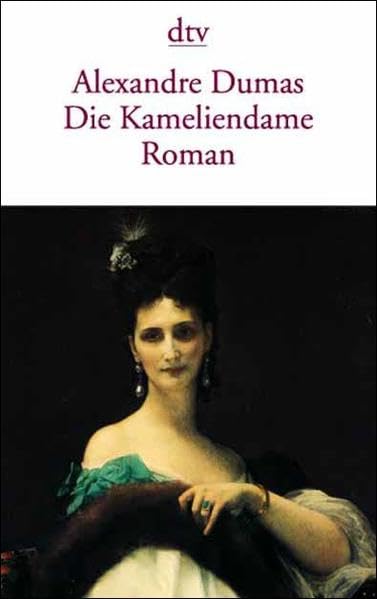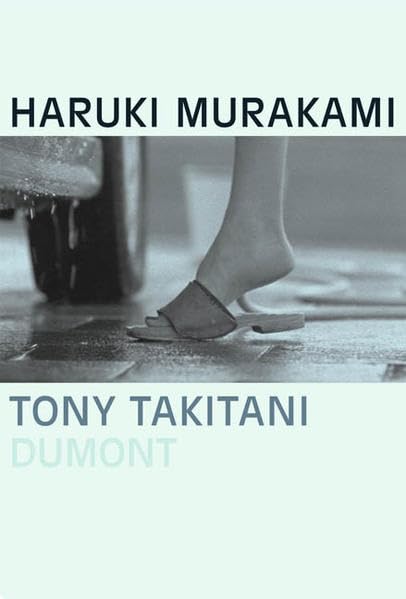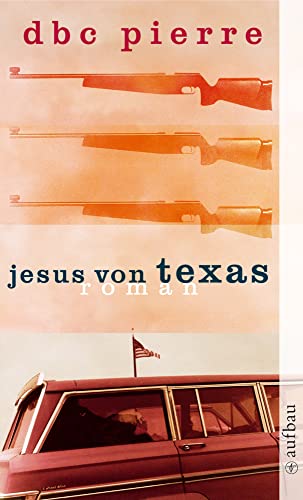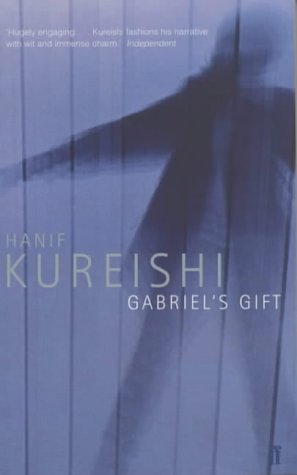Der sympathische Lockenkopf Alexa Hennig von Lange legt dieser Tage mit „Warum so traurig?“ seinen neuen und vielleicht besten Roman vor. Die 1973 geborene Hannoveranerin trat erstmals als „Bim Bam Bino“-Moderatorin in den Neunzigerjahren in Erscheinung. Von der Moderation wechselte sie aber bald in ihren Traumberuf, der Schriftstellerei. Ihr bisher größter Erfolg wurde dann auch gleich das Debüt „Relax“ (1997). Seitdem kamen fast jährlich neue Veröffentlichungen hinzu, darunter das weniger überzeugende „Ich bin’s“ (1999), das mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnete „Ich habe einfach Glück“ (2001), „Woher ich komme“ (2003), „Erste Liebe“ (2004) sowie einige Kinderbücher.
Mit „Warum so traurig?“ kehrt Hennig von Lange einerseits zu ihren Wurzeln zurück, anderseits präsentiert sie sich wie auch schon in „Woher ich komme“ als gereifte Schriftstellerin und Persönlichkeit. „Warum so traurig?“ ist eine Art Fortsetzungsroman des Bestsellers „Relax“. In diesem Roman berichtete die Autorin von einem Paar Anfang zwanzig im Rausch der wilden Neunzigerjahre. Das junge Paar war nicht nur im Liebes-, sondern auch im stetigen Drogenrausch. Die 90er sind jetzt vorbei, Elisabeth, die in „Relax“ nur als „die Kleine“ auftauchte, ist Anfang dreißig und mit ihrem Arbeitskollegen Philip verheiratet. Wie es im Klappentext des Buches treffend zusammengefasst wird, berichtet „Warum so traurig?“ vom Aufwachen, der großen Ernüchterung nach der wilden Jugendzeit.
In der Ehe von Philip und Elisabeth kriselt es. Der Alltag hat sich eingeschlichen und die Erotik zwischen beiden ist eingeschlafen. Während Elisabeth dieses Thema anzusprechen versucht, blockt Philip diese Gespräche ab. Generell wird zwischen beiden wenig geredet, der kurze Trip nach Lissabon, über den sich die Erzählzeit erstreckt, kann dies auch nicht ändern. Vielmehr legt er diese Schwächen noch weiter offen. Elisabeth hatte gar keine Lust auf diese Reise, hält dies aber zurück. Sie ist zur Zeit mit anderen Dingen beschäftigt. Während er sie durch Lissabon schleift, ist sie tief in ihren Gedanken versunken, versucht ihre eigene Vergangenheit zu entschlüsseln. Dabei tauchen immer wieder ihre letzten beiden Beziehungen zu Chris, welcher am Ende von „Relax“ stirbt, sowie Markus, mit dem sie später zusammen war, auf. Auch Philip spielt in diesen durch den früheren massiven Drogenkonsum der Protagonistin bruchstückhaften Erinnerungen eine Rolle. Sie erinnert sich daran, wie es mit beiden angefangen hat und versucht so (vergeblich) den Zauber der ersten Begegnung, der ersten Berührung wieder aufleben zu lassen. „Mein Kopf ist voll von unsortierten Bildern, zusammengeklebt von einander bekämpfenden Gefühlen,“ stellt sie müde fest.
Der in die Beziehung eingekehrte Alltag ist nicht das einzige Problem der beiden. Schnell erfährt der Leser, dass beider Leben in unterschiedliche Richtungen verlaufen. Sie ist noch mit der Vergangenheit beschäftigt, hat Sehnsüchte und den Wunsch Mutter zu werden; er will nicht auf die Gedankenspiele seiner Frau eingehen und Kinder will er schon gar nicht. Welche Folgen das für die Ehe haben kann, deutet sich an, als man ein befreundetes Ehepaar in Lissabon besucht. Melissa und Rene haben Kinder, und wie sich zeigt, war Philip mit Melissa einmal zusammen. Als Elisabeth nach dem Trennungsgrund fragt, antwortet Philip kühl: „Sie wollte Kinder haben.“
Doch da ist noch mehr, und instinktiv sucht Elisabeth in ihrer Erinnerung danach. Der Leser ahnt, dass die Erinnerung auch die Entscheidung in der Gegenwart bringen wird.
Hennig von Lange zeichnet mit ihrer einfachen und klaren Sprache gefühlvoll das Scheitern einer noch jungen Ehe nach. Während die Gegenwart die Tatsachen abbildet, werden die Ursachen dafür durch die Erinnerungen der Protagonistin zu Tage gebracht. Immer wieder dringt Vergangenes an die Oberfläche und bringt so ein weiteres Teil des Puzzles zum Vorschein. Die Autorin hat es solcherart geschafft, dieser ruhigen, reflektierenden Erzählungen ein erhebliches Maß an Spannung mitzugeben, was den Leser in einem Zuge durch den Roman treibt. Dieses Entknoten der Vergangenheit hat sie in „Woher ich komme“ schon geübt, hier hat sie es zur Perfektion gebracht. „Warum so traurig?“ verfügt auch über die weiteren Zutaten, die einen Hennig-von-Lange-Roman immer lesenswert machen. Wieder wird die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt und es ist wohl die beste Eigenschaft der Autorin, die Gedankengänge der Protagonistin und die Charaktere selbst nachvollziehbar und glaubhaft darzustellen. Sie kreiert die Figuren nicht nur, sie fühlt sich auch in sie hinein, und so geht der Leser vollkommen in der Gedankenwelt und im Blickwinkel der Erzählerin auf.
„Warum so traurig?“ ist das vielschichtigste Buch der Autorin. Mit wenigen Worten stellt sie einen tief greifenden Konflikt dar. Sie bringt die erwachsene Erkenntnis zu Papier, dass die zweifellos vorhandene Liebe zwischen zwei Menschen doch nicht reicht, um eine dauerhaft glückliche Ehe zu führen. Sie zeigt auch, dass Narben Zeit zum Heilen brauchen, die ständige Flucht in die Drogen hat die Wunden nur noch vergrößert. Geradezu zerbrechlich wirkt die Protagonistin, die panische Angst vor dem Tod und dem Vergessen hat. Panisch sagt sie zu ihrem Mann „Liebling, ich werde mein Gedächtnis verlieren!“ Die Angst vor Gedächtnisverlust ist ein wiederkehrendes Motiv in dieser Erzählung und wirkt wie eine Metapher für den Verlust der Jugend, denn „Warum so traurig?“ ist auch ein Abschied von der Jugend. Traurig stellt Elisabeth fest: „So golden und sexy, wie wir es uns erträumten, wird es nie wieder werden.“