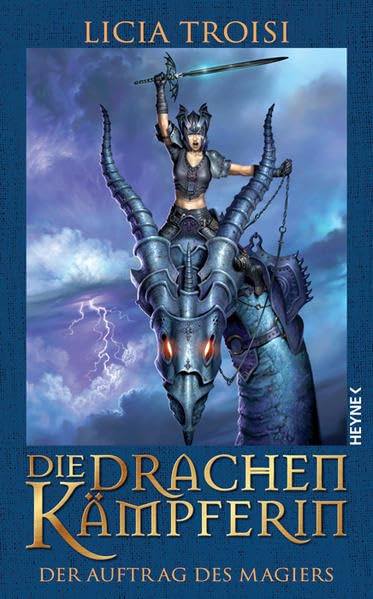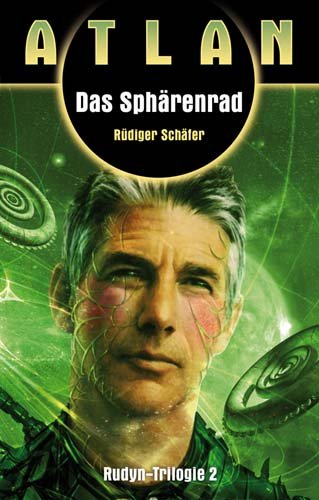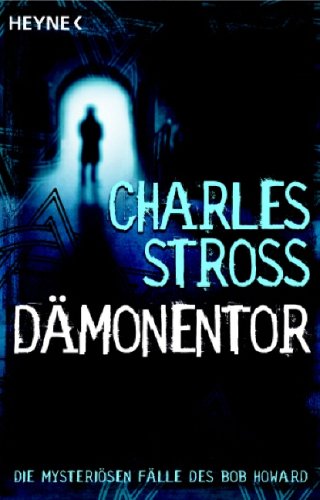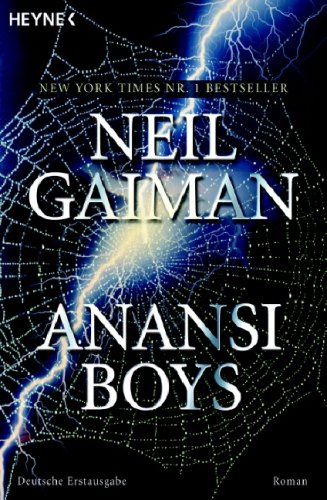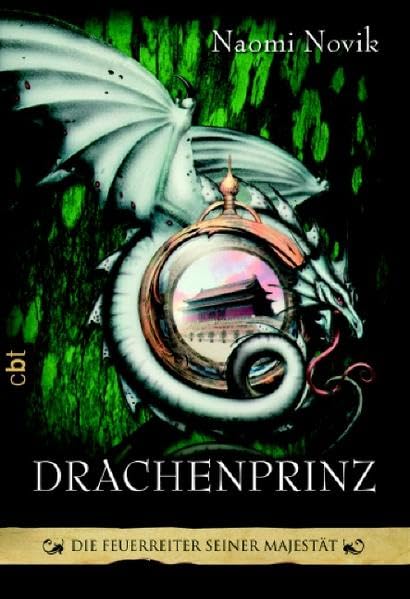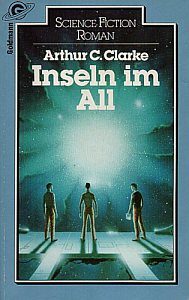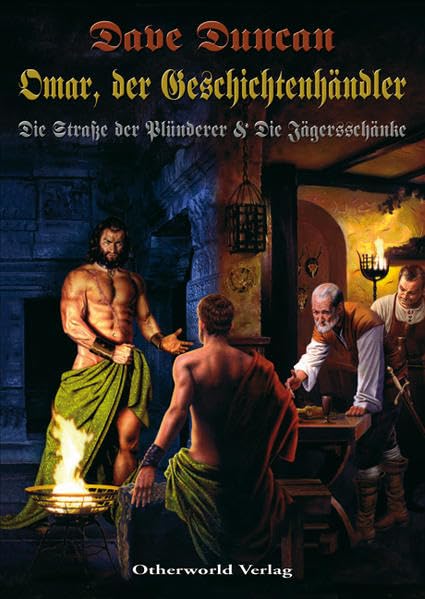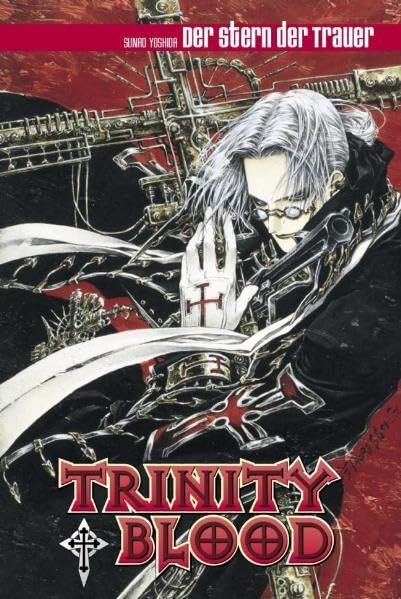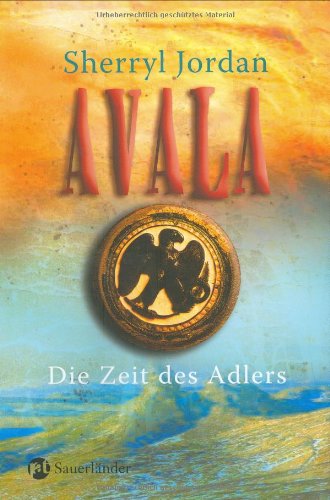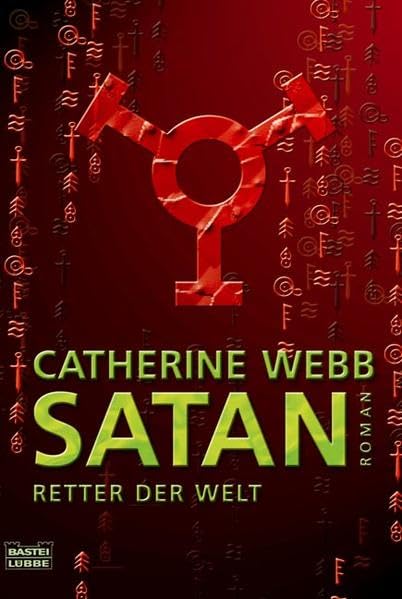_Ein Leben nach dem Diner des Grauens._
Erst letztes Jahr durften wir uns an einem flockigen Horrorspaß erfreuen, als A. Lee Martinez eben jenes Genre durch den Kakao zog. Aber Martinez ist ein umtriebiger Bursche, der schon bei der Veröffentlichung vom [„Diner des Grauens“ 2614 ankündigte, dass „The Nameless Witch“ schon so gut wie fertig sei, „Nessys Castle“ ebenfalls, dass der Autor an einer Noir-Verhohnepipelung mit dem Titel „Automatic Detective“ bastle und dass „Die Kompanie der Oger“ schon längst vollendet wäre. Was bleibt, ist die bange Frage: Wie sieht es mit Qualität aus in diesem schaffenstechnischen Sturzbach? Die Werbemaschinerie ist jedenfalls voll des Lobes:
_Schneller, bunter, besser …_
So wird sie nämlich angekündigt, die Geschichte um „Never Dead Ned“, einen Angestellten in der Buchhaltung der „Unmenschlichen Legion“. Ganz seinem Namen entsprechend tut sich Ned nämlich ziemlich schwer mit dem Sterben – oder besser ausgedrückt: Mit dem Totbleiben, denn über den Jordan hopst er relativ häufig. Es ist nachzuvollziehen, dass ständiges Ableben keine sehr angenehme Sache ist, und deswegen fühlt sich Ned in seiner recht ungefährlichen Buchhaltung ziemlich wohl. Das ändert sich allerdings, als er versetzt wird: Fortan soll er die Kompanie der Oger befehligen, einen himmelschreiend verkommenen Haufen, der sich derart an die Vorzüge fehlender Vorgesetzter gewöhnt hat, dass jedem Neuankömmling im Offiziersgewand rasch ein unglückliches Unglück widerfährt …
Nun ja, aber selbst die dümmsten Oger bemerken irgendwann, wie sinnlos die Anstrengung ist, jemanden töten zu wollen, der einfach nicht tot bleibt. Ned darf sich also fortan darum bemühen, seiner Truppe etwas Disziplin beizubiegen und bekommt es dabei mit allerlei schräger Fabelbevölkerung zu tun: Da gibt es einen Gestaltwandler, eine Amazone, eine Sirene, ein Baumwesen, eine fette Elfe, ein blindes Orakel und außerdem Oger, Orks und Kobolde.
Der erste Konfliktstoff zeichnet sich ab, als sich die sonst männermordende Amazone Regina in Ned verguckt, denn ihre Rivalin Miriam hat einen sehr eindrucksvollen Vorteil: Sie ist eine Sirene.
Zwischen deren Kabbeleien versucht sich Ned mit dem Kämpfen vertraut zu machen und wird dabei wiederum versehentlich ins Jenseits befördert, aus dem ihn, wie immer, die geheimnisvolle rote Frau zurückholt. Das ist dann auch der Punkt, an dem der Leser erfährt, dass es einen Grund dafür gibt, warum Ned stets von den Toten zurückgeholt wird. Dieser Grund zitiert dann auch einen mächtigen Zauberer herbei und, was noch viel schlimmer ist, einen herrschsüchtigen Dämonen, der (mal wieder) die Macht über alles und jeden erringen will. In einem gigantischen Schlachtengetümmel darf die Kompanie der Oger schließlich zeigen, was sie wert ist.
_Zu früh geschossen, mein Herr!_
Schon das „Diner des Grauens“ hatte in der Ehrenloge der Fun-Fantasten nichts verloren. Ein weiter qualitativer Abstand musste da attestiert werden, zu Asprins Dämonenzyklus, zu Pratchetts Scheibenwelt und natürlich zum „Per Anhalter durch die Galaxis“-Zyklus von Adams. Es war zwar nicht zu erwarten, dass sich „Die Kompanie der Oger“ plötzlich in die Riege der Meister einreihen dürfen würde, aber ein wenig mehr hatte ich mir vom „Diner …“-Nachfolger schon erhofft.
Die Story hat ein entscheidendes Problem: Sie kann sich nicht entscheiden. Herumalbern? Oder dem Leser etwas Spannendes erzählen? Zwar punktet der Anfang durchaus mit amüsanten Betrachtungsweisen der Eigenarten bestimmter Spezies, aber über ein paar müde Schmunzler kommt man selten heraus: Wenn es etwa um die „musikalischen Fähigkeiten“ von Orks geht, oder um gynäkologische Andeutungen, die den Erregungszustand von Trollfrauen betreffen. Von einer Story ist da weit und breit noch nichts zu bemerken. Na gut, man kann der Amazonenkriegerin und der Sirene dabei zusehen, wie sie sich um Ned kabbeln, und jede der Figuren darf in amüsanten kleinen Szenen ihre Eigenarten zur Schau stellen, aber ohne eine gescheite Handlung fängt man irgendwann an, unruhig auf dem Buchrücken herumzutippen: Alles klar! Lustig. Wie sieht’s mit Story aus? Die kommt spät. Und sie donnert dem Leser den Fantasy-Standard-Holzhammer vor den Schädel. Aber dazu später.
Vorher noch ein paar Worte zum Humor, denn der sitzt diesmal alles andere als sicher. Viel zu oft scheint Martinez aus der Hüfte zu schießen und viel zu oft landet er dabei nur halbherzige Treffer. Am schlimmsten daran: Es klingt alles wie eine missglückte Huldigung des Scheibenwelt-Humors.
Beim „Diner des Grauens“ hat auch nicht jede Pointe gesessen, aber alles war ausgewogener und liebevoller: An schrägen Fabelfiguren gab es eigentlich nur Earl, den weinerlichen Vampir, und Duke, den jähzornigen Werwolf; das schräge Potenzial beider Figuren wurde da viel besser ausgenutzt! In der „Kompanie der Oger“ gibt es viel mehr Schräges, aber Martinez hat sich keine Mühe gegeben, auszuschöpfen, was die Ideen hergegeben hätten – abgesehen vielleicht von einem toll choreographierten Gefecht zwischen Amazone Regina und dem Gestaltwandler Seamus.
Im letzten Drittel des Buches geht der Humor dann in einem Action-Feuerwerk fast vollkommen unter. Natürlich versucht sich Martinez noch in amüsanten Vergleichen und unterhaltsamen Bildern, aber die Story selbst ist ein bierernster Showdown um Neds Schicksal. Das ist wie gesagt auch das Dilemma der „Kompanie der Oger“. Es ist zu wenig amüsant für einen echten Schenkelklopfer und viel zu klischeehaft und vorhersehbar für einen ernst zu nehmenden Fantasyroman. Martinez hat, man muss es leider sagen, eine lieblose Geschichte zusammengezimmert und dann versucht, sie mit seiner Situationskomik zu „beleben“. Hat nicht funktioniert.
Okay, auch spätere Werke aus der Fließbandproduktion eines Terry Pratchett hatten ihre Längen, aber selbst seine schwächsten Scheibenwelt-Bücher haben den Leser nie mit seitenlangen Schlachtenszenen gelangweilt. Pratchetts Glanzleistungen zeichneten sich außerdem nicht nur durch amüsante Szenen aus, sondern konnten vor allen Dingen immer mit scharfsinnigen und pointierten Spannungsbögen punkten, mit einer Grundidee, über die man meist noch Wochen nach Lesegenuss gelacht hat, vollkommen unkontrolliert, mitten im Schulbus manchmal, wofür man sich dann den einen oder anderen verwunderten Blick eingefangen hat. Und so etwas fehlt der „Kompanie der Oger“ vollkommen: Die Idee um die Unsterblichkeit von Never Dead Ned kann es nicht ansatzweise mit den schreiend absurden Gedankenspielereien aufnehmen, die es etwa im unvergesslichen „Schweinsgalopp“ zu lesen gibt. Die Idee hinter Neds Unsterblichkeit ist einfach derart unsensibel an den Haaren herbeigezogen, dass sie eigentlich schreien müsste. Schade! Da kann man nur hoffen, dass Martinez von seinem Fließband-Trip herunterkommt und seine Geschichten künftig mit Ruhe und Liebe ausfeilt.
http://www.piper-verlag.de