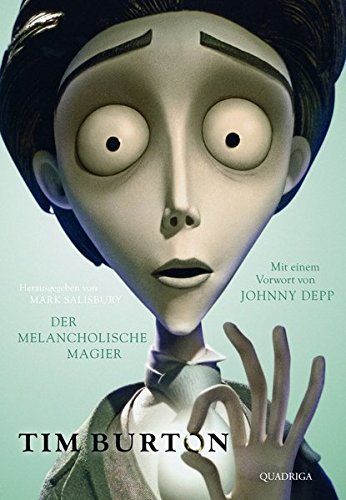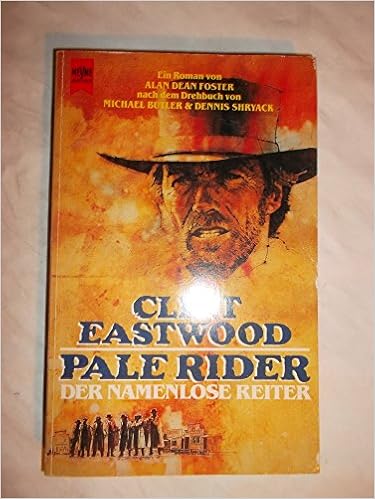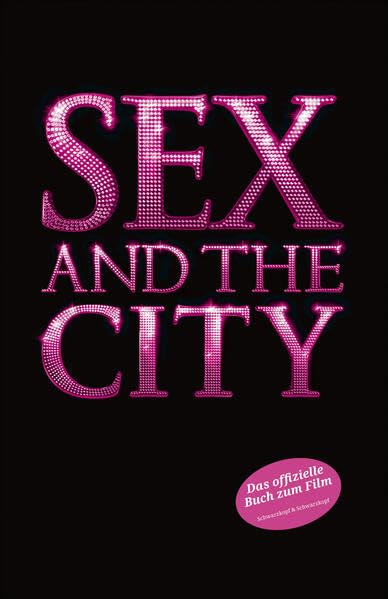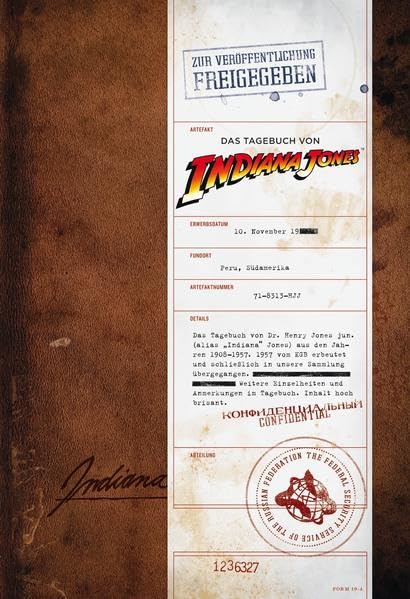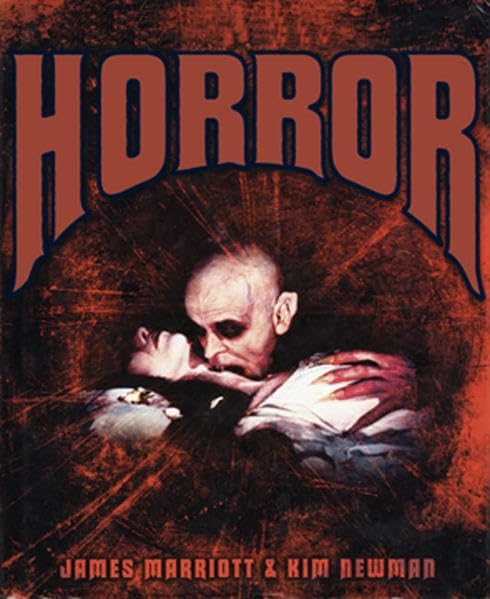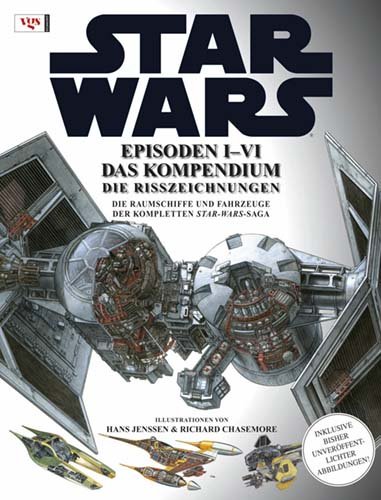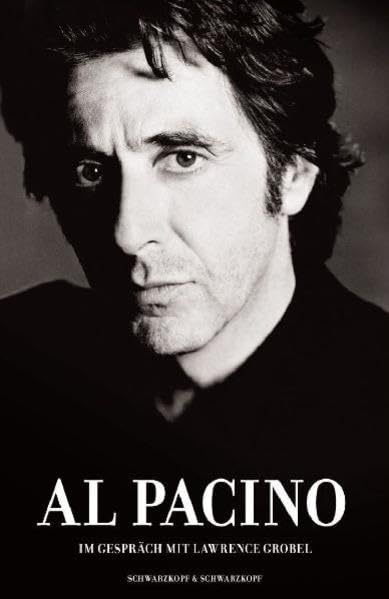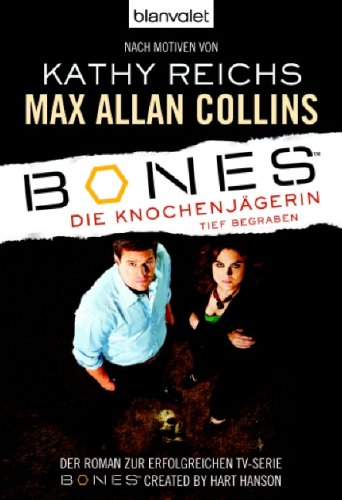_Inhalt:_
Gegliedert in die drei Abschnitte „Vorproduktion“, „Produktion“ und „Postproduktion“ rekonstruieren die Film-Journalistinnen Jody Duncan Jesser und Janine Pourroy die Entstehungsgeschichte jener „Batman“-Trilogie, die Christopher Nolan zwischen 2005 und 2012 mit weltweit grandiosen Einspielergebnissen auf die Kinoleinwand brachte.
_Vorproduktion_
In einem ersten Kapitel („Drehbuch“) gehen Jesser/Pourroy auf die Geschichte der Figur ein. 1939 war Batman als Comic-Held erstmals auf Verbrecherjagd gegangen. Seitdem hatten Fernsehen und Kino mehrfach die Figur aufgegriffen. Die beiden von Tim Burton 1989 („Batman“) bzw. 1992 („Batman Returns“) gedrehten Filme gelten nicht nur als Klassiker, sondern schlugen sich auch an den Kassen bemerkenswert erfolgreich. Zwei weitere Fortsetzungen („Batman Forever“, 1995; „Batman & Robin“, 1997) hatten das hoffnungsfroh und einträglich gestartete Franchise jedoch erst beschädigt und schließlich zerstört.
Anfang des 21. Jahrhunderts konnte man davon ausgehen, dass die wütenden Zuschauer die Zumutungen der beiden letztgenannten Streifen vergessen hatten, und einen Neubeginn riskieren. Dieses Mal wollte man es richtig machen, was u. a. die Rückkehr zum düsteren, tragischen, beinahe manischen „Batman“ erforderte, der an der sich selbst auferlegten Verpflichtung, Gotham City lumpenfrei zu halten, zu zerbrechen droht.
Für „Batman Begins“ fiel die Wahl des finanzierenden Warner-Bros.-Studios auf den Regisseur und Drehbuchautor Christopher Nolan, der bisher eher ‚kleine‘ Filme gedreht hatte, die beim Publikum und bei der Kritik aufgrund ihrer betont realistischen Machart großen Anklang gefunden hatten. Diesen Realismus wollte Nolan auch in ’seinen‘ Batman-Film einbringen – eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen, denn in einer Ära digitaler Spezialeffekte beharrte Nolan auf ‚altmodischen‘ Filmtricks, die u. a. den kompletten Überschlag eines echten Sattelschleppers in Längsrichtung vorsahen; dies nicht in einem Studio, sondern in einer richtigen Straße zwischen echten Häusern.
Realismus wurde zum Motto der „Batman“-Produktion, wie Jesser/Pourroy exemplarisch in den Kapiteln „Szenenbild“ und „Kostüme und Make-up“ belegen. Es beeinflusste auch die „Besetzung“, musste der Darsteller des Batman doch in der Lage sein, unter einem schweren Kostüm glaubhaft Emotionen und gleichzeitig den Eindruck zu vermitteln, sich heldenhaft in Häuserschluchten stürzen zu können, um überlebensgroße Bösewichte zu bekämpfen.
|Produktion|
Nolans Beharren auf Realismus i. S. von Glaubhaftigkeit durchzieht die gesamte Trilogie. Jesser/Pourroy rollen die ungemein komplexen, von Schwierigkeiten bzw. Herausforderungen geprägten Produktionen von „Batman Begins“ (Kap. 5), „The Dark Knight“ (Kap. 6) und „The Dark Knight Rises“ (Kap. 7) detailliert auf. Der oben erwähnte Sattelschlepper-Stunt wurde zur Kleinigkeit angesichts der Erschaffung einer rasch gigantomanisch anmutenden Parallelwelt, die manchmal nur in einer ehemaligen Luftschiff-Halle eingerichtet werden konnte – im Maßstab 1 : 1, wie Nolan es bevorzugt, weil beim Dreh die Schauspieler buchstäblich sehen, was im Drehbuch beschrieben steht, und das Auge des Zuschauers bestätigen kann, dass hier ohne Tricks und doppelten Boden gearbeitet wurde.
Was selbstverständlich nicht zutrifft, wie Jesser/Pourroy vor allem im Kapitel „Spezialeffekte und Stunts“ enthüllen: Die „Batman“-Trilogie zeigt die gesamte Bandbreite des filmtechnisch Machbaren, die durch Nolans zunächst in der Umsetzung oft für unmöglich gehaltene Vorgaben deutlich verbreitert wurde. Der Aufwand ist beachtlich, die Wirkung enorm.
|Postproduktion|
Dieser Aufwand setzte sich in einer Postproduktion fort, die drei bereits in der Produktion teuren Filmen noch einmal Folgekosten im dreistelligen Millionen-Bereich bescherte. Wie Jesser/Pourroy deutlich machen, lassen sich sowohl optisch monumentale als auch emotionale Szenen im Feinschliff aufwerten. „Schnitt, Musik und Sound“ (Kap. 9) heißen die drei Bereiche, in denen entsprechende Instrumente zum Einsatz kommen, wenn vor der Kamera längst Ruhe eingekehrt ist.
Einmal mehr beeindruckt der Aufwand, den beispielsweise die Sound-Spezialisten auf der Suche nach dem einen, neuen, nie gehörten Klang treiben. Endlich gewürdigt werden in Kapitel 10 („Optik“) die Digital-Hexer, die auch Nolan dort bemühen musste, wo die reale Technik definitiv versagte oder kein Mensch ohne direkte Gefahr für Leib & Leben vor die Kamera treten konnte. Zudem wurden die ‚realistischen‘ Aufnahmen nachträglich aufwändig bearbeitet, denn Hollywood weiß, wie sich Realismus künstlich verstärken lässt.
Selbst ein mit Einfallsreichtum, Liebe und Talent entstandener Film ist ein Produkt. Im 11. Kapitel („Marketing“) decken Jesser/Pourroy die Tricks auf, mit denen ein Film zum potenziellen Blockbuster getrimmt wird. Die klassischen Methoden des Trommelrührens werden im 21. Jahrhundert längst durch ein ausgefeiltes virales Marketing ergänzt. Der Aufwand ist gewaltig – hier wird nicht nur sprichwörtlich mit der Wurst nach der Speckseite geworfen.
|Gewichtige Form|
Wenn eine Filmtrilogie weltweit Zuschauer und Dollars in vierstelliger Millionensumme in die Kinos lockt bzw. einspielt, ist ein Monolith wie dieses Buch durchaus angemessen. Christopher Nolans „Batman“-Filme bieten über ihren Kassenerfolg hinaus hochwertige Unterhaltung. Dies geht über die reinen Action-Szenen hinaus, die den Atem stocken lassen. Dem ‚menschlichen Faktor‘ wird viel Spielraum gegeben, was eigentlich den einem Comic entlehnten und deshalb charakterlich eher zweidimensionalen Figuren eine bisher nicht gekannte Tiefe verleiht.
Die Entstehung dieser drei Filme rief eine Industrie auf den Plan, deren Können und Potenzial zwar bekannt ist: Hollywood lässt seit mehr als einem Jahrhundert routiniert Träume wahr werden. Dennoch macht sich der Zuschauer kein echtes Bild von dem Aufwand, der tatsächlich getrieben wird. Den Film-Journalistinnen Jesser und Pourroy ist zu verdanken, dass dieses Kunsthandwerk einem zu Recht faszinierten Leser vor Augen geführt wird. Es bleibt nur das Staunen – beispielsweise über die Anfertigung einer ganzen Serie von Bat-Mobilen, die über ihr eindrucksvolles Styling hinaus tatsächlich fahr- und sprungbereit waren, obwohl die auf den Effekt fixierten Konstruktionen eigentlich jeder physikalischen Logik spotteten.
|(Ge-) wichtiger Inhalt|
Dem trägt dieses Buch Rechnung, das bereits durch seine optische Opulenz beeindruckt. Layouter Chip Kidd zieht in Sachen Text- und Bildgestaltung alle Register seines Handwerks. Nichts bleibt hier dem Zufall überlassen, damit sich die Form wirkungsvoll mit dem Inhalt verbindet.
Aufgeschlagen klaftert „Batman – Das Making-of …“ beinahe einen halben Meter. Das Papier ist dick und glänzend; es bringt die ausschließlich farbigen Fotos bis in die Details brillant zur Geltung. Der Einband ist wuchtig und hält den Papierblock trotz seiner Masse sicher fest. Als Bettlektüre eignet sich dieses Buch nur bedingt, da es mit 2 Kilogramm Gewicht mächtig auf den Magen drückt.
Als Schwachpunkt entpuppt sich ausgerechnet der Text. Die nüchterne Erkenntnis lautet, dass in „Batman – Das Making-of …“ nicht die Informationsvermittlung im Vordergrund steht. Tatsächlich ist dies ein typisches „Coffee Table Book“, das ‚unauffällig‘ auf entsprechenden Möbelstücken platziert wird und den Besitzer vor Gästen als fein- bzw. kunstsinnigen Zeitgenossen adeln soll.
|Höhere Weihen für ein Comic-Action-Drama|
Der durch Erfahrung klug weil zuvor oftmals aufs Glatteis geführte Leser wird bereits misstrauisch, wenn er im Buchtitel das Wort „offiziell“ entdeckt. Es signalisiert auf der einen Seite den freien Zugang zu primären Informationsquellen. Nicht selten durften die Autorinnen die Dreharbeiten beobachten, die sonst |top secret| sind. Auch hinter den Kulissen waren sie dort anwesend, wo erwischte Medienvertreter ansonsten mindestens nach Guantanamo verschleppt werden. Sie sprachen mit den Beteiligten vor und hinter der Kamera und wurden mit exklusivem Material versorgt.
Diese Bevorzugung hat freilich ihren Preis: |Wes Brot ich ess, des‘ Lied ich sing|, heißt ein altes Sprichwort, das in der multimedialen Gegenwart keineswegs an Geltung eingebüßt hat. Im Gegenteil scheint die Forderung an den Journalisten, Abstand zum Gegenstand seiner Recherche zu halten, um die standesgemäße Objektivität wahren zu können, längst ein altmodisches Auslaufmodell zu sein. Besonders skrupellose Vertreter ihrer Zunft verwischen die Spuren gut bezahlter Manipulationen, die einen Bericht zur verkappten Werbung degenerieren lassen.
Jesser und Pourroy gehören zu den Hofberichterstattern, woraus sie nie einen Hehl machen bzw. machen zu müssen glauben. Sie scheinen tatsächlich den eigenen Hosianna-Rufen Glauben zu schenken. Es fällt schwer, nicht gänzlich dem Zynismus zu verfallen, weil Jesser/Pourroy sich nicht einmal die Mühe machen, ihre auf Hochglanz geschönte Darstellung durch wenigstens einige Flecken glaubhafter wirken zu lassen.
|Der Preis des Privilegs|
Der Arsch von Christopher Nolan muss nicht nur der Himmel auf Erden, sondern auch gewaltig sein. So könnte man böse folgern, wenn man Jesser/Pourroy als ‚Journalistinnen‘ vertraut. Nicht nur sie, sondern praktisch alle vor und hinter der Kamera an der „Batman“-Trilogie Beteiligten haben sich am genannten Ort versammelt und stets sehr wohl dort gefühlt.
Man urteilt als Rezensent automatisch grob, wenn man ständig über dreiste Schwurbeleien wie diese stolpert: Kurz nach Abschluss der Dreharbeiten zu „The Dark Night“ starb Heath Ledger, der Darsteller des Jokers. Der Kopf des Marketing-Teams, das die 185 Mio. Dollar teure Produktion global anzupreisen hatte, wird von Jesser/Pourroy mit folgender Reaktion zitiert: |“Heath verstarb, als unser Marketing gerade eine Pause eingelegt hatte … und wir hatten Zeit, um diesen Verlust zu verstehen, zu trauern und unsere nächsten Schritte zu planen. Zuerst haben wir uns mit seiner Familie getroffen und haben ihnen dargelegt, was wir zukünftig machen wollen.“| Das Ergebnis: |“Wir haben uns zusammengesetzt und haben beschlossen, dass wir wie geplant weitermachen, denn Heath war ein so wichtiger Teil des Films.“| (S. 296)
Die salbungsvolle Verlogenheit, mit der diese angebliche Zusammenkunft geschildert wird, prägt generell den Buch-Text in einem Maß, das zunächst irritiert, dann stört und schließlich ärgert. Auf die „Batman“-Filme können und dürfen die Beteiligten stolz sein. Dennoch geht es um einen als Fledermaus maskierten, selbst ernannten Rächer, der grotesk maskierte Comic-Schurken verprügelt. Es gibt keinen tieferen Sinn in der „Batman“-Saga. Jesser/Pourroy gehören zu denen, die ihr einen Subtext aufzwingen, der ihr mehr schadet als nutzt.
Sie, die ‚Journalisten‘, stellen sich dabei in den Dienst des Filmstudios, das mit seinem Produkt möglichst viel Geld verdienen will. Folgerichtig wurden die Dreharbeiten zum letzten „Batman“-Film nicht einfach abgeschlossen: „Epilog: Die Legende endet“, heißt es ehrfurchtsvoll bei Jesser/Pourroy, die seit vielen Jahren ihr Geld mit der Herstellung von „Büchern zum Film“ verdienen und dies auch in Zukunft zu tun gedenken. Die Auftraggeber können mit ihren Leistungen zufrieden sein. Der Leser ist es nicht.
|Gebunden: 305 Seiten
Originaltitel: The Art and Making of the Dark Knight Trilogy (New York : Harry N. Abrams 2012)
Übersetzung: Peter van Suntum
ISBN-13: 978-3-86873-460-7|
http://www.knesebeck-verlag.de