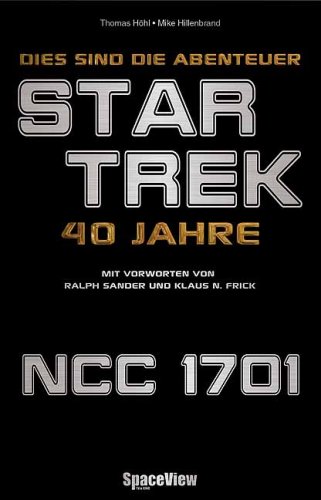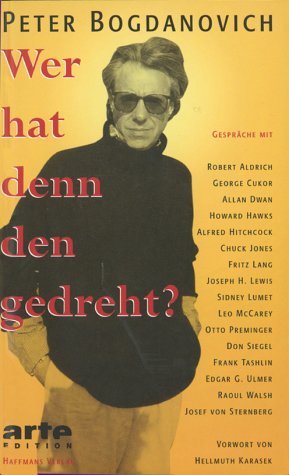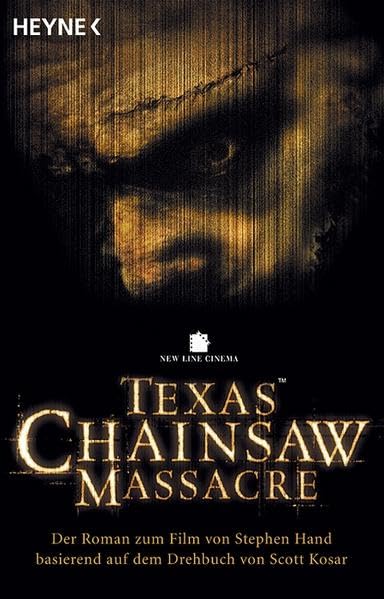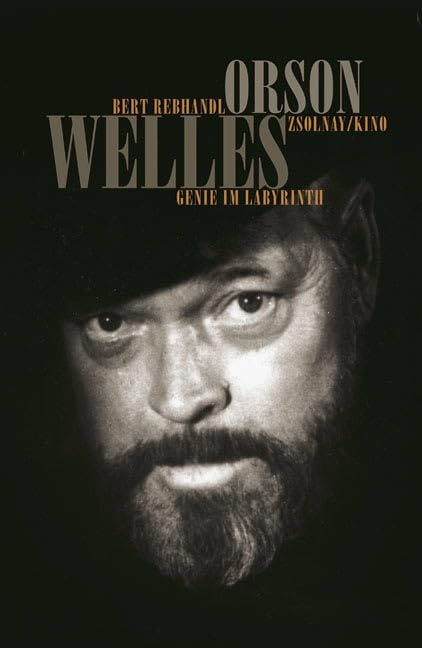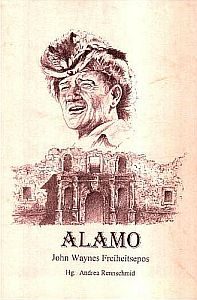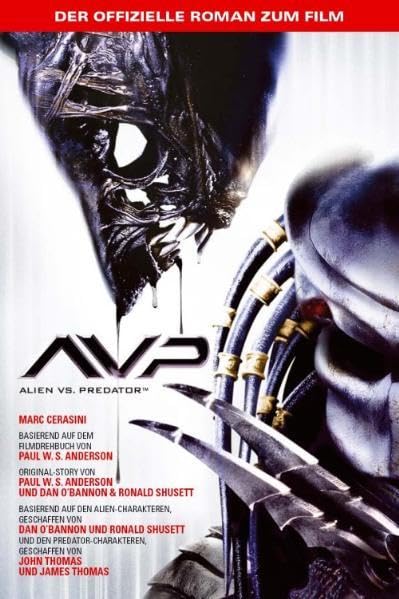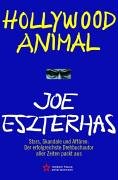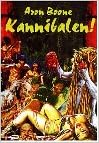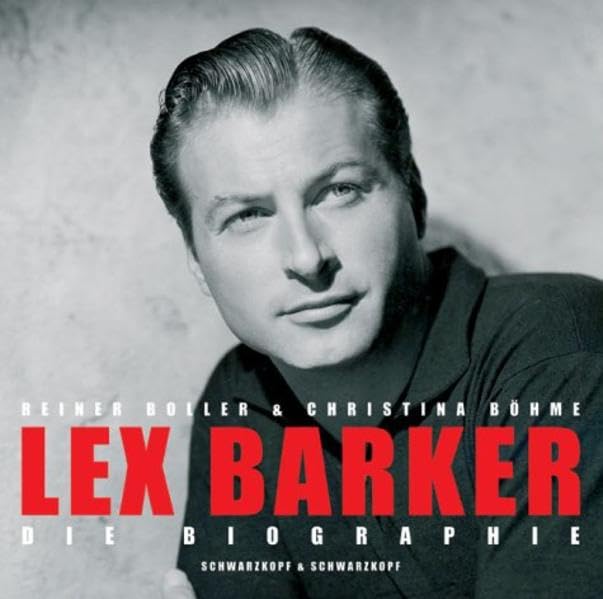Gibt es zurzeit eine Serie, die ein höheres Suchtpotenzial hat als „24“? Eine Serie, die packender ist und spannender, eine andere Serie, die es schafft, die Zuschauer für gut 18 Stunden fast permanent an den Fernseher zu fesseln? Ich kenne momentan keine und muss gestehen: Ich bin süchtig – süchtig nach „24“, süchtig nach einer Serie, die aufregend ist wie keine andere, süchtig nach einer Serie, die eine ungeahnte Faszination auf mich ausübt, die ich nie für möglich gehalten hätte. Noch vor wenigen Monaten dachte ich, dass ich all dem widerstehen könnte, die erste Staffel habe ich mit großer Skepsis eingeschaltet und doch dauerte es keine zwei Stunden, bis ich gefesselt vor dem Fernseher saß und auch meine Mahlzeiten vor den Fernseher verlegen musste. Doch eines wusste ich damals noch nicht: Nach der ersten Staffel kommt es noch „schlimmer“, die Staffeln werden besser und besser …
Doch was genau ist „24“ eigentlich? Es mag ja durchaus Menschen geben, die bisher das Glück hatten, die Serie noch nicht für sich zu entdecken. Glück deshalb, weil diese Menschen die Chance haben, alle bislang abgedrehten fünf Staffeln noch völlig unvoreingenommen anzuschauen. Darum beneide ich sie!
„24“ ist eine Serie, die in Echtzeit gedreht wurde. Hier ist der Name Programm, denn wir erleben 24 Stunden im Leben des Jack Bauer (großartig: Kiefer Sutherland) mit, der für die CTU (Counter Terrorist Unit) arbeitet und seltsamerweise immer in überaus gefährliche Situationen gerät. Grob gesagt geht es in jeder Staffel erneut darum, die Welt oder doch zumindest die USA zu retten. Und so viel sei verraten: Jack Bauer schafft es ein ums andere Mal, sonst würden wir ihn nicht aktuell in der nunmehr fünften Staffel erleben. Das Faszinierende an „24“ ist es, dass am Ende jeder einzelnen Folge, die jeweils eine Echtzeitstunde dauert (abzüglich der Werbepausen bleiben auf DVD leider nicht viel mehr als 40 Minuten übrig), ein Cliffhanger auf uns wartet, der es in sich hat. So wird man dazu verführt, eine Staffel praktisch ohne Unterbrechungen anzuschauen. Suchtpotenzial pur!
Um meine Entzugserscheinungen zwischen den einzelnen Staffeln etwas zu beheben, kam „24 – Behind the Scenes“ genau richtig. Dieses Buch bietet dem Fan eine riesige Auswahl an bislang nicht gezeigten Bildern, die jeweils mit passenden Hintergrundinformationen versehen sind, sodass man auch erfährt, was hinter den Kulissen passiert ist, welche Freundschaften oder Liebesbeziehungen entstanden sind und wie Kiefer Sutherland sich eigentlich auf seine atemberaubende Rolle eingestimmt hat.
Jeder Staffel sind etliche Seiten gewidmet, auf denen die spannendsten Geschehnisse noch einmal eindrucksvoll in Szene gesetzt sind; hier kann man alle entscheidenden Ereignisse noch einmal Revue passieren und sich in die Welt von „24“ entführen lassen. Neben den wichtigsten filmischen Situationen gehört aber insbesondere den Darstellern der jeweiligen Staffeln viel Raum. Wir sehen sie hier auf Fotos aus den Drehpausen und dabei teilweise in sehr ungewohnten Posen. Außerdem erfahren wir, wie inhaltliche Entscheidungen getroffen wurden, die teilweise nicht unumstritten waren.
Durch das große Format dieses üppigen Bildbandes wirken die einzelnen Farbaufnahmen einfach wunderbar, auch das Glanzpapier trägt zum optischen Genuss jedes Fotos bei. Auf den Bildern erfahren wir beispielsweise, dass Kiefer Sutherland offensichtlich ziemlich nikotinsüchtig ist, da es kaum ein Bild gibt, auf dem er gerade nicht raucht. Wahrscheinlich ist er also der Schauspieler, der die Drehpausen am dringendsten herbeigesehnt hat. Und obwohl der überragende Kiefer Sutherland natürlich ganz klar im Mittelpunkt des Buches steht, da die Serie ohne den schlichtweg coolen Jack Bauer einfach nicht funktionieren würde, kommen auch all die anderen – nicht minder wichtigen – Schauspieler nicht zu kurz. Hier sehen wir auch Darsteller, die in der Serie bereits sterben mussten (nein, ich werde nicht verraten, um wen es sich dabei handelt, diese Spannung will ich niemandem nehmen!) und die am weiteren Erfolg der Serie nicht mehr teilhaben konnten.
Leider gibt es allerdings auch einige Kritikpunkte, die ich nicht unter den Tisch kehren mag, auch wenn ich mich gerne heiß und innig in diesen schönen Bildband verliebt hätte: Der Teil „behind the scenes“, der im Buchtitel immerhin viel Raum einnimmt, kommt in diesem Buch leider deutlich zu kurz. Die Bildunterschriften sind meistens eher knapp gehalten und wir erfahren wenig Dinge, die wir bislang noch nicht wussten. Meistens müssen die Bilder für sich sprechen (was bei der hohen Bildqualität auch durchaus sehenswert ist), allerdings hätte ich mir noch mehr Anekdoten und Hintergrundgeschichten gewünscht.
Was aber am schwersten zum Tragen kommt: „24 – Behind the Scenes“ kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt auf den deutschen Markt, zu einer Zeit nämlich, in der es die DVD zur fünften Staffel noch nicht auf Deutsch zu kaufen gibt und die meisten 24-Fans diese Staffel noch nicht kennen dürften. Dass das ein gravierendes Problem ist, beweist schon ein Blick auf den Klappentext, der eine Neuigkeit offenbart, die mir nach dem Anschauen der ersten vier Staffeln noch nicht bekannt war. In diesem Bildband werden die bisher abgedrehten Staffeln inhaltlich sehr ausführlich dargestellt, hier werden die Bösewichte vorgestellt, wir erfahren, worum es sich in der jeweiligen Staffel drehte, welche Schwierigkeiten zu meistern und welche lebensbedrohlichen Situationen zu überstehen waren. Diese ausführliche Darstellung gefiel mir für die ersten vier Staffeln sehr gut, da sie dazu beigetragen hat, dass ich meine Erinnerung an jede Staffel noch einmal auffrischen konnte, allerdings sollte man diesen Bildband nur dann in die Hand nehmen und lesen, wenn man alle fünf Staffeln kennt, da man sonst viele Einzelheiten verraten bekommt, die man viel lieber selbst entdeckt hätte.
Nichtsdestotrotz muss man diesem opulenten Bildband zugute halten, dass er uns beim Lesen und Durchblättern wieder hervorragend in die Serie hineinversetzt. Beim Anschauen der Bilder habe ich mich an Szenen der einzelnen Staffeln erinnert und richtig Lust darauf bekommen, die DVDs wieder in den Player zu schieben, um zumindest die Staffeln 2, 3 und 4 gleich noch einmal zu sehen.
Wer sich oder andere also mit diesem schönen Bildband zu Weihnachten beschenken möchte, sollte jedem 24-Fan raten, den Klappentext auszulassen und nur die Seiten zu den schon bekannten Staffeln zu lesen. Dann wird man jedem Fan der Serie mit diesem eindrucksvollen Bildband sicherlich eine große Freude machen!
[Infoseite des Verlags]http://www.schwarzkopf-schwarzkopf.de/vorschau/24twentyfourbehindthescenes.html