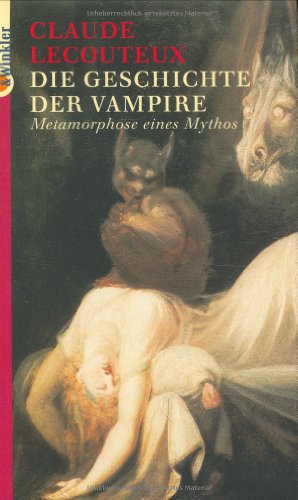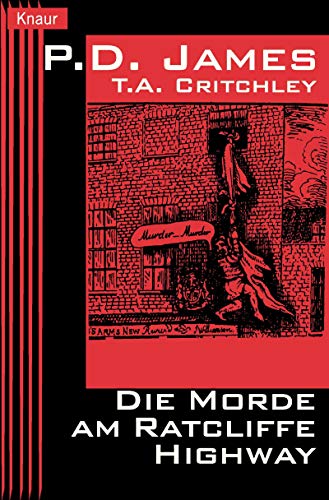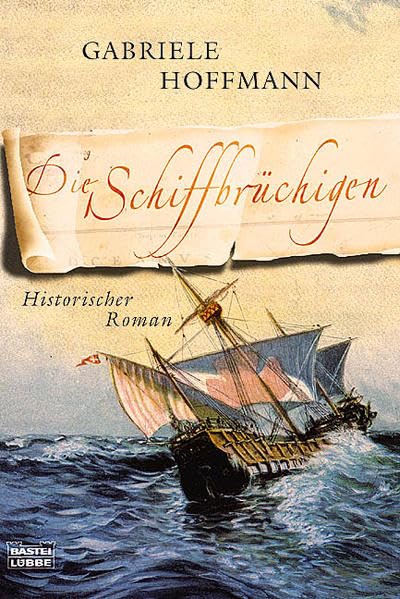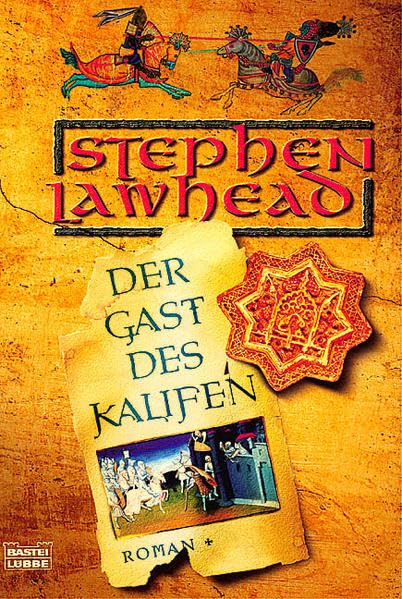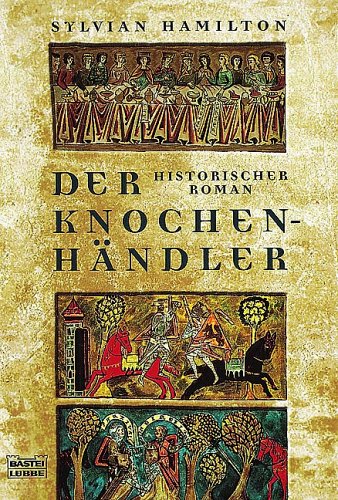
Sylvian Hamilton – Der Knochenhändler weiterlesen
Archiv der Kategorie: Historisches
Lecouteux, Claude – Geschichte der Vampire, Die
Vampire sind vielseitig. Das ist an sich noch keine neue Erkenntnis. Man kann sie in der Literatur finden und auch im Film. Mit ein wenig genauem Hinschauen kann man ihnen auch im wahren Leben begegnen – als real vampyres. Doch das hier zu besprechende Buch widmet sich keinem dieser Themenbereiche, sondern packt das vampirische Übel an der Wurzel. Der Franzose Claude Lecouteux befasst sich in seinem Buch „Die Geschichte der Vampire – Metamorphose eines Mythos“ mit der Kulturgeschichte des Vampirs und versucht zu erhellen, welche Mythen an der Entstehung des Vampirs beteiligt waren und welche Ausprägungen des Vampirmythos man wo findet. Dabei beschränkt er sich, wie andere Studien vor ihm auch, hauptsächlich auf das Europa von circa 1700 bis 1900. Das heißt keineswegs, dass man nur hier und zu dieser Zeit Vampirmythen finden kann, doch sind die Entwicklungen in diesem Zeitraum entscheidend für die Entstehung des Vampirs, wie wir ihn heute kennen: Als einen wiedergekehrten Toten, der sein Grab verlässt, um das Blut der Lebenden zu trinken.
Dabei startet Lecouteux eher überraschend in seine Analyse, nämlich mit einer kurzen Einführung in die Gründerväter des literarischen Vampirs (er wählt hier exemplarisch Polidori, Le Fanu, Stoker und Tolstoi) und die Weiterverbreitung des Mythos durch Enzyklopädien. Erst mit dem zweiten Kapitel widmet er sich der Kulturgeschichte und fängt hier an, den Vampirmythos Europas weiträumig zu umkreisen. Als Einstieg beschäftigt er sich mit der Wahrnehmung des Todes ab dem 18. Jahrhundert. Hier unterscheidet er klar zwischen einem „guten“ und einem „schlechten“ Tod, um zu illustrieren, dass Sterben keine einfache Angelegenheit war. Beim und nach dem Tode konnte einiges schiefgehen, was dazu führte, dass der Tote keine Ruhe fand und dadurch eventuell als Vampir wiederkehrte. Hatte der Tote kein vorbildliches Leben geführt (handelte es sich beispielsweise um eine Hexe, einen Exkommunizierten, einen Mörder etc.) gehörte er zur Gefahrengruppe, sprang ein Tier über die Leiche oder ließen sich die Augen des Toten nicht schließen, so galt dies als schlechtes Omen. Folglich umgaben Tod und Begräbnis zahlreiche strenge Rituale, die es einzuhalten galt, wollte man Wiedergängertum verhindern.
Doch ein Wiedergänger ist nicht unbedingt mit einem Vampir gleichzusetzen, stellt Lecouteux in einem folgenden Kapitel fest. Der Volksglauben war in ständigem Wandel begriffen und zusätzlich auch immer lokal geprägt. Das führt dazu, dass verschiedene Mythen einander beeinflussen oder gar zusammenfließen. So lief eine Hexe immer Gefahr zum Vampir zu werden. Und die in Dalmatien für den Vampir gebräuchliche Bezeichnung „vukodlak“ bildet sich aus dem Wortstamm für Wolf – eine eindeutige Verbindung zum Werwolf. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, versucht Lecouteux daher, verschiedene wiederkehrende Tote zu identifizieren: So den Rufer (jemand, der wiederkehrt und von draußen nach seinen Angehörigen ruft), den Aufhocker (ein Toter, der sich einem Schlafenden auf den Brustkorb setzt und ihm die Lebenskraft raubt) oder den Nachzehrer (ein Toter, der im Grab sein Totenhemd isst). Auch hier sind Überschneidungn zwischen verschiedenen Mythen unvermeidlich. Im Folgenden werden dann einige Bezeichnungen für den Vampir angeführt und erklärt, so der griechische broukolakos, die rumänischen strigoi oder walachische murony. Da die jeweiligen Bezeichnungen unterschiedlichen Nationen zuzuordnen sind, erwachsen auch hier wieder Unterschiede im eigentlich Vampirmythos: Wer wird zum Vampir und wie kann man ihn vernichten? Diese Dinge variieren von Land zu Land. Lecouteux geht daher sehr ausführlich darauf ein, wer nach dem Tode als Vampir wiederkehrt und wie selbiger vernichtet wurde. Erst 1755 verbot beispielsweise Maria Theresia die Hinrichtung von Verstorbenen, was darauf schließen lässt, dass das Exhumieren und Pfählen bzw. Köpfen bei Verdacht auf Vampirismus eine gängige Praxis war. Dies lässt sich auch durch archäologische Funde stützen, bei denen man immer wieder Leichen findet, die förmlich am Sarg festgenagelt wurden oder deren Kopf zwischen den Beinen niedergelegt wurde, damit der Vampir ihn nicht finde.
Erst im letzten Kapitel beleuchtet Lecouteux etwas genauer verschiedene Erklärungsversuche für das Phänomen des Vampirismus. Warum gab es ab 1700 eine derartige Blüte des Glaubens an Vampire? Ganze Scharen von Wissenschaftlern setzten sich zu damaliger Zeit (vollkommen ernsthaft) mit dem Phänomen auseinander und versuchten, bluttrinkende Tote logisch zu erklären. Erklärungen, die sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreuen, finden sich ebenfalls hier wieder: So die Seuchentheorie, die erklären könnte, warum ganze Dörfer Vampiren zum Opfer fielen. Hierbei nimmt man an, dass der vermeintliche Vampir tatsächlich ein Cholera-, Tollwut- oder Typhusopfer war und dass das Ausgraben der Leiche die Seuche daher nicht eindämmte, sondern im Gegenteil noch verschlimmerte.
Claude Lecouteux hat ein umfassendes Buch geschrieben für all jene, die sich für die historischen Facetten des Vampirs interessieren. Er liefert zahlreiche Quellen und historische Berichte und beleuchtet den Volksglauben in Europa durchaus tief, sodass man sich nach der Lektüre exzellent informiert fühlt. Dennoch muss angefügt werden, dass Lecouteux keineswegs Pionierarbeit leistet. Wer sich ein wenig mit dem Vampirmythos beschäftigt hat, wird vieles schon kennen, was in „Die Geschichte der Vampire“ besprochen wird. Schon 1926 hat Montague Summers mit „The Vampire in Lore and Legend“ ein Standardwerk geschrieben, das auch Lecouteux mit seinem siebzig Jahre später erschienenen Buch nicht überflügeln kann. Er liefert stattdessen eine abgespeckte und lesbarere Version des Buches von Summers und ist daher für Einsteiger besonders zu empfehlen.
Allerdings finden sich in „Die Geschichte der Vampire“ auch einige Fehler, die entweder Lecouteux selbst oder seinem deutschen Übersetzer unterlaufen sind. So basiert der Film „Interview mit einem Vampir“ natürlich nicht auf dem Roman „Der Fürst der Finsternis“ und die deutsche Abhandlung „Tractatus von dem Kauen und Schmatzen der Todten in den Gräbern“ wird in der Rückübersetzung aus dem Französischen ganz modern in „Die Kaubewegungen der Toten in ihren Gräbern“ umbenannt. Solche Kleinigkeiten schmälern die Zuverlässigkeit des Werkes, wenn sie auch den meisten Lesern in der Regel nicht auffallen werden.
Davon abgesehen, ist Lecouteuxs Rundumschlag durchaus für all jene zu empfehlen, die sich für die Wurzeln des europäischen Vampirs interessieren. Denn der Vampir war zu jener Zeit eine durchaus reale Erscheinung, deren Existenz zumindest auf dem Lande keineswegs angezweifelt wurde. Und die zahlreichen wissenschaftlichen Traktate aus jener Zeit zeigen, dass trotz Aufklärung auch die gebildeten Schichten nicht gefeit waren vor der Angst vor den Toten!
Robert Harris – Pompeji
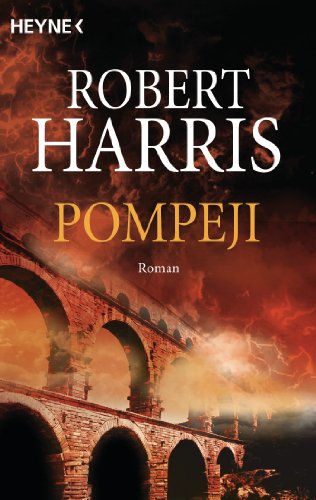
Robert Harris – Pompeji weiterlesen
Rudolf Kreis – Wer schrieb das Nibelungenlied? Ein Täterprofil

Rudolf Kreis – Wer schrieb das Nibelungenlied? Ein Täterprofil weiterlesen
Pringle, Heather – Mumien-Kongress, Der. Reise in die Welt des ewigen Todes
„Der Kongress“ ist es, der die Wissenschaftsjounalistin Heather Pringle anfänglich in den Bann zieht. Genauer gesagt ist es der „3. Weltkongress der Mumienforschung“, an dem sie auf der Suche nach Berichtenswertem im fernen chilenischen Arica als Zuhörerin teilnimmt. Aus der ganzen Welt sind kluge Männer und Frauen zusammengekommen, um über künstlich oder zufällig konservierte Leichen und deren Aussagewert für die Wissenschaft zu diskutieren.
Pringle erwartet, an einen unheimlichen Ort voller Sonderlinge zu geraten. Dies bestätigt sich voll und ganz, aber nach kurzer Zeit ist sie den Mumien trotzdem gänzlich verfallen: Ihrer morbiden Faszination kann offenbar niemand widerstehen. Die Mumienforscher entpuppen sich zudem bei aller Verschrobenheit als liebenswürdige, kontaktfreudige Menschen, die gern über ihre Arbeit Auskunft geben.
So beschließt Pringle, sich nach dem Besuch in Arica nicht sogleich anderen Themen zu widmen, sondern sich echten Eintritt in die Welt der Mumien zu verschaffen. Sie beschließt dort damit zu beginnen, wo aus Laiensicht alles begann: im alten Ägypten. „Das Messer des Pathologen“ beschreibt zum einen die Grundlagen der Mumifizierung. Es ist gar nicht so leicht Menschenfleisch wirklich haltbar zu machen. Längst sind die diesbezüglichen Geheimnisse nicht alle gelöst. Eine Gruppe von Forscher studiert den Prozess und sein Objekt am Ergebnis selbst, d. h. an der Mumie. Die wird zu diesem Zweck wie eine x-beliebige Fundleiche auf den Untersuchungstisch gehievt, um anschließend nach allen Regel ärztlicher Kunst auseinandergenommen zu werden. Die Einzelteile werden anschließend à la „CSI“ mit moderner Labortechnik untersucht.
Erstaunliches kommt dabei ans Licht. Mit ein gutes Argument gegen jene, die sich gegen die Störung der Totenruhe aussprechen – Mumien waren schließlich einst Menschen, die viel Zeit & Geld in ihre körperliche Unsterblichkeit investierten -, ist nicht die reine wissenschaftliche Neugier, sondern der „allgemeine Nutzen“. So ist auch das moderne Ägypten ein von fiesen Wasserparasiten geplagtes Land. Deren Lebenskreislauf ist unerhört kompliziert. Eines steht fest: Eine fest eingeplante Station ist der Mensch. Die unglücklichen „Wirte“ verenden an grausigen Krankheiten, die sich nach wie vor nicht heilen lassen. Es gilt mehr über diese uralten Geißeln der Menschheit zu erfahren – und uralt sind sie wirklich, denn sie lassen sich in Mumien nachweisen und so besser erforschen.
„Drogenbarone“ überschreibt Pringle provokativ das nächste Kapitel. Mumienforscher sind keineswegs ein einig‘ Volk gemeinsam studierender Brüder & Schwestern. Eifersüchtig hüten sie ihre „Claims“, verteidigen ihre Theorien, befehden einander. Einen Aspekt dieses an sich gesunden, die Diskussion in Gang haltenden Verfahrens greift Pringle auf, als sie das Rätsel auffälliger Kokain- und Tabaknachweise in Mumiengewebe beschreibt. Gab es etwa urzeitliche Verbindungen zwischen Altägypten und Südamerika?
Mumien sind das ideale Objekt für „Kriminalgeschichten“. Sie konservieren oft unabsichtlich die Geschichte eines gewaltsamen Todes. Überall auf der Welt werden mumifizierte Männer und Frauen gefunden, die man erdrosselt, denen man den Hals durchgeschnitten oder die man sonstwie zu Tode gebracht hat. Dies übrigens auch im kalten und feuchten, dem Mumienbau ansonsten eher abträglichen Mitteleuropa, wo es die berühmten Moorleichen sind, die das Interesse späterer Generationen finden. Mord oder Menschenopfer, das ist hier die Frage, die sich zwar schwierig, aber doch häufiger als gedacht beantworten lässt.
Das Sprichwort vom Kehren (unangenehmer) Beweise unter den Tisch lässt sich auch auf die doch scheinbar harmlosen, weil von Äonen in einer völlig fremden Urwelt entstandenen Mumien anwenden. Sie können urplötzlich wieder sehr präsent werden, wenn moderne Politik und Religion ins Spiel kommen. Die Volksrepublik China ist ein großes und mächtiges, aber auch empfindliches Land. Kommunistisches Unrecht beim Aufbau einer „neuen, besseren Welt“ haben nicht die Zustimmung des Auslands gefunden. Deshalb achten die Machthaber sehr auf die Wahrung ihrer Ansprüche. Die Realität wird dem nicht selten angepasst. Das gilt auch für die Vergangenheit. So ist man im „offiziellen“ China sehr stolz darauf, deutlich früher und aus eigener Kraft als die viel gerühmten europäischen Länder zur Kulturnation aufgestiegen zu sein. Da ist es peinlich, dass unlängst sehr gut erhaltene Mumien entdeckt wurden, die eine andere Sprache sprechen. Bisher unbekannte „Eindringlinge aus dem Westen“ sind vor vielen tausend Jahren aus Europa nach Asien gekommen und haben dort viele der großen Erfindungen, derer man sich dort heute rühmt, erst eingeführt – ein prekäre Situation, die den Mumienforschern sehr zu schaffen macht, da sie mit Unterstützung unter diesen Umständen kaum zu rechnen haben.
Vor gar nicht so langer Zeit war dies allerdings auch im „freien“ Westen der Welt kaum anders. Pringle erzählt traurige Geschichten von „Wissenschaftlern“, die mit Hilfe der Mumien die geradezu biblische Überlegenheit der weißen „Herrenrasse“ belegen wollten. Wie üblich setzen die Nazis den traurigen Höhe- und Schlusspunkt dieser breiten Sackgasse.
Sie möchten im Wohnzimmer ihren Freunden eine getrocknete Königstochter präsentieren? Vielleicht reicht auch ein Kaminaufsatz aus geschmackvoll arrangierten Kinderköpfen? Oder wie wäre es gegen Unwohlsein und Alterswehwehchen mit einem Tee aus Mumienpulver? Damit lassen sich übrigens auch tolle Bilder malen! Vor kaum einem Jahrhundert war die Erfüllung solcher Wünsche kein Problem; der kultivierte Europäer, der nicht ins schmutzige und heiße Ägypten reisen wollte, konnte sich Mumien sogar bestellen. „Mumienhändler“ traten in vielen Gestalten auf – und sie tun es sogar noch heute, obwohl das Gewerbe gefährlich geworden ist.
So mancher Zeitgenosse schafft es erst nach dem Tod, in den erlauchten Kreis der „Berühmtheiten“ aufgenommen zu werden. „Ötzi“ aus Tirol beweist, dass sogar potthässliche Mumien zu echten Kultstars aufsteigen können. Das gilt noch viel mehr für die berühmten Inkakinder-Mumien aus Südamerika. Eine Laune der Natur ließ sie sich manchmal erschreckend gut erhalten – erschreckend deshalb, weil prompt konkurrierende Gruppen um die Toten zu raufen beginnen. Pringle schildert das (Zwerchfell) erschütternde Gezerre zwischen Entdeckern, Mäzenen, Regierungen, Medien und Moralaposteln im Fall „Juanita“, der vielleicht prominentesten Inkamumie.
Mumien in Europa? Die Moorleichen haben wir schon kennengelernt. Aber es gibt auch echte Mumien – und sogar einen eigenen Begriff für sie: „Die Unvergänglichen“ sind Männer und Frauen, auf die ihre Zeitgenossen auch im Tode einfach nicht verzichten wollten. Also wurden sie konserviert und in ihrer Mitte platziert. Die Katholische Kirche hat sogar einen regelrechten Kult um ihre „Heiligen“ betrieben, die im Leben so fromm waren, dass sie im Tod kein Wurm anzubohren wagte. Pringle weist nach, dass hierbei recht oft kräftig und wenig ehrerbietig nachgeholfen wurde.
Aber das Mittelalter ist vorüber, die Menschen sind über solchen Reliquienkult hinaus? Pringle besucht in Moskau die kleine Gruppe hochqualifizierter Spezialisten, die nach wie vor die berühmteste Mumie der Jetztzeit in Schuss halten. Der Sowjetdiktator Lenin gehört zu den zahlreichen kommunistischen „Despoten“, die quasi als Heiligenersatz im 20. Jahrhundert mit ungeheuerlichem Aufwand konserviert wurden. Josef Stalin, Ho Chi Minh, Kim Il Sung – sie alle erfuhren diese Behandlung, doch nur Lenin hat sie „überlebt“.
Wie kam der Mensch vor Äonen auf den Gedanken, seine Verstorbenen vor dem Verfall zu bewahren? Die ältesten bekannten Mumien der Welt scheinen einen sehr verständlichen Grund zu offenbaren: Schon zweieinhalb Jahrtausende vor den Ägyptern schufen die chilenischen Chinchorro Mumien – sie präparierten so ihre „Kinder“ für die Ewigkeit. So begann womöglich die Mumifizierung: als Versuch untröstlicher Eltern, ihre Lieben auch im Tod bei sich zu behalten.
Und es geht weiter. Mumien sind längst nicht ausgestorben. Sie scheinen an Zahl sogar zuzunehmen. „Selbstkonservierung“ nennt Pringle ihr letztes Kapitel. Sie beschreibt darin die bizarre Praxis überfrommer japanischer Mönche, sich buchstäblich selbst bei lebendigem Leibe zu mumifizieren. Wer die Ewigkeit nicht als Wurmfutter, aber etwas bequemer betreten will, findet heute (bei ausreichend dicker Geldbörse) zahlreiche Alternativen. Pringle besucht bizarre Kühlhäuser, in denen sorgfältig tiefgefrorene Leichen auf eine mögliche Wiederauferstehung in ferner Zukunft warten. Wer es wünscht, kann sich aber auch auf altägyptische Weise, d. h. ganz klassisch mumifizieren und in Leinenbinden einwickeln lassen, womit sich der Kreis wohl geschlossen hätte.
Der Mensch und der Kult um seine Toten … ein unerschöpfliches Thema, das gleichzeitig fasziniert, erschreckt und abstößt. Dafür gibt es kaum ein besseres Symbol als die Mumie. Sie repräsentiert, was nach Auffassung zumindest der Bewohner der westlichen Erdhemisphäre lieber sorgfältig außer Sicht gehalten werden sollte. Aber so denken eben längst nicht alle Menschen, und selbst in Europa oder Nordamerika, wo der Tod heute vom Leben separiert wird, war es vor gar nicht langer Zeit ganz anders.
Leichen gehören zum Alltagsleben. Das kann groteske Formen annehmen, aber auch rührend wirken. Heather Pringle versucht das gesamte Spektrum des Mumienphänomens nachzuzeichnen. Sie hat dabei buchstäblich eine Weltreise unternommen und erstaunliche, erschreckende und – man vergesse nie, dass Leiden & Lachen Verwandte sind – erheiternde Fakten zusammengetragen.
Pringle nähert sich dem komplexen und schwierigen Thema nicht unvoreingenommen. Sie bekennt schon früh, dass sie Probleme mit Bereichen der Forschung hat. Mumien sollten ihrer Meinung nach erhalten werden – nicht als historische „Objekte“, sondern als Hüllen einst lebendiger Menschen, denen es wichtig war, gut konserviert in die Ewigkeit einzugehen. Nun landen sie auf dem Labortisch und werden zum Wohl der Wissenschaft in kleine Stückchen zerhackt.
Dieser Riss klafft sogar zwischen den Mumienforschern selbst. Es gibt heute schonende Untersuchungsmethoden, aber Praktiker schwören weiterhin auf das Pathologenmesser. Sie könnten Recht haben. Darf man sie aufgrund moralischer Vorbehalte stoppen? Oder sind Mumien doch nichts als wissenschaftlich hochinteressantes Aas? Eine schwierige Frage mit vielen Antworten, die längst nicht beantwortet ist.
Nur einmal verliert Pringle ihre Objektivität. „Kinder“, die Geschichte der Chinchorro-Mumien, gerinnt ihr zur rührseligen Gute-Nacht-Geschichte, für die sie vor ihrem geistigen Auge schluchzende Mütter materialisieren lässt, die eine Möglichkeit gefunden haben, ihre Kinder bis über den Tod hinaus lieben. Dass es dafür erforderlich wurde, die lieben Kleinen u. a. zu häuten, scheint Pringle in ihrem urzeit-paradiesischen Traueridyll nicht weiter zu irritieren. Auch fragt sich, was die Chinchorro den lieben langen Tag eigentlich sonst noch getrieben haben außer ihre aufwändigen Mumien zu basteln und auszubessern. Die zeitliche Distanz zur aufgeklärten Jetztzeit schützt Chinchorro offenbar vor solcher Kritik.
Den Pringleschen Schutz verlieren die mumifizierwütigen Mitmenschen, je weiter wir uns der Gegenwart nähern. Die Verfasserin setzt möglicherweise voraus, dass der Mensch mit den Jahren „klüger“ wird und folglich auch den Drang zur unbeschädigten Jenseitsfahrt überwunden haben sollte. Wieso eigentlich? Wir sollten froh darüber sein, dass dies tatsächlich so ist, und die wenigen Abweichler mit Nachsicht betrachten.
In einem hat Pringle freilich absolut Recht: Den Hightech-Mumien von heute wird es in der Zukunft nicht anders ergehen als ihren Vorgängern. Eines Tages wird man sie finden, beileibe nicht neu beleben, sondern wiederum neugierig untersuchen, ausstellen (ausrauben wird nicht mehr lohnen, da keine Beigaben im Kühlsarg liegen) und sich viele Gedanken um sie machen. Aber das ist seit jeher das kalkulierte Risiko bei der Sache gewesen.
„Der Mumienkongress“ ist hier und da zwar ein wenig parteiisch, aber stets sachlich, gut recherchiert und sehr unterhaltsam geschrieben. Nicht das Thema muss den Leser fesseln, die Verfasserin schafft es selbst. Für den Gruselfreund gibt es eine Strecke mit gar zu detailscharfen Fotos. Sie belegen vor allem eines, was dem Laien vielleicht gar nicht deutlich ist: Unsere Vorfahren waren Realisten. Sie wussten, dass ihnen eine 1:1- Präparierung nicht möglich war. Die Mumifizierung war die beste Alternative. Sie erhielt den Körper, der als Gefäß für den Tag der Wiederauferstehung bereit stand. Dass er dann nicht mehr ansehnlich war, wussten sie und nahmen es in Kauf. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man die Mumienporträts mustert: Sie zeigen eben keine in ewigem Schlaf erstarrte Menschen, sondern grässliche Fratzen. Wieder eine der unzähligen nützlichen Infos, die wir Heather Pringle verdanken.
Gablé, Rebecca – Siedler von Catan, Die
„Die Siedler von Catan“ ist Rebecca Gablés Roman zum gleichnamigen Spiel des Jahres 1995 von Klaus Teuber. Dieser war von Rebecca Gablés Bestseller „Das Lächeln der Fortuna“ begeistert, sie selbst spielte gerne sein Spiel. Eine glückliche Verbindung – der Roman „Die Siedler von Catan“ war geboren. Auch wer das sehr empfehlenswerte Gesellschaftsspiel nicht kennt, wird mit einem hervorragenden historischen Roman belohnt:
Elasund ist ein kärgliches Land, das kaum genügend Nahrung hervorbringt, um seine wenigen Bewohner zu ernähren. Durch Überfälle der räuberischen Turonländer wird das Los der Einheimischen zusätzlich erschwert. Der reiche, von seinen Nachbarn beneidete und unbeliebte Olaf fasst einen verwegenen Plan: Er hat im Westen eine große Insel entdeckt, ein reiches und fruchtbares Land, das nur darauf wartet, erobert zu werden.
Hunger und Not treiben die Elasunder dazu, ihm aufs Meer zu folgen. Nach langer Irrfahrt glaubt man sich schon verloren, als ein Sturm die Flotte an ein fremdes Gestade spült, das jedoch nicht Olaf’s Insel zu sein scheint: Man entdeckt weiße Raben, und die alte Brigitta verkündet den Heimatlosen, man sei in Catan gelandet, der von Odin geschaffenen und der Welt entrückten Insel der Legende.
Die Insel ist unbewohnt, einzig ein großer Vulkan ist eine Bedrohung in dem ansonsten vermeintlichen Paradies. Doch wie in der Legende ist es der Mensch selbst, der Zwist und Hader säht – alte Machtansprüche, schlichter menschlicher Neid und Hass sowie das Aufkommen des christlichen Glaubens spalten die Elasunder in mehrere Fraktionen. – Wird die unerschütterliche Freundschaft von Candamir und Osmund überdauern, wenn auch noch missgünstige Frauen ihre Fehden auf den Rücken ihrer Männer austragen?
Rebecca Gablés historische Romane zeichneten sich vor allem durch exakte Recherche und ihre überzeugenden Charaktere aus. „Die Siedler von Catan“ macht da keine Ausnahme, das Buch ist zwar kein astreiner historischer Roman, kann jedoch ohne Zweifel als solcher gelten: Das Entdeckervolk der Wikinger war das Vorbild für die Siedler aus Elasund.
Zahlreiche bekannte Wikinger-Thematiken wurden übernommen: Ihre herzhaft rauhe Art, ihre Lebens- und Ackerbauweise sowie ihre Sitten und Gebräuche. Besonders dem Konflikt zwischen dem aufkommenden christlichen Glauben, den ein sächsischer Knecht nach Catan mitgebracht hat, und den Glauben an die nordischen Asen widmet sich Gablé. Besonders lustig sind die Kuhhändel, mit denen der ehemalige Mönch Austin versucht, die Wikinger zum wahren Glauben zu bringen – oft haarsträubend, aber nahe an der Historie. Einzig die blutigen Raubzüge fehlen, auf der Insel sind nur die Siedler, die sich allerdings bald gegenseitig bekriegen werden. Hier bindet die Autorin geschickt Elemente aus dem Spiel ein: Handel ist wichtig, auf Catan gibt es zwar viele Rinder, aber Schafe sind ein seltenes und gefragtes Gut. Ebenso wichtig ist die Suche nach Eisen – ohne Eisen keine Schmiede, ohne Schmiede ist der Bau von Werkzeugen nicht möglich.
Diese Konflikte spielten sich auch in der realen Weltgeschichte ab, hier kann man die Entstehung einer Kolonie im Zeitraffer erleben. Bis hin zum unvermeidlichen Machtkampf: Wer soll König von Catan werden?
Besonders schön fand ich, dass die Wikinger ausnahmsweise nicht wie so oft als rauhe Dumpfbacken mit urigem Humor daherkommen, sondern differenzierter dargestellt werden. Die Freunde Candamir und Osmund, gewissermaßen die Hauptfiguren des Romans, haben ihre individuellen Schwächen, aber auch ihre Stärken: Candamir verhätschelt seinen kleinen Bruder viel zu sehr, was diesen demütigt, da er ihn einfach nicht als Mann anerkennt. Seiner Magd Gunda gegenüber ist er aus diversen Gründen im Handlungsverlauf sehr nachtragend. Er ist aber auch ein sehr liberaler Mann und glaubt nicht ganz so fest an die Götter und alte Traditionen wie sein Freund Osmund. Dieser gehört zwar zur Sippe des unbeliebten Olaf, hält aber trotz des bald aufkommenden Streits zwischen den beiden fest zu Candamir, obwohl er die laxe Haltung seines Freundes hinsichtlich seiner mangelnden Verehrung der Götter nicht gutheißt. Selbst die schöne Siglind kann keinen Keil in die Freundschaft der beiden Männer treiben, hier habe ich sofort auf böses Blut getippt. Lasst euch überraschen, ob die beiden Freunde bleiben oder sich verfeinden werden.
Auch die offensichtlichen Bösewichte, wie der aufgrund seines Reichtums aber auch seiner Arroganz unbeliebte Olaf, werden nicht völlig eindimensional dargestellt: Ohne dessen Beharrlichkeit und Führungsqualitäten hätten die Siedler wohl nur den Meeresgrund und nicht Catan erreicht.
Verglichen mit Gablés früheren Romanen weisen die „Siedler von Catan“ die selben Stärken auf: Lebendige und interessante Charaktere, wobei Candamir und Osmund besonders sympathisch sind. Die historische Recherche ist hervorragend und sehr gut im Roman umgesetzt, man fühlt sich in die Zeit der Wikinger versetzt, die Eroberung einer unbewohnten Insel ist ebenfalls sehr reizvoll. Sogar Elemente aus dem Spiel wurden unauffällig und nicht im Geringsten störend in die Handlung eingebunden.
Als „Roman zum Spiel“ ist das Buch erstklassig, im direkten Vergleich gibt es jedoch bessere. Die Insellage beschränkt alle Interaktion des Buches auf die Siedler selbst, historische Zusammenhänge wie in „Das zweite Königreich“ oder dem „Lächeln der Fortuna“ kann man hier nicht erwarten. Es gibt nur Catan, der Rest der Welt fehlt. Der enge Fokus und ein unbefriedigend offenes Ende sind die größten Probleme des Romans. Auch wenn gelegentlich überraschende Wendungen gelingen, allzu oft kann man schon im Vorneherein Konflikte kommen sehen. Die Storyelemente sind wie gesagt durch das Szenario limitiert – Gablé macht jedoch wirklich das Beste daraus.
Die Umschlaggestaltung ist an das Spiel angelehnt, die gebundene Fassung besitzt ein Lesebändchen, zusätzlich fiel mir Werbung für Catan in Form eines damit recht überflüssigen gewordenen Lesezeichens entgegen.
Man muss das Spiel nicht kennen oder lieben, „Die Siedler von Catan“ bieten gute Unterhaltung für Freunde historischer Romane. Gablé-Fans werden vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, ihre bisherigen Bestseller konnte sie mit diesem Buch leider nicht toppen.
Homepage zum Buch:
http://www.catan-roman.de/
Homepage der Autorin:
http://www.gable.de/
James, P. D. / Critchley, T. A. – Morde am Ratcliffe Highway, Die
London ist im Jahre 1811 bereits eine Millionenstadt. Doch die Mehrheit der Bürger lebt im Kerngebiet. Die Außenbezirke bilden einen Flickenteppiche kleiner, oft noch gar nicht eingemeindeter Ortschaften mit eigenen Verwaltungen. Eifersüchtig wachen Aufseher, Verwalter und Kirchenvorsteher über ihre aus dem Mittelalter stammenden Privilegien. Zu einer Zusammenarbeit mit dem Nachbarn sind sie nicht bereit. Das nutzen Kriminelle, die ihre Übeltaten in der einen Gemeinde begehen und sich in einer anderen verstecken. Ihre Verfolger sind machtlos; ihre ohnehin kargen Befugnisse enden an den Ortsgrenzen. Die Polizei ist schlecht ausgebildet, unterbezahlt, in der Minderzahl. Von den Bürgern wird ihnen Misstrauen entgegengebracht, denn Korruption ist an der Tagesordnung.
St.-George’s-in-the-East wird sich später in das East End von London verwandeln. 1811 ist es ein kleiner Flecken an der Themse, gelegen am Ratcliffe Highway, einer der Ausfallstraßen von London. Strategisch günstig gelegen, hat hier der junge Herrenausstatter Timothy Marr einen Laden eröffnet und eine Familie gegründet. Es geht aufwärts, die Marrs sind gut angesehen. Doch eines Dezembermorgens findet man Vater, Mutter, Baby und den Ladenjungen ermordet: Mit einem Messer hat man bestialisch abgeschlachtet, mit einem schweren Zimmermannshammer buchstäblich zu Brei geschlagen.
Unerkannt ist der Täter entkommen – oder sind es deren mehrere? Die Ermittlungen laufen sofort an, doch sie werden durch die eingangs geschilderten Probleme behindert. Viele Verdächtige werden verhört und eingesperrt, doch alle können ihre Unschuld nachweisen. So droht die Einstellung des Falls, als keine zwei Wochen nach der Untat im benachbarten St. Paul’s ein zweites Verbrechen nach dem bekannten Muster verübt wird. Dieses Mal fallen ihm ein Schankwirt-Ehepaar und ihr Dienstmädchen auf brutalste Weise zum Opfer. Die Bürgerschaft verwandelt sich in einen erst panischen, dann wütenden Pöbel, die Obrigkeit muss reagieren. Sie wählt den einfachsten Weg und sucht fieberhaft nach einem Sündenbock. Wer sich nicht gegen solche Ränke wehren kann, dessen Schicksal ist praktisch bereits besiegelt. Es trifft einen unglücklichen Seemann, und Justizias Mühlen laufen an – langsam und unerbittlich …
Die Morde am Ratcliffe Highway sind ein Bestandteil der englischen Kriminalgeschichte. In der übrigen Welt wurden sie niemals so bekannt; hier hat sich knapp acht Jahrzehnte später ein weiterer Serienmörder mit dem Künstlernamen „Jack the Ripper“ als wesentlich medientauglicher erwiesen …
Dass hinter den Ereignissen von 1811 eine ähnlich bemerkenswerte und erinnerungswürdige Geschichte steckt, belegen Phyllis Dorothy James und T. A. Critchley in ihrem 1971 zum ersten Mal erschienenen (und seither mehrfach überarbeiteten und aktualisierten) „True Crime“-Sachbuch. Sie ist eine zu Recht mit Anerkennung überhäufte Lichtgestalt des angelsächsischen Kriminalromans, er war ein Historiker, der sich auf englische Justizgeschichte spezialisiert hatte. Talent und Wissen gingen eine selten gelungene Verbindung ein: „Die Morde am Ratcliffe Highway“ ist ein fabelhaftes Sachbuch.
Vermieden werden die Sünden, die eine Lektüre von „True Crime“-Bücher oft zur Qual werden lassen. Recherche soll und muss in diesem Genre häufig schriftstellerisches Geschick ersetzen. Die Autoren setzen voraus, dass die Wucht der Fakten und ihr Mitteilungsbedürfnis den beklagenswerten Dilettantismus in der Umsetzung aufwerten. Gern wird als stilistisches Mittel die wörtliche Rede gewählt, werden die ausgegrabenen Verbrechen in der Gegenwartsform erzählt, als ob der Verfasser anwesend gewesen sei. Dem Hörensagen wird so Tür und Tor geöffnet.
Solche faulen Tricks haben James und Critchley nicht nötig. Sie berichten, was 1811 geschehen ist. Die vorhandenen Quellen haben sie einer sorgfältigen Überprüfung unterworfen und in eine chronologische Reihenfolge gebracht. So arbeiten Kriminalisten, aber eben auch Historiker. Das sichtlich vorhandene Wissen über den Umgang mit Fakten gestattet eine Gewichtung derselben in ihrem zeitgenössischen Umfeld. Man glaube nicht, dass die Welt von 1811 mit der von Heute gleichgesetzt werden darf. James und Critchley wissen das; sie beschränken sich daher nicht auf die Morde mit ihren schön-schaurigen Details, sondern beziehen das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld mit ein.
Dies löst beim „normalen“ Leser angeblich Fluchtinstinkte aus. Dem kann man zustimmen, wenn Zeilenschinder am Werk sind. James und Critchley lassen dagegen eine versunkene Welt wiederaufstehen. Ohne sich in Faktenhuberei zu verlieren, zeichnen sie diese mit kühnem Strich. Vergangenheit ist kein Synonym für Nostalgie; in St.-George’s-in-the-East, St. Paul’s oder London haben 1811 Menschen gelebt – Menschen, denen ihre Gegenwart völlig normal erschien, keine lebenden Museumsstücke. Ihr Denken und Tun, das uns heute so fremd erscheint, lässt sich erklären, wenn man die Schlüssel kennt.
James und Critchley haben sich Mühe gegeben. Lange haben sie in Archiven und Bibliotheken gesucht und gegraben. Dabei fiel ihnen viel und vor allem oft unbekanntes Material in die Hände. Auch das ist eine erstaunliche Tatsache: Die Welt von 1811 war keine primitive, von Schmutz, Grausamkeit, Krankheit und Ungerechtigkeit dominierte Hölle. Diese Aspekte waren tatsächlich gegenwärtig (nicht umsonst wurde der durch Selbstmord in der Zelle geendete Williams auf einem offenen Karren durch die Stadt gefahren, der Leiche ein Pflock durchs schwarze Herz gerammt und die unter einer Straßenkreuzung verscharrt), die Menschen gefangen in den Denkschemata ihrer Epoche, aber nicht dümmer als ihre Nachfahren. Es wurde bereits registriert und analysiert. So konnten James und Critchley auf eine Fülle zeitgenössischer Berichte zurückgreifen. Wer sie einst niederschrieb, war um Objektivität bemüht, ohne sie freilich zu erreichen. Die Interpretation während der Niederschrift von den nackten Tatsachen zu trennen, ist ebenfalls die Aufgabe des Historikers. James und Critchley bleiben dabei bemerkenswert erfolgreich.
So ist es auch mit ihrem Versuch, die wahren Hintergründe der Verbrechen zu rekonstruieren. Der Pechvogel John Williams war wahrscheinlich nicht der Täter. Wie und wer es statt dessen gewesen sein könnte, bleibt natürlich Theorie. Daraus machen James und Critchley auch keinen Hehl, aber sie türmen akribisch Steinchen auf Steinchen und enthüllen eine Geschichte, die sich ereignet haben könnte.
Auch dabei verwandeln die Verfasser eine eigentlich trockene Materie – die Darstellung juristischer Vorgänge – in einen Kriminalroman, ohne dabei die Fakten zu vernachlässigen. Wer glaubt, dies sei nicht möglich, wird sich gern eines Besseren belehren lassen. Leider sind wir durch eine Flut minderwertiger Blut-und-Gewalt-Schwelger – im „True Crime“-Genre steckt Geld, denn die Sucht des Menschen, aus sicherer Entfernung am Unglück des Nachbarn teilzuhaben, ist eine sichere Bank – viel plakativen Sachbuchmüll gewohnt. Da ist es eine besondere Freude erleben zu dürfen, dass es auch anders geht.
Wenige, aber gut ausgewählte zeitgenössische Abbildungen ergänzen den Text, der zu den längst überfälligen Veröffentlichungen hier in Deutschland gehört, wo ebenfalls dem „Wahren Verbrechen“ in den Buchläden so mancher Regalmeter gewidmet (und verschwendet) wird.
Der Originaltitel bezieht sich übrigens auf zwei zentrale Elemente des „Ratcliffe Highway“-Falls. Der „Maul“ ist der schaurige Zimmermannshammer, mit dem den Marrs der Geraus gemacht wurde, das „Pear Tree“ jenes Gasthaus, in dem der angebliche Mörder gehaust haben soll.
Phyllis Dorothy James wurde 1920 in Oxford geboren. 1941 wurde sie die Gattin des Militärarztes Connor Bantry White. Dieser gehörte zu den vielen Teilnehmern des II. Weltkriegs, die zwar lebendig, aber seelisch gebrochen zurückkehrten. Bis zu seinem Tod im Jahre 1964 musste er immer wieder psychatrisch behandelt werden. Da White praktisch arbeitsunfähig war, musste Phyllis die Ernährung der inzwischen vierköpfigen Familie übernehmen. Sie nahm eine Stelle in der Krankenhausverwaltung an. Später ging sie zum britischen Innenministerium.
Ab 1962 schrieb P. D. James Kriminalgeschichten. Sie schuf die Figur des Commanders Adam Dalgliesh, der es seit seinem seinen ersten Auftritt in „Cover Her Face“ (1962, dt. „Ein Spiel zuviel“) zu einem der bekanntesten Ermittler der angelsächsischen Kriminalliteratur gebracht hat. Von Anfang an recht erfolgreich, kam der echte Durchbruch 1977 mit „Death of an Expert Witness“ (dt. „Tod eines Sachverständigen“). Zwei Jahre später konnte James ihre Arbeit für das Ministerium aufgeben und sich auf die Schriftstellerei konzentrieren.
P. D. James ist eine Vertreterin der klassischen Schule ihres Genres. Plakative Gewalt und Action-Spektakel wird man bei ihr vergeblich suchen. Statt dessen stehen (manchmal sogar allzu) ausgefeilte Milieu- und Charakterstudien im Vordergrund. Auch „Die Morde am Ratcliffe Highway“ verdanken dem die Intensität der Darstellung.
Solche vornehme Zurückhaltung bei gleichzeitigem Talent konnte auf Dauer nicht unbelohnt bleiben; das Establishment schätzt Romane „mit Anspruch“. 1991 wurde P. D. James zur „Baroness James of Holland Park“ geadelt. 1999 veröffentlichte sie ihre als Tagebuch gestaltete Autobiografie, ohne darüber das Schreiben neuer Thriller aufzugeben, die bis heute mit großem Erfolg erscheinen, obwohl die Verfasserin ihren schriftstellerischen Zenit inzwischen überschritten hat.
T. A Critchley (1910-1991) war Spezialist für Angelegenheiten der Polizeiverwaltung und als solcher ein Arbeitskollege James‘ im Innenministerium. Er betätigte sich außerdem als Historiker; aus seiner Feder floss eine voluminöse Geschichte der Polizei von England und Wales (1978). Seine Kenntnisse der Materie und im Umgang mit historischen Dokumenten ergänzten sich vorzüglich mit James‘ Fähigkeit, eine logische und spannende Geschichte aus den Fakten zu destillieren.
Hoffmann, Gabriele – Schiffbrüchigen, Die
Sommer 1629: Die „Batavia“, das Flaggschiff der „Herbstflotte“, die im Auftrag der „Vereinigten Ostindischen Companie“ (VOC) im Oktober des Vorjahres die Niederlande via Ostindien verlassen hat, läuft in einem schweren Sturm auf den Riffen einer namenlosen Insel irgendwo im tropischen Ozean auf. Etwa 300 Überlebende können sich retten – sie finden sich mit minimalen Wasser- und Lebensmittelvorräten auf einem öden Eiland wieder. Der Kapitän und der Repräsentant der VOC machen sich mit den Offizieren und einem Teil der Besatzung im Beiboot der „Batavia“ auf, Hilfe zu holen. Ob sie es schaffen werden, das Festland zu erreichen, ist ungewiss. Sollte es ihnen allerdings gelingen, werden sie auf jeden Fall zurückkehren, denn die Laderäume des Wracks bersten förmlich vor Gold, Juwelen, kostbaren Stoffen und anderen Schätzen.
Die Überlebenden müssen sich auf eine lange Wartezeit gefasst machen. Sie sind auf ihr Dasein als Schiffbrüchige nicht vorbereitet. Ohne Führung bricht die Disziplin bald zusammen. Die Inselgesellschaft droht an ihrer Tatenlosigkeit zugrunde zu gehen, da fühlt sich ein Mann berufen, die Zügel in die Hand zu nehmen: Jeronimus Cornelisz, ein Kaufmann, der an Bord der „Batavia“ eher unauffällig geblieben ist. Nun wählt man ihn zum Vorsitzenden eines Inselrates, der den Kampf ums Überleben organisieren soll.
Cornelisz ist ein Mann mit geheimen Träumen von brutaler Herrschaft und perverser Gewalt; nun, da er zum ersten Mal in seinem Leben Macht ausüben kann, lässt er seinen bisher unterdrückten Leidenschaften freien Lauf. Er entpuppt sich als geborener Anführer und geschickter Verführer, der rasch eine Gruppe zu allem entschlossener Männer um sich scharen kann. Sie nennen sich die „Auserwählten“, und sie errichten auf der trostlosen Insel, genannt „Batavias Friedhof“, ein grausames Terrorregime. Cornelisz erklärt sich zum Herrn über Leben und Tod, lässt Kranke und Kinder als „unnütze“ Esser ermorden, zwingt die Frauen sich zu prostituieren, rafft die Schätze der „Batavia“ an sich. Unter dem Vorwand, die drückende Enge auf der Insel mildern zu wollen, lässt Cornelisz mehrfach Männer und Frauen auf benachbarte Eilande übersetzen. Tatsächlich werden sie dort jämmerlich abgeschlachtet und ausgeraubt.
Binnen zweier Monate bringen die „Erwählten“ über 125 Menschen um; bald töten sie offen und aus reiner Mordlust. Die durch Hunger, Krankheit und Furcht geschwächten Überlebenden liefern sich der Willkür fast ausnahmslos aus. Doch der Gipfel der Gräuel ist noch längst nicht erreicht. In dem Wissen, dass ihre Schreckensherrschaft sich bald dem Ende zuneigen oder man sie bei einer Rettung streng bestrafen wird, beginnen die „Erwählten“ sich auch untereinander zu bekriegen. Einig sind sie sich höchstens in ihrem Bestreben, sämtliche Zeugen ihrer Untaten zu beseitigen …
Die wahre Geschichte der „Batavia“ – oder besser die ihrer schiffbrüchigen Besatzung – gehört zu den durchaus bekannten, aber halb vergessenen historischen Episoden. Wenn Gabriele Hoffmann den VOC-Kommandeur Pelzert im zweiten Teil ihres Romans die unglaublichen Ereignisse des Jahres 1629 niederschreiben lässt, hält sie sich damit eng an die Wahrheit. Pelzerts umfangreiche Protokolle stellen eine reiche Quelle dar, aus der auch die Autorin schöpfen konnte.
Da die Ereignisse wahrlich für sich selbst sprechen, übernimmt sie den nüchternen Tenor der Vorlage. Ihr Roman wirkt dadurch über weite Strecken wie eine dokumentarische Bestandsaufnahme. Der Verzicht auf inszenierten Horror und Melodramatik kommt der Geschichte sehr zugute. Dennoch sollte man sich davor hüten, Hoffmanns Schilderung mit der Realität des Jahres 1629 gleich zu setzen. „Die Schiffbrüchigen“ ist ein Roman und damit fiktiv; es gibt zum Beispiel keine Aufzeichnungen eines Ritters Christoph von Eck.
Außerdem unterwirft Hoffmann die reale Geschichte ihrer subjektiven Wertung. „Die Schiffbrüchigen“ soll mehr als reine Unterhaltung sein – nämlich ein romanhafter Essay über das Wesen der Schuld. Das Geschehen von 1629 steht stellvertretend für alle Grausamkeiten, die sich die Menschen im Laufe der Jahrtausende angetan haben; Gräuel, die unzweifelhaft geschehen sind, die aber nachträglich niemand zufriedenstellend erklären konnte und kann, was die Opfer wie die Täter (!) einschließt.
Statt „Batavia Friedhof“ könnte der Ort der Handlung auch Little Big Horn, My Lai oder Auschwitz heißen, wobei Hoffmans Allegorie hauptsächlich auf den organisierten Massenmord der Nazis zielt. Der Aufstieg einer kleinen, aber skrupellosen Clique in krisenhafter Zeit, die Ausgrenzung angeblich „schädlicher“ Minderheiten, die geschickte Eingliederung der schweigenden Mehrheit in eine Unterdrückungs- und Mordmaschinerie, der Terror, der bald seine eigenen Kinder frisst, aber auch das Schweigen, die Fassungslosigkeit und das Leugnen derer, die „dabei“ waren, sobald der Spuk vorbei ist – das sind Phänomene, die untrennbar mit dem „Dritten Reich“, den Kriegsverbrecherprozessen der überforderten Siegermächte und der Grabesstille der deutschen Nachkriegsjahrzehnte verbunden sind.
Dem erzählerischen Talent Gabriele Hoffmanns ist es zu verdanken, dass diese Aspekte sich einerseits nie aufdringlich in den Vordergrund schieben, während sie sich andererseits stets als persönliche Standpunkte der Autorin erkennen lassen. Hoffmanns (resignatives) Fazit, dass „das Böse“ in jedem Menschen lebt und jederzeit und an jedem Ort ausbrechen kann, hat etwas bestechend Logisches, vereinfacht ein komplexes Problem allerdings in vielerlei Hinsicht und muss nicht unbedingt zutreffen. Aber bei einem Roman ist es das Privileg des Autoren, die Wirklichkeit nach eigenem Gusto zu verändern, mit ihr zu spielen und eine persönliche Sicht der Welt ins buchstäbliche Spiel zu bringen.
Wer sich als Leser also nicht berufen fühlt, an einer philosophischen Diskussion über Gut und Böse teilzunehmen, sei beruhigt: „Die Schiffbrüchigen“ funktioniert auch als „normales“, sehr spannendes, wenn auch düsteres historisches Abenteuer.
Jeronimus Cornelisz – die personifizierte Banalität des Bösen. Als Kaufmann führt er ein völlig unauffälliges, von hohen Risiken und gefahrvollen Geschäftsfahrten geprägtes Dasein. Niemand würde in ihm den geradezu archaischen Schreckensherrscher vermuten, in den er sich aus heiterem Himmel verwandelt. Er muss sein geheimen Träume von lustvollem Terror gehabt, aber sorgfältig in seinem Herzen verborgen haben. Nun lässt er ihnen freien Lauf, da niemand ihnen (endlich) Einhalt gebieten kann.
So ist es natürlich nicht. Wieso greift beispielsweise Christoph von Eck nicht ein? Er trägt den Rittertitel und ist eigentlich verpflichtet für Zucht und Ordnung zu sorgen. Doch in diesem Jahr 1629 ist der Ritterstand in uralten Denkmuster erstarrt, trauert kodifizierten Verhaltensvorschriften nach, die von der Zeit längst überholt sind. Von Eck sieht sich als Krieger im Auftrag Gottes; für die Disziplinierung eines Gewaltherrschers fühlt er sich nicht zuständig, so lange ihn dieser nur in Ruhe lässt.
Cornelisz wiederum ist schlau genug zu warten, bis seine Anhängerschaft so stark gewachsen und seine Gegner so schwach geworden sind, dass ihm die Macht in den Schoß fällt. Wäre die Mordlust nicht mit ihm durchgegangen, hätte sein Plan aufgehen können. Aber der amokhafte Blutrausch führt den unheimvoll „befreiten“ Kaufmann letztlich selbst ins Verderben: Als man ihn zur Verantwortung zieht, verhält sich „das Gesetz“ nicht minder grausam als er. Seine Richter und Henker sehen freilich das Recht auf ihrer Seite und sich selbst in der Pflicht, Cornelisz‘ unglaubliche Taten zu sühnen – und das geschieht auf zeitgenössische Art, d. h. nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Die Überlebenden der „Batavia“ müssen sich den Rest ihres Lebens die Frage stellen, wieso sie mittaten- als Täter, Mitläufer oder Opfer. Sie finden keine Antwort, verstricken sich in gegenseitige Schuldzuweisungen, erwachen – Cornelisz eingeschlossen – aus einem bösen Traum. Und das war die „Batavia“-Katastrophe denn auch: eine unerfreuliche Lektion in der Alltäglichkeit des Bösen, das dich auf eine Weise überraschen kann, mit der du niemals gerechnet hättest: als Unschuldiger, aber auch als Schuldiger.
Kay, Guy Gavriel – Komplott, Das (Sarantium 1)
Guy Gavriel Kay’s Roman „Das Komplott“ ist der erste Band des „Sarantium“-Zyklus, bei dem er die Geschichte, das Leben und die Atmosphäre in dieser vielleicht bedeutendsten Stadt der Spätantike und des Mittelalters festgehalten hat: Sarantium ist keine andere Stadt als Byzantium, Byzanz, Konstantinopel, Miklagard oder heute Istanbul. Bekannt als der oströmische Teil des ehemaligen römischen Weltreichs, eine Stadt, in der Orient und Okzident aufeinandertreffen, stellten byzantinische Kunst und Kultur in den dunklen Zeiten des Mittelalters das leuchtende Licht der Zivilisation dar. Aber auch für moralische Verkommenheit, sexuelle Ausschweifungen und die sprichwörtlich gewordenen byzantinischen Intrigen steht diese Stadt, eine der ersten Metropolen der Welt.
„Sailing to Sarantium“ ist der englische Titel des Romans, diese Reise nach Sarantium wird für den jungen Mosaikleger Caius Crispus, genannt Crispin, einen Wendepunkt in seinem Leben darstellen. Er soll für Kaiser Valerius II. und seine Gemahlin Alixana die Kuppel des großen Jad-Tempels mit den schönsten Mosaiken der Welt schmücken. Für den gebürtigen Varener eine Chance, seine Kunst zu vervollkommnen, sich unsterblichen Ruhm zu erwerben und aus dem von Barbaren eroberten Westteil des Reiches in das goldene Sarantium zu ziehen.
Valerius II. und Alixana sind keine anderen als Kaiser Justinian I., genannt der Große, und seine Frau Theodora I., eine ehemalige Zirkusartistin, die er nur durch eine Gesetzesänderung überhaupt zur Frau nehmen konnte – Tänzerinnen waren damals nur bessere Huren und tanzten natürlich auch recht freizügig. Alleine das würde schon Stoff für einen Roman bieten, aber es ist historisch belegt, das sie eine starke Frau an der Seite eines starken Kaisers war: Beamte wurden auf den Kaiser und seine Kaiserin vereidigt, sie war Mitregentin und solange der Kaiser nicht widersprach, war ihr Wort Gesetz. Sie übernahm während einer Erkrankung des Kaisers kurze Zeit sogar vollständig die Regierungsgewalt, sie war ihm ebenso eine kluge Beraterin: Während des Nika-Aufstandes war Kaiser Justinian schon bereit, aus der Stadt zu fliehen – überliefert ist folgender Ausspruch Theodoras: „Das Purpur ist das schönste Leichentuch.“ (Nur Kaiser und Könige durften diese Farbe tragen bzw. konnten sie sich leisten). Sie riet ihm, zu bleiben, und der ebenfalls legendäre Feldherr Belisar sowie der Kämmerer Narses schlugen den Aufstand blutig nieder – Justinian blieb daraufhin noch Jahrzehnte an der Macht, die Weltgeschichte hätte ohne Theodora einen ganz anderen Verlauf nehmen können, wenn man sein Lebenswerk betrachtet: Sein Feldherr Belisar eroberte weite Teile der damaligen Welt, näher war Ostrom nie mehr an der flächenmäßigen Ausdehnung des römischen Reiches als zur Zeit Justinians. Ebenso ist er für die „Codex Justinianus“ genannte Rechtssammlung und seine Bautätigkeit berühmt: Unter ihm wurde die bei einem Erdbeben beschädigte Kuppel der Hagia Sophia restauriert, deren Bau bereits zuvor unter seiner Herrschaft beendet wurde. Seine Schließung der athenischen Akademie neuplatonischer Philosophie 529 n.Chr., um den Einfluss des Heidentums in Bildung und Wissenschaft zu verringern, wird oft auch als Ende der Spätantike und Beginn des Mittelalters angesehen.
Über diese herausragenden historischen Persönlichkeiten schreibt Kay, der Mosaikleger Crispin ist oft genug nur Beobachter und Zeuge historischer Ereignisse. Da der englische Zyklus aus zwei Bänden bestand, die in der deutschen Fassung auf vier aufgeteilt wurden, möchte ich hier stellvertretend den gesamten Zyklus bewerten: Am Ende des ersten deutschen Bandes hat Crispin gerade mal den Fuß in die Stadt gesetzt. Um Verwirrung zu vermeiden, werde ich die geläufigen historischen Namensgebungen verwenden, damit keine Missverständnisse entstehen, wenn ich von Valerius = Justinian, Alixana = Theodora, Leontes = Belisar und Gesius = Narses spreche.
Eine Übersicht der Handlung zu geben, halte ich für unangebracht: Kay hält sich sehr eng an die tatsächliche Geschichte, erst im vierten und letzten Band weicht er ab und bringt seine Version, wie sich unter gewissen Umständen das byzantinische Reich hätte entwickeln können.
Vielmehr wird ein beeindruckendes Bild der Stadt gemalt: Der Leser nimmt an den Wagenrennen im Hippodrom von Byzanz teil, dieser Sport war damals populärer als Fußball und Formel 1 heutzutage zusammen. Politische Parteien definierten sich über ihre Zugehörigkeit zu einer Zirkuspartei, so waren die „Blauen“ eher Aristokraten, während die „Grünen“ mehr den Plebejern verbunden waren. So als würde Ferrari für die „rote“ SPD fahren. Allerdings waren Wechsel der Fahrer und hochrangiger Gönner zwischen den Parteien nicht ungewöhnlich, hohe Wetten, Mordanschläge und Prügeleien zwischen den Fraktionen waren an der Tagesordnung. Jede Partei bemühte sich um den erfolgreichsten Wagenlenker oder die begehrteste Tänzerin, auch von dem Mosaikleger Crispin würde man gerne wissen, welcher Patei er den Vorzug gewährt, was ihn aber nicht so sehr in Verlegenheit bringt wie sein erster Auftritt am kaiserlichen Hof.
Der Hof Justinians ist ein Musterbeispiel für die byzantinische Neigung zu Intrige, Verrat und Vetternwirtschaft. In diesem Haifischbecken macht sich Crispin unbewusst zahlreiche Freunde und Feinde, bevor er auch nur seinen ersten Satz zuende gesprochen hat. Hier wird Kays Bewunderung Justinians und Theodoras deutlich, die alle Züge ihrer Gegner im Voraus ahnen und Menschen mit einer Leichtigkeit manipulieren, wie Crispin Steinchen verlegt.
Ein besonders lustiger Vogel ist Prokopios von Caesarea, ein Chronist, der kein gutes Haar an Justinian und vor allem seiner Frau Theodora lässt: Seine Schriften werden gemeinhin als von Hass, Neid und Missgunst geprägt bezeichnet. Die eigene Kaiserin als Hure, die sich auf der Bühne mit Tieren paarte, zu bezeichnen, und sowohl ihr als auch ihren Hofdamen Untreue vorzuwerfen, ist starker Tobak. Intelligenz und Charakter vereinen sowie Erfolg haben, von der kleinen Tänzerin zur Kaiserin eines Weltreichs aufsteigen – so kann man sich Neider und Feinde schaffen.
Hier besteht in Kays Roman ein kleiner Unterschiede zur Historie: Theodoras mit Belisar verheiratete Hofdame Antonina (im Roman Styliane Daleina) wird hier von Prokopios ihre Untreue nicht zum Vorwurf gemacht, er steht vielmehr auf der Seite ihrer Familie: Justinians Vorgänger hat den damaligen Kandidaten für den Kaiserthron einem nie näher geklärten Attentat zum Opfer fallen lassen. Was Antonina/Styliane nie verziehen hat – ihre Nähe zu Theodora ist im Roman also weniger die einer Freundin, als die einer recht glaubhaft in der Nähe gehaltenen Feindin: Halte deine Freunde in der Nähe, und deine Feinde noch näher.
Kay führt zahlreiche weitere Figuren ein, die das alte Byzanz wiederspiegeln: Den Legionär Carullus und die von Crispin befreite Sklavin Kasia, den Weiberheld und erfolgreichsten Wagenlenker der Blauen, Scortius, bis hin zu einem sassanidischen Heiler und seiner Familie, die als Spione in Byzanz verweilen.
Crispin kommt mit den meisten in Kontakt, Kay erzählt oftmals die Geschichte der jeweiligen Personen aus ihrer individuellen Perspektive, stets jedoch in der dritten Person. Man sollte allerdings in byzantinischer Geschichte gut bewandert sein: Sonst kann man vieles nicht genießen, insbesondere die seltenen Fälle, wenn Kay ausnahmsweise eigene Wege geht und die Geschichte interpretiert; es hätte nicht geschadet, wenn er dies öfter getan hätte. So fehlt einige Zeit lang jegliche Handlung, vielmehr wird die Geschichte nacherzählt, zwar mit beeindruckenden individuellen Sichtweisen, aber eben ohne echten Spannungsbogen. Das stört etwas, andrerseits sind Justinian, Theodora sowie Narses und Belisar durch Kays hohe Erzählkunst so gut zum Leben erweckt, dass man trotzdem weiterliest. Schade ist, dass er erst im vierten und letzten Band versucht, eine eigene Intrige zu spinnen, leider ist dieses Komplott eher schlicht ausgefallen und wird auch sehr rasch abgehandelt – Kay ist zwar ein hervorragender und sprachlich ausgereifter Erzähler, aber sich eigene Geschichten auszudenken, ist gewiss nicht seine Stärke. So kann es nicht verwundern, dass Kay oft eine langatmige Schreibweise vorgeworfen wird. Sein Zauber kann nur greifen, wenn man gewisse Grundkenntnisse der Epoche, über die er schreibt, besitzt. Das trifft auf die meisten Romane Kays zu, auf den Sarantium-Zyklus im Besonderen.
Mich verwundert, dass dieser Roman unter Fantasy geführt wird: Hier liegt ein lupenreiner historischer Roman vor. Das einzige fantastische und übernatürliche Element stellen kleine Vogelanhänger dar, von denen der Alchimist Zoticus Crispin einen schenkt. Das Schmuckstück enthält die Seele einer Frau, Linon, die einem heidnischen Waldgott geopfert wurde. Für die Handlung sind aber eher ihre amüsanten, frivolen, ironischen bis sarkastischen Einwürfe und Zwiegespräche mit Crispin von Bedeutung. Für mehr leider aber auch nicht.
Der „Sarantium“-Zyklus ist ein Leckerbissen für Liebhaber historischer Romane, die anspruchsvolle Erzählungen schätzen und das dringend benötigte Vorwissen mitbringen. Atemberaubend schöne und gefährliche Frauen, elendig leidende Sklavinnen, lüsterne Eunuchen und berechnende Machtmenschen in einer Welt voller Intrigen und tödlicher Wagenrennen, das bietet dieser Zyklus. Guy Gavriel Kay half nicht umsonst Christopher Tolkien beim Lektorat des „Silmarillion“, er ist sprachlich sehr versiert und ein großartiger Erzähler. Die deutsche Übersetzung ist sehr gut, das englische Original ist dennoch besser – in der deutschen Version ist sein Schreibstil wirklich oft etwas langatmig, was auch an seiner in meinen Augen großen Schwäche liegt: Faszinierende Charaktere und Episoden werden durch keine übergreifende Handlung miteinander verbunden. Kay hätte gut daran getan, seine Intrige zu verfeinern und schon zwei Bände früher eine wirklich große, raffinierte, „byzantinische“ Intrige zu spinnen, anstelle eines kurzen Strohfeuers im letzten Band. Bedauernswert, denn ohne dieses Manko würde der Zyklus sowohl ein breiteres Publikum ansprechen als auch an Klasse gewinnen. Dennoch ist der Zyklus insgesamt sehr empfehlenswert.
Als zugänglichere Alternative für historisch weniger bewanderte Leser, die trotzdem gerne etwas über diese Zeit erfahren würden, bieten sich die Romane von Lindsey Davis (Marcus Didius Falco) und die SPQR-Reihe von John Maddox Roberts an.
DER SARANTIUM-ZYKLUS (The Sarantine Mosaic):
Das Komplott (ISBN 3453188063)
Das Mosaik (ISBN 345318811X)
Der Neunte Wagenlenker (ISBN 3453196279)
Herr aller Herrscher (ISBN 3453196341)
Tipp: Da die deutschen Ausgaben derzeit (April 2004) vergriffen (tatsächlich scheinen sämtliche deutsche Fassungen der Kay-Bücher vom Markt zu sein, auch jene beim Goldmann-Verlag, was wohl mit den Veränderungen bei Random House zusammenhängen dürfte) und nur als Paperbacks verfügbar sind, sollten des Englischen überdurchschnittlich Kundige ruhig zu den englischen Hardcovern „Sailing to Sarantium“ und „Lord of Emperors“ greifen, die sich noch im Handel befinden und leichter erhältlich sind.
Homepage des Autors:
[Justinian und Theodora]http://www.muenster.org/abendgymnasium/faecherprojekte/projekte/mosaiken_ravenna/justiniantheodora.htm
Hornung, Erik – geheime Wissen der Ägypter und sein Einfluß auf das Abendland, Das
Mit diesem Buch liegt eine weitere faszinierende religions- und kulturwissenschaftliche Studie aus dem dtv-Verlag vor, die gleichzeitig akademischen wie an einem weiteren Publikum orientierten Ansprüchen gerecht wird. Der neben Jan Assmann wohl bekannteste deutsche Ägyptologe Erik Hornung (u.a. „Der Eine und die Vielen. Ägyptische Göttervorstellungen“) wendet sich hier sozusagen der europäischen Seite Ägyptens zu – also der Frage, welches Bild von Ägypten sich die Abendländer über die Jahrhunderte hinweg vom Land der Pharaonen und Pyramiden machten. Es geht ihm dabei nicht in erster Linie um die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft zur ägyptischen Kultur, sondern um das esoterische Bild von Ägypten: Hornung nennt es Ägyptosophie. Es ist die Vorstellung von Ägypten als dem Ursprungsland der Einweihungen, des Geheimwissens und des Gottes Thoth, der im alten Griechenland zum Gott der Magie wurde und unter dem Namen Hermes Trismegestos eine Rolle in der europäischen Geistesgeschichte spielte.
Beim Lesen wird einem schlagartig bewusst, wie sehr ägyptische Überlieferungen und Legenden auf Europa gewirkt haben. Auch wenn natürlich die anderen alten Hochkulturen wie z.B. Babylonien oder China hier genauso rezipiert wurden, hat keine von ihnen die Popularität Ägyptens erreicht – außer vielleicht Indien, das interessanterweise schon bei den Griechen in einem Atemzug mit Ägypten genannt wurde, wenn es um den Ursprung göttlicher Weisheit ging. Ägypten ist demzufolge nicht nur ein exotisches, weit entferntes Land, sondern ein Symbol, das durch eine lange Tradition in Europa heimisch geworden ist.
Für einen renommierten modernen Wissenschaftler wie Hornung ist es ungewöhnlich, dass er dieses esoterische Ägyptenbild nicht etwa verdammt und als bestenfalls kulturgeschichtlich interessante Kuriosität belächelt. Nein – mit Erstaunen liest man Sätze wie den folgenden: „Trotzdem sollte es viel mehr Brücken und weniger Berührungsängste zwischen den Fachwissenschaften und der Esoterik geben, das wäre für beide Seiten fruchtbar.“ (S. 10) Weiterhin wendet sich Hornung deutlich gegen den Elfenbeinturm einer abgeschlossenen Fachwissenschaft. Er sieht es als ein beflügelndes Ziel für den Ägyptologen, an der Verwirklichung einer neuen geistigen Renaissance mitzuschaffen – ein Traum, wie er zugibt, aber kein unmöglicher. Er fordert von der Ägyptologie, dass sie den Kontakt mit der Öffentlichkeit suchen sollte, da Ägypten schließlich anregend auf Kunst, Musik und Alltagskultur gewirkt habe. Der hermetischen Weltsicht, also den sich u.a. auf Ägypten berufenden Weisheitssystemen, spricht er einen wichtigen Beitrag für die Sinngebung in unserer modernen Welt zu.
Den Leser erwartet also ein Buch, das weitgehend vorurteilsfrei mit seinem Thema umgeht. In dieser Hinsicht dürfte es bislang einmalig sein. Hornung kritisiert nur dort, wo sich das esoterische Bild zu sehr von den rekonstruierbaren Fakten entfernt. Ansonsten versucht er in allererster Linie zu verstehen und nachzufühlen. Für den Leser wird das Buch dadurch umso spannender.
Das Werk ist chronologisch aufgebaut, und so beginnt Hornung mit den altägyptischen Wurzeln für das esoterische Ägyptenbild. Dabei erfahren der schon erwähnte Gott Thot und der Mythos vom Weg der Sonnenbarke eine besondere Beachtung, welche ein bestimmendes Element in den Vorstellungen der Ägypter über das Jenseits darstellten. Initiationen in ein geheimes Wissen hat es nach allen bislang gewonnenen Erkenntnissen dort nicht gegeben. Ganz im Gegenteil – der Kult in Ägypten war ein Staatskult und von öffentlichen kollektiven Ritualen geprägt, die auf eine Regeneration der Menschen, auf eine Rückkehr in die Zeit der Mythen und der Schöpfung abzielten. So wurden z.B. der Mythos von Tod und Auferstehung des Gottes Osiris oder das Wiederfinden des Horuskinds durch die Gottesmutter Isis in riesigen Prozessionen dargestellt. Das war kein Theater, sondern wurde als ganz unmittelbare Wirklichkeit empfunden. Eine Einweihung in Mysterien (wie in dem Mysterienkult, der sich auf Isis bezog) hat es erst in griechischer Zeit, während des Hellenismus, gegeben. Die Vorstellung, dass die Menschen aus einem harmonischen paradiesischen Ursprungszustand in den unvollkommenen Zustand der Welt abfielen, gab es allerdings schon im alten Ägypten. Das „Buch von der Himmelskuh“ um 1350 v.Chr. spricht von einem Zusammenleben der Menschen mit den Göttern, das durch eine Empörung der Menschen gegen den Sonnengott beendet wurde. Die Menschen verfielen damit dem Alterungsprozess und dem Tod. In Ägypten liegt also eine der Wurzeln für die späteren gnostischen Vorstellungen.
Im hellenistischen Griechenland brachte man ägyptischer Priesterweisheit sehr viel Ehrfurcht entgegen. Von berühmten Gelehrten wie beispielsweise Pythagoras behauptete man, dass sie bei diesen Priestern in die Lehre gegangen wären. Obwohl die Astrologie nachweislich aus Babylonien stammt, wurde auch ihr ein ägyptischer Ursprung zugewiesen. In Griechenland liegt der Beginn alchemistischer Lehren, in deren Mittelpunkt allerdings der um 300 n. Chr. wirkende Ägypter Zosimos steht.
Hornung beschäftigt sich im folgenden eingehend mit der Gnosis und dem Corpus Hermeticum, einer Schrift, die sich als direkte Offenbarung des Gottes Hermes darstellte. In diesem Zusammenhang taucht auch der Name Imhotep auf, der im populären Bewusstsein heute durch einige Filme mit dem Bild der rachelüsternen lebenden Mumie verbunden wird, in Ägypten und Griechenland aber als Sinnbild des Weisen galt und mit dem griechischen Heilgott Asklepios identifiziert wurde.
Es folgen Kapitel über den Eingang ägyptischer Motive in das Christentum (Jesus wird in koptischen Überlieferungen beispielsweise als Magier betrachtet, der von einem Ägypter diese Kunst erlernt hat), über die Hieroglyphenmystik in der Renaissance und über die ersten Versuche frühneuzeitlicher Gelehrsamkeit, Ägypten zu deuten. Danach lenkt Hornung den Blick auf die geheimen Bruderschaften, die vom 17. bis ins 20. Jahrhundert hinein entstanden und sich dabei auch von ägyptischer Symbolik bzw. deren Abwandlungen inspirieren ließen. Geradezu als Erben ägyptischer Weisheit traten die ersten Theosophen auf. Helena Blavatsky, Begründerin der Theosophie, sah in den Pyramiden Einweihungsstätten.
Auch für Rudolf Steiner und die Anthroposophie wurde Ägypten wichtig. Steiner schrieb mehrere Mysteriendramen, von denen „Der Seele Erwachen“ Einweihungszenen in einem ägyptischen Tempel vorführt. In Vorträgen lehrte Steiner, dass sich die Ägypter der Mumifizierung bedienten, um die Verstorbenen daran zu hindern, aus der geistigen Welt wieder auf die Erde hinabzusteigen. Bei ihm findet sich auch ein Anklang an den modernen „Fluch der Pharaonen“, da er den Mumien eine Art „Giftatmosphäre“ und magische Drohung zuschrieb, die ihnen eingepflanzt wurde und auch heute noch tödlich wirken könne. Der modische „Mumienkult“ wird ebenfalls in einem eigenen Kapitel beschrieben. Hornung gibt eine Überschau ägyptischer Motive in der modernen Esoterik (z.B. das Tarot, Aleister Crowley, Reinkarnationsvorstellungen) und wirft einen Blick auf die afrozentrische Bewegung, die uralte ägyptische Kultur als Vorläufer einer schwarzafrikanischen Identität instrumentalisieren will.
Das Buch endet mit der Frage, inwieweit Ägypten uns Europäern mit seiner andersartigen Jenseitsvorstellung, seiner auf der Göttin Maat beruhenden pragmatischen Ethik und einem ganzheitlichen Denken, das in der Naturwissenschaft heute ja wieder auftaucht, eine Alternative vor Augen stellen und Impulse für eine neue Kultur geben kann. Man kann nur hoffen, dass Hornungs offener Ansatz in diesem Buch Nachahmer bei seinen Fachkollegen finden wird.
Thorne, Tony – Kinder der Nacht
Vampirliteratur wird ja gern in die Schublade der „Unterhaltungsliteratur“ gesteckt und ruft hierzulande bei seriösen Wissenschaftlern nur ein Naserümpfen hervor. Im Land von Goethe und Schiller will man mit dem großen „U“ nichts zu tun haben. Dabei wird dann die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem uralten und weltumspannenden Mythos des Vampirs gleich mit wegrationalisiert, will man doch die mögliche Stigmatisierung vermeiden. Der angloamerikanische Raum ist da nicht so pingelig. Dort widmet man sich nicht nur mit Hingabe der Untersuchung von Kriminalliteratur, sondern eben auch dem Horror. Deswegen wird es auch nicht verwundern, dass der Autor des vorliegenden Bandes, Tony Thorne, Professor am Londoner King’s College ist. Sein Buch mit dem recht populärwissenschaftlichen Titel „Kinder der Nacht. Die Vampire sind unter uns“ erschien erstmals 1999 und wagt einen fundierten, wenn auch unterhaltsamen Rundumschlag in das Land der Vampire.
Dabei ist Thornes Ansatz ganz klar ein kulturhistorischer. Er widmet sich nur am Rande den literarischen oder filmischen Inszenierungen des Vampirs. Natürlich werden Meilensteine wie Polidoris „Der Vampyr“ oder Stokers [„Dracula“]http://www.power-metal.de/book/anzeigen.php?id_book=210 vorgestellt. Auch filmische Highlights finden neben der humoristischen Betrachtung absoluter Tiefpunkte der Filmkunst Eingang in das Buch. Doch Thornes eigenliche Prämisse ist es, den sich wandelnden Mythos des Blutsaugers in verschiedenen Kulturen und über die Zeiten hinweg zu verfolgen.
So stellt er zunächst fest, dass der (mythische) Urvampir weiblich gewesen ist. Ausgehend von weiblichen Blutsaugern wie den lamia oder styx kommt er zur Königin der frühen weiblichen Vampire: Lilith, die nach dem jüdischen Glauben die erste Frau Adams war. Allerdings war sie nicht gefügig, wollte sie doch beim Geschlechtsverkehr nicht unter Adam liegen, mit der Begründung, sie seien beide ebenbürtig. Die beiden kommen zu keiner Einigung und Lilith flieht. Von da an wird sie zu einer Ausgestoßenen, die kleinen Kindern die Lebensenergie aussaugt.
Von diesen mythischen Ursprüngen kommt Thorne dann bald zu „realen“ Vampiren und Vampirplagen. Personen, die immer wieder in die Nähe des Vampirismus gestellt wurden, sind zum Beispiel Vlad Tepes (ein grausamer mittelalterlicher Feldherr), die Blutgräfin Elisabeth Bathory (die im Blut von Jungfrauen badete, um ihre Jugend zu erhalten) oder der Serienmörder Peter Kürten (der im Köln der 1930er Jahre unzählige Morde beging). Natürlich sind all diese Personen in diesem Buch vertreten. Doch auch die Vampirplagen des 18. Jahrhunderts werden näher untersucht. So wurden in südosteuropäischen Gegenden Leichen ohne zu fackeln exhumiert, wenn man annahm, sie wären Wiedergänger. Da zu diesem Zeitpunkt kaum Kenntnisse darüber bestanden, was mit einer Leiche geschieht, nachdem sie beerdigt ist, wurden Merkmale (z.B. rosige Haut, das vermeintliche Weiterwachsen von Haaren und Nägeln, die spitzer gewordenen Zähne) falsch interpretiert. Doch auch in der Neuen Welt gab es „Vampirplagen“. In Neuengland schien man die Tuberkulose mit Vampirismus zu verwechseln und exhumierte ganze Familien, um sie zu pfählen und zu köpfen.
Vom nordamerikanischen Kontinent bewegt sich Thorne abwärts nach Lateinamerika, wo es noch in den 1990er Jahren einen kuriosen Fall von Vampirismus gab, der hier erstmals in Buchform dokumentiert ist. Der Fall des Chupacabras, einer Mischung aus Roswell-Alien und blutsaugendem Tier, zeigt deutlich, wie alte Mythen und Ängste (die Angst vorm Vampir) mithilfe von Massenmedien auch eine Massenhysterie auslösen können. Und wenn diese eigentlich lächerliche Geschichte eines beweist, dann ist es die Tatsache, dass das wohlige Gruseln vorm Vampir in unserer aufgeklärten Zeit keineswegs anachronistisch ist. Der Mythos des Vampirs ist so langlebig und wandelbar, weil er Urängste verkörpert, die uns auch in unserer modernen Zeit noch nicht in Ruhe lassen. Er verkörpert die Angst vor den Toten, die Ungewissheit dessen, was nach dem Sterben kommen mag und er verkörpert auch die Angst vor dem Verlust der eigenen Lebensenergie (des Blutes).
Ebenfalls hochaktuell ist Thornes Betrachtung der nordamerikanischen Real Vampires, die gerade durch neue Technologien wie das Internet einen Aufschwung erlebt haben. Dabei handelt es sich um Menschen, die sich selbst als Vampire bezeichnen. Entweder sie trinken tatsächlich Blut – was meist im Zusammenhang mit sadomasochistischen Sexpraktiken passiert. Oder sie bezeichnen sich als Psychovampire und ernähren sich von der Lebensenergie ihrer Mitmenschen. Katherine Ramsland hat sich in ihrem Buch „Vampire unter uns“ ebenfalls in die Szene der Real Vampires begeben, doch Thorne liefert die weniger blumige Betrachtung, die dadurch aber kaum weniger schauerlich ist. Er bietet einen Einblick in eine Subkultur, die von schwarzgekleideten Gothics bis zu gewaltbereiten Psychopathen reicht.
Man merkt Tony Thorne seinen wissenschaftlichen Hintergrund an. Er betrachtet sein Thema sachlich, führt souverän durch Geschichte und historische Quellen und gleitet kaum ins Triviale ab. Trotzdem ist sein Buch eine unterhaltsame Lektüre, die an einigen Stellen von beschreibenden Szenen aufgelockert wird, in denen Thorne eine Vampir-Convention besucht oder im heutigen Slowenien ein „Vampirgrab“ auszumachen versucht. Der Erkenntnisgewinn an diesen Stellen tendiert natürlich gegen Null, Thorne schafft es aber hier, eine Atmosphäre zu evozieren, die den Leser gleichsam in die Vampirszene mit hineinzieht und neugierig darauf macht, was dieser Mythos wohl für den Einzelnen parat hält.
Davon abgesehen ist Thorne aktuell und ausführlich. Das sieht man nicht nur an seiner Rekonstruktion der „Chupacabras“-Geschichte, sondern auch an seiner ausführlichen Anaylse des Lilith-Mythos, der bisher in der Vampirliteratur seinesgleichen an Genauigkeit sucht. Was seinem Anspruch an Wissenschaftlichkeit und Seriösität allerdings Abbruch tut, ist das totale Fehlen von Fußnoten, die der interessierte Leser an vielen Stellen schmerzlich vermisst. Auch ein Literaturverzeichnis, in dem zitierte und benutzte Werke zumindest aufgeführt wären, fehlt komplett. So passiert es dann, dass Zitate entweder nur einem Autor (nicht aber einem Werk) zugeordnet werden oder komplett ohne Angabe frei im Text stehen. Das wirft ein schlechtes Licht auf Thorne und macht das Buch ungeeignet für eine wissenschaftliche Weiterverwendung.
Wen das allerdings nicht stört, der hat mit „Kinder der Nacht“ einen hervorragenden Einstieg in den Vampirmythos, der umfassend über die verschiedenen Aspekte (Literatur, Geschichte, Film, Subkultur) des Vampirs informiert.
Frances Sherwood – Die Schneiderin von Prag oder Das Buch des Glanzes

Frances Sherwood – Die Schneiderin von Prag oder Das Buch des Glanzes weiterlesen
Simon Scarrow – Im Zeichen des Adlers
Für Gaius Julius Cäsar endete der Britannien-Feldzug des Jahres 54 v. Chr. mit einer doppelten Niederlage. Der spätere Herrscher des Römischen Imperiums wurde von den Inselbewohnern vertrieben. Im Tumult blieb eine riesige Truhe mit geraubten Schätzen zurück; sie konnte im letzten Augenblick versteckt werden.
Knapp einhundert Jahre später plant Imperator Claudius eine neue Invasion Britanniens. Außerpolitischer Erfolg tut Not, denn der Herrscher ist unbeliebt. Truppen werden in Gang gesetzt. Darunter befindet sich auch die in der germanischen Provinz stationierte Zweite Legion, genannt „Augusta“: fünfeinhalbtausend Männer, die zu den besten Soldaten des Reiches gehören. Simon Scarrow – Im Zeichen des Adlers weiterlesen
Stephen Lawhead – Die Tochter des Pilgers (The Celtic Crusades)
VORGESCHICHTE
Da es sich bei „Die Tochter des Pilgers“ um den letzten Teil der Trilogie „Die Keltischen Kreuzzüge“ von Stephen Lawhead handelt, möchte ich eine kurze Zusammenfassung voranstellen:
Im Jahre 1095 erhören viele Adelige den Ruf des Papstes, der zum Kampf gegen die Ungläubigen im fernen Outremer auffordert. Auch der Vater und die beiden älteren Brüder Murdo Ranulfsons begeben sich auf den Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems.
Band 1: Das Kreuz und die Lanze (Taschenbuch: Der Sohn des Kreuzfahrers)
In ihrer Abwesenheit verliert die Familie durch Intrigen der Kirche ihr Hab und Gut, und Murdo den Glauben an Gott. Er reist seinem Vater nach, um mit ihm und seinen Brüdern ihre Rechte geltend zu machen. Doch sein Vater stirbt, seine Brüder wollen nicht mehr nach Hause. Stattdessen verschreibt sich Murdo der Sache der Célé Dé („Fromme Aufgabe“), einer Gemeinschaft frommer Mönche, die sich dem „wahren Glauben“ verschrieben hat und dem Papst und seiner Kirche kritisch gegenüberstehen. Er rettet die heilige Lanze, mit der Jesus Christus‘ Tod festgestellt wurde, vor Moslems und dem Kaiser von Byzanz und versteckt sie in einem Kloster in seiner Heimat.
Band 2: Der Gast des Kalifen
Sein Sohn Duncan begibt sich Jahre später ebenfalls auf eine abenteuerliche Pilgerfahrt, auch er schließt sich den Célé Dé an und bringt einen Teil des wahren Kreuzes Christi zurück in die Heimat, trotz der Nachstellungen von Templern und Assassinen.
Band 3: DIE TOCHTER DES PILGERS
Im letzten Band der Trilogie wird Duncan in Byzanz von Templerkomtur de Bracineaux ermordet, seine Töchter Caitriona und Alethea schwören Rache für den Tod ihres Vaters. Doch auch Caitriona wird auf die Sache der Célé Dé eingeschworen: Anstelle die Gelegenheit zu nutzen und de Bracineaux zu erdolchen, stiehlt sie ihm ein geheimes Schriftstück, das von einer geheimnisvollen mystischen Rose spricht, die in Spanien in die Hände der Mauren zu fallen droht. Es stellt sich bald heraus, dass es sich um den heiligen Gral selbst handelt. Mit von ihr aus der Sklaverei freigekauften norwegischen Rittern macht sich Caitriona auf die Reise. Doch die Templer verfolgen sie, ihre Schwester Alethea wird von maurischen Banditen verschleppt und Caitriona droht den Verführungskünsten des Maurenfürsten Hassan zu erliegen. Beim Hort des Grals treffen der mordlustige Templerkomtur und seine Schergen mit Caitriona, ihren Begleitern und den Mauren zusammen…
Soweit die Zusammenfassung der Trilogie „Die Keltischen Kreuzzüge“ von Stephen Lawhead. Der Autor, ein Kenner der britisch-keltischen Geschichte und Sagenwelt, wurde in Deutschland vor allem durch das „Lied von Albion“ und den Pendragon-Zyklus bekannt. Sein Bestseller „Byzantium“ wurde in Deutschland unglücklich in zwei Bände aufgespalten, die in Deutschland „Aidan, Die Reise nach Byzanz“ und „Aidan in der Hand des Kalifen“ heißen.
Interessanterweise hat dieses Buch Pate für weite Teile der Handlung der gesamten Trilogie gestanden, in der jedes der drei Bücher nach dem Schema „Reise nach Jerusalem“ abläuft. Im Handlungsverlauf ergattert der jeweilige Held aus der Familie Murdosson dann eine heilige Reliquie, wird vom Zweifler zum frommen Christen und kehrt damit in die Heimat zurück – grob vereinfacht.
Auch Caitriona, die namensgebende „Tochter des Pilgers“ (Duncan), stellt hier keine Ausnahme dar. Die Trilogie leidet jedoch sehr unter diesem Schema: Im Eiltempo wird man durch zahlreiche Orte Europas und des nahen Ostens gehetzt, wobei meistens nur Zeit für oberflächliche Betrachtungen bleibt. Erschwerend kommt hinzu, dass der dritte Teil keinen wirklich befriedigenden Abschluß der Trilogie bietet: Alle drei Bände wurden von einem Nachfahren Murdos, der zur Zeit des 1. Weltkriegs lebt, als Erinnerung aus der Familienchronik erzählt. Er wird gerade in den inneren Kreis des Ordens der Célé Dé initiiert und berichtet quasi zu jeder Reliquie die Geschichte des jeweiligen Buches. Mehr aber auch nicht – die mystische Verbrämung der ersten beiden Bände um die Ziele der Célé Dé, was ziemlich verwirrend wirkte und die Bücher unvollständig erscheinen ließ, wird auch im letzten Band nicht aufgeklärt. Diese unnötig aufgeblasene Rahmenhandlung, die nur dem Zwecke der Erzählung diente und den Leser mehr erwarten ließ, ist aber nur eine der Schwächen der Konzeption der gesamten Trilogie.
Ob sich Caitriona nun in Spanien bei den Mauren oder in Damaskus aufhält: Moslems haben hier und dort die gleichen Sitten, die gleiche Sprache. Da das Buch dialoglastig ist, könnte man eigentlich auch völlig auf die jeweilige Beschreibung der Örtlichkeit verzichten. Man muss nur die Kapitelüberschrift austauschen und darauf achten, in Spanien natürlich spanische Ritter als Eskorte zu bemühen.
Historische Patzer und/oder Übersetzungsfehler finden sich in Hülle und Fülle; hier zeigt sich, dass Lawhead zwar ein Keltizismus-Experte und Kenner des alten Byzanz ist, aber in Bezug auf die Templer sowie die Geographie und Geschichte Spaniens erlauben er und sein Lektor sich einen Fehler nach dem anderen: Orte werden irrtümlich zwischen Kastilien, Leon und Aragorn vertauscht, das Königreich Navarra hat Lawhead wohl ganz übersehen. Abgesehen von der Geographie sind Verhalten und Bräuche ebenso verfälscht worden: Bei einer Leichenverbrennung als Bestattungsform hätten sowohl Odin als auch Allah sich gewundert, besonders wenn diese von einem schon vor Jahrhunderten christianisierten Norweger und einem Almohaden durchgeführt wird. Wenn der zuvor als superfromm geschilderte norwegische Ritter Rognvald dann auch noch einen Erzbischof belügt, dass sich die Balken biegen, dann ist das noch lange nicht so schlimm wie die Groschenroman-Show von Fürst Hassan: Dieser versucht durchaus gekonnt und lesenswert – hier dachte ich kommt etwas Feuer und Würze in die Geschichte – Caitriona zu verführen, die ihm auf den Leim geht und den Warnungen ihrer Begleiter kein Gehör schenkt. Aber wie endet es? Grundlos peitscht Hassan seine Frau, die er bisher als seine Schwester ausgegeben hat, aus, Caitriona erwischt ihn und er entschuldigt sich, verspricht ihr weiterhin Unterstützung und damit ist die Sache gegessen – Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn mir jetzt jemand erklären könnte, wie ein Maure auf die Idee kommt, seine Frau zu verheimlichen und als Schwester auszugeben, nur weil er eine Christin verführen will, und warum es an dieser Stelle keinen weiteren Konflikt mehr gibt, wäre ich sehr dankbar…
Nun, die Handlung erfordert es eben! Ich hatte den Eindruck, hier wurde Lawhead zu einer drastischen Kürzung bzw. Änderung genötigt. Das Buch ist das deutlich kürzeste der Trilogie. Diesmal hat Lawhead auch bei den Figuren geschlampt: Caitriona ist zwar überzeugend und ähnlich streitbar wie der alte Murdo, ihre resolute Art kann unter Umständen nerven, besonders im Gespann mit ihrer – von ihr selbst zu Recht – als Nervensäge bezeichneten kleinen Schwester Alethea. Diese wird, hier möchte ich nicht zuviel verraten, eine Wandlung durchmachen, die hopplahopp und nicht nachvollziehbar geschieht. Über das seltsame Verhalten des Maurenfürsten Hassan habe ich schon geschrieben, ebenso über die Unstimmigkeiten beim ansonsten sehr glaubwürdig charakterisierten Ritter Rognvald. Der Templerkomtur de Bracineaux ist eindeutig überzeichnet als Schurke. Im zweiten Band wurde er weitaus differenzierter geschildert. Hier ist er mordlustig, herrisch und von fanatischem Eifer besessen. Lawhead wollte wohl die wohlbekannte Arroganz der Herren vom Tempel darstellen, macht das jedoch so übertrieben, dass de Bracineaux unglaubwürdig wird. Gelungener ist schon sein Begleiter, ein beherrschter, distinguiert-herablassender Templerbaron aus Frankreich. Nur… seit wann behält man seinen Titel, wenn man in den Templerorden eintritt?
Zusammfassend kann man sagen, dass nicht die zahllosen Fehlerchen dem Buch und der Trilogie das Genick brechen. Es ist vielmehr das andauernd wiederholte Reiseschema, das von einem oberflächlich und glanzlos beschriebenen Schauplatz zum nächsten führt. Die im ersten Band sanft angedeutete Kritik an Papst und Kirche wurde wohl aus Gründen der politischen Korrektheit in den Folgebänden vollständig fallengelassen, ebenso wie eine vernünftige Definition der Ziele der Célé Dé, die zur belanglosen Nebenhandlung bei der so etwas sinnentleerten Reliquiensammlung wurden. Offensichtlich, so zeigt das Auftauchen des geisterhaft-mysteriösen Bruder Andreas, das stets mit der Rekrutierung eines Murdosson endet, handelt die Sekte im Auftrag Gottes. Einen Abschluss schafft der dritte Band nicht. Ein unbefriedigendes „warum?“ bleibt im Raum stehen.
Lawhead kann es besser – „Byzantium“ ist historisch exakter, hat eine spannendere Rahmenhandlung und wiederholt nicht ständig dasselbe Schema. Blasse Charaktere mit unpassenden, unglaubwürdigen Handlungen geben dem Buch den Rest. Nur die grundsätzlich in meinen Augen hochinteressante Thematik der Trilogie sowie der angenehme und gefällige Schreibstil Lawheads bewahren das Buch vor einem totalen Desaster – die Reise nach Spanien war mit Abstand die langweiligste, viel andalusisches Flair habe ich nicht gerade erfahren dürfen.
Auf der Habenseite kann das Buch zusätzlich eine qualitativ hochwertige Bindung und optisch überzeugende Präsentation aufweisen, die sich auch im Buch selbst fortsetzt, abgesehen vom irreführenden und unpassenden Klappentext, der falsche Versprechungen macht.
Das Buch ist eine wunderschöne Mogelpackung, die sich auf Groschenroman-Niveau bewegt, und das schwächste der ganzen Trilogie, die so viel verspricht – und so wenig hält. Wer schon den Anfangsband nicht mochte, sollte dieses Buch gar nicht erst lesen. Ich kann weder „Die Tochter des Pilgers“ noch die Trilogie „Die Keltischen Kreuzzüge“ empfehlen, die von Band zu Band schwächer wurde, was Lawheads schwacher Konzeption des an und für sich hochinteressanten Stoffes anzulasten ist.
Kritiken der gesamten Trilogie „Die Keltischen Kreuzzüge“ bei _Buchwurm.info_:
Das Kreuz und die Lanze bzw. Der Sohn des Kreuzfahrers (Hardcover bzw. Taschenbuch)
Der Gast des Kalifen
Die Tochter des Pilgers (diese Kritik)
Taschenbuch : 574 Seiten
Homepage des Autors: http://www.stephenlawhead.com/
Erskine, Barbara – Herrin von Hay, Die
Reinkarnation – Gab es ein Leben vor dem Leben? Die eine Gruppe von Wissenschaftlern legt Beweise dafür vor, die andere Gruppe widerlegt sie. Die Meinung darüber ist geteilt. In vielen Religionen bildet die Reinkarnation einen wichtigen Bestandteil des Glaubens.
In Barbara Erskines Debüt „Die Herrin von Hay“ lässt sich eine junge Jounalistin für einen Artikel durch Hypnose in die Vergangenheit zurückversetzen, genau wie viele Ärzte das heute mit ihren Patienten machen, um die Ursachen von Psychosen und anderen Krankheiten aufdecken und heilen zu können. Dabei ist es vorgekommen, dass die Hypnotisierten von einer Zeit vor ihrer Geburt erzählen, fremde Sprachen perfekt beherrschen, die sie vorher noch nicht konnten. Alles Humbug? Wie auch immer, „Die Herrin von Hay“ macht sich diese Berichte zunutze, um eine gelungene Story rund um die Seelenwiedergeburt zu erzählen.
Erskine, 1944 geboren, hat ihren Abschluss in mittelalterlicher schottischer Geschichte an der Universität von Edinburgh gemacht und schrieb mittlerweile Bestseller wie „Die Tochter des Phönix“, „Der Fluch von Belheddon Hall“ und recht neu „Das Lied der alten Steine“.
Joanna Clifford ist 19 Jahre alt, als sie sich im Rahmen klinischer Therapieversuche einer Regressionshypnose unterzieht und sie erfolgreich in die Vergangenheit zurückgeführt wird. Doch schon nach kurzer Zeit setzt ihre Atmung aus, denn ein furchtbares Erlebnis bewirkt einen Schock und der Arzt Dr. Sam Franklyn sowie der Wissenschaftler Professor Cohen können sie nur mühsam wieder zurückholen. Vorsichtshalber löschen sie bei der jungen Frau die Erinnerung an dieses Erlebnis.
26 Jahre später ist Jo eine knallharte, bissige Journalistin, mit Sam Franklyn immer noch befreundet, von dessen Bruder Nick frisch getrennt und davon überzeugt, Hypnose funktioniere nicht bei ihr. Aus dem Grund nimmt sie ihren neuen Auftrag auch gerne an: Reinkarnationstherapie. Sie will beweisen, dass alles ein Schwindel ist. Als Nick davon erfährt, verständigt er seinen Bruder und versucht sie davon abzuhalten, was nur dazu führt, dass Jo sich schließlich selbst hypnotisieren lässt und sich als Matilda de Braose im Wales des Jahres 1174 wiederfindet.
Matilda, eine selbstbewusste, schöne, junge Frau, wird in ihrem Leben zum Spielball von drei ihr nahestehenden Männern: Zuerst ihr grausamer Ehemann, der Baron William, dann der schöne, junge Earl Richard von Clare, dem ihr Herz gehört, und zuletzt der Königssohn und spätere König John Plantagenet, der aus zurückgewiesener Liebe zu ihrem größten Feind wird. Von ihrem Mann im Stich gelassen und vom König als Verräterin dem Hungertod ausgeliefert, kann auch Richard ihr nicht helfen.
Jo glaubt zunächst, dass das Erlebte pure Suggestion war, doch als sich Nicks Verhalten drastisch ändert und er ihr gegenüber aggressiver wird, beginnt sie zu forschen und immer öfter in Matildas Welt einzutauchen, bis ihr Leben mit dieser leidenschaftlichen Frau fast unauflösbar verbunden ist. Und auch Sam benimmt sich sonderbar und scheint einen grausamen Plan zu haben. Langsam wird klar, dass nicht nur Matildas Seele die Jahre überbrückt hat, sondern dass sich der Kampf zwischen den drei Männern im 20. Jahrhundert entscheiden wird.
Alle Achtung! Erskine ist gleich mit ihrem Debüt ein rasanter Paukenschlag gelungen. Das Tempo der Geschichte ist wirklich enorm und lässt den Leser stellenweise sogar das Atmen vergessen. Das Spiel mit den zwei zeitlich getrennten Spannungsbögen, die wiederum durch einen einrahmenden dritten massiv verstärkt werden, ist schon ein kleiner Geniestreich, den die Autorin meisterhaft beherrscht.
Ein flüssiger Schreibstil, bildhafte Ausdruckskraft und eine in sich schlüssige Geschichte runden das Ganze zu einem eindrucksvollen Lesevergnügen ab. Hinzu kommen glänzend ausgearbeitete Charaktere, die sich ineinander verstricken, miteinander spielen und dann wieder in zerstörerischer Wut aufeinanderprallen. Selbst Nebencharaktere gewinnen in ihren kurzen Auftritten an ungeheurer Aufmerksamkeit des Lesers, schwer, sich ihrer Lebendigkeit und Persönlichkeit zu entziehen.
Das Wales des 12. Jahrhundert hat die Autorin geschichtlich natürlich korrekt und enorm anschaulich beschrieben. Mit viel Detailtreue schildert sie das Leben auf Burgen, die schwierige Beziehung der Krone zu den walisischen Fürsten und natürlich das Schicksal der Frauen – machtlos, hilflos und abhängig von der Gnade oder eben Ungnade ihrer Ehemänner. Gerade die Figur der Matilda, die sich von einer energischen, leidenschaftlichen Frau zu einer auf die Knie gezwungenen, bemitleidenswerten Bittstellerin entwickelt, ist hervorragend beschrieben. Mit einer angefügten Zeittabelle und einer Erklärung zu den historischen Charakteren wird dem neugierigen Leser gleich mit auf dem Weg gegeben, welche Ereignisse dokumentarisch belegt sind und welche nur auf Vermutungen beruhen. Sehr schön!
Natürlich beantwortet der Roman die Frage nach der Existenz von Reinkarnationen nicht, aber wer bereit ist, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, verspürt vielleicht ja selbst die Neugierde, so eine Regressionshypnose mal auszuprobieren. Bildet euch eine Meinung, wie ihr wollt, aber lest dieses Buch, es lohnt sich einfach!
Eckart Peterich, Pierre Grimal – Götter und Helden

Eckart Peterich, Pierre Grimal – Götter und Helden weiterlesen
Lawhead, Stephen – Gast des Kalifen, Der (The Celtic Crusades)
Stephen Lawhead lässt in „Der Gast des Kalifen“, dem zweiten Band der „Celtic Crusades“-Trilogie, einen Sohn seines Helden Murdo eine Pilgerfahrt ins Heilige Land antreten.
Wie schon im Vorgänger „Das Kreuz und die Lanze“ ist das Ziel der Reise eine Reliquie von unschätzbarem Wert: Dieses Mal nicht die Heilige Lanze, sondern der Schwarze Stamm, Überrest des Wahren Kreuzes, an dem Jesus starb. Lawhead, der Theologie studierte, bietet auch diesmal wieder eine Melange aus mit Keltizismen vermischtem Christentum und katholischer Reliquienverehrung im Rahmen eines historischen Romans – garniert mit einem christlichen Geheimbund, der die Mission der frommen Männer aus dem Mittelalter auch in unserer Zeit fortsetzt.
Da alle drei Bände dieser Serie in etwa diesem Schema des braven Schotten, der zum Reliquiensammeln aufbricht, entsprechen, sind sie sich vom Stil und Inhalt sehr ähnlich, an dieser Stelle möchte ich zur besseren Orientierung eine Auflistung der Trilogie einfügen:
The Celtic Crusades
1. Das Kreuz und die Lanze (The Iron Lance)
2. Der Gast des Kalifen (The Black Rood)
3. The Mystic Rose (dt. Übersetzung Ende 2003 / 2004)
Achtung: Die Taschenbuchausgabe des ersten Bandes ist unter dem irreführend geänderten Titel „Der Sohn des Kreuzfahrers“ erschienen (siehe auch unsere Rezension dazu im Archiv).
Duncan’s Reise ins Heilige Land beginnt im schottischen Caithness. Murdo Ranulfson ist schon Jahre von seiner Kreuzfahrt zurückgekehrt, hat ein Stück Land erworben sowie die Eiserne Lanze, die den Leib Christi durchbohrte, der Obhut der Mönche der Célé Dé übergeben – und wurde selbst Mitglied des inneren Kreises dieser christlichen Sekte, die für das „wahre Christentum“ streitet, dem Papst und Kreuzfahrer nicht treu geblieben sind in ihren Augen.
Murdos Bruder Torf-Einar kehrt todkrank zurück, anstelle von Ruhm, Gold und Ehre fand er im Heiligen Land nur Habgier und Intrigen, er ist verarmt und körperlich am Ende. Bevor er stirbt, erzählt er Murdos Sohn Duncan vom Heiligen Land, auch vom Schwarzen Stamm, der vom Wahren Kreuz Christi stammt und in vier Teile getrennt wurde, da jedes Heer, das unter seinem Zeichen kämpfte, bisher den Sieg errang. Duncan ist fasziniert.
Torf stirbt, Duncans Frau kurze Zeit später im Kindbett. Duncan ist am Ende, er will Selbstmord begehen, wird aber von einem Freund, dem Mönch Padraig, daran gehindert. Mit neuem Lebensmut stellt sich Duncan eine Aufgabe: Er will ins Heilige Land und das Wahre Kreuz bergen. Murdo ist entsetzt, ihm selbst hat seine Kreuzfahrt während seiner Abwesenheit den Verlust seiner Ländereien durch skrupellose Kirchenmänner eingebracht, und sie verlief ganz anders als er sie sich vorgestellt hat. Duncan ahnt ein wenig von der Verbindung seines Vaters mit den Célé Dé, ist aber nicht eingeweiht.
Gegen den Widerstand seines Vaters bricht er mit dem Mönch Padraig auf. Sie nehmen in Frankreich den Sohn des armenischen Königs auf, den letzten Überlebenden einer Gesandtschaft zum Hofe König Ludwigs. Eine Krankheit und die ungewohnte Nahrung in Frankreich hat die Armenier das Leben gekostet. Roupen empfiehlt den beiden, über Flüsse quer durch Frankreich nach Marseille zu segeln, was sie auch tun. Auf dieser Fahrt erleben sie einige Abenteuer mit Räubern und Hass gegen den fremdländischen Roupen, obwohl er als Armenier auch ein Christ ist, wird er oft als Jude beschimpft.
In Marseille tun sie einem Komtur der Tempelritter einen Gefallen und segeln an Bord seines Schiffes nach Palästina. Dort erleben sie, wie wenig fromm die Mönchsritter sich mitunter benehmen können – saufen wie ein Templer war damals ein Sprichwort mit realem Hintergrund. Der Komtur Renaud de Bracineaux zieht schließlich Duncan ins Vertrauen: Bohemund II. plant von Antiochia aus einen Überfall auf das christliche Armenien. Er ist ehrgeizig und will seine Grenzen erweitern. Er bittet Duncan ihm zu helfen, Bohemund von diesem Unternehmen abzubringen. Roupen will er derweil schützen.
Bohemund ist jedoch nicht geneigt, dem Templer und seinen Begleitern zuzuhören. Bracineaux wird festgesetzt, Duncan flieht mit Roupen nach Famagusta auf Zypern. Dort soll laut Bracineaux ein Kopte namens Jordanus ihnen helfen, dieser unangenehmen Situation zu entfliehen. Jordanus bringt sie schließlich nach Anavarza, wo sich bald zeigt, dass ihre Warnung nicht unbedingt nötig ist: Die Armenier haben sich mit den Seldschuken verbündet, und das Heer Bohemunds rennt ins Verderben. Bei der Abreise wird Duncan von seinen Gefährten getrennt und von Emir Ghazi gefangen genommen. Unter der Beute befindet sich auch der Schwarze Stamm, was die Moslems jedoch nicht erkennen. Ghazi verschenkt ihn über Umwege an den Kalifen von Kairo. Dieser beschließt schließlich Duncans Hinrichtung. In den wenigen Tagen davor schreibt er seine Geschichte auf, wird jedoch bei einem Aufstand befreit und kann mit dem Wahren Kreuz fliehen.
Doch auch die Templer und Haschischin [= „Assassinen“, Anm. d. Lektors] suchen das Wahre Kreuz und arbeiten Hand in Hand, und so werden Duncan und seine Freunde von Attentätern verfolgt…
Vieles wird geboten – Templer, Haschischin, quer durch Frankreich und von Zypern ins Heilige Land nach Ägypten und wieder zurück geht Duncans Reise. Leider fehlen so auch deutliche Schwerpunkte, kein einziger Aspekt wird wirklich zufrieden stellend in Szene gesetzt. Die interessante Verbindung zwischen den Templern und den Haschischin ist in wenigen Sätzen aufgebaut, und das war es dann auch schon. An keinem der zahlreichen Handlungsorte wird näher ins Detail gegangen, die Reise wird im Buch sehr zügig vorangetrieben. So wurde mir zwar nicht langweilig, aber es blieb leider bei oberflächlichen Betrachtungen.
Größter Kritikpunkt ist die Ähnlichkeit zu vorherigen Romanen Lawheads: Dieses Schema wurde schon in „Das Kreuz und die Lanze“ verwendet, welches wiederum in dem abenteuerlicheren „Byzantium“ abgehandelt wurde, welches in der deutschen Version in zwei Teile aufgeteilt wurde, die vielsagende Titel haben: „Aidan – Die Reise nach Byzanz“ und „Aidan in der Hand des Kalifen“. Eine Reise die in der Gefangenschaft eines Kalifen endet… Lawhead käut hier denselben Gedanken wieder wie eine Kuh das Futter – leider ist das nicht gerade Appetit anregend… zudem war „Byzantium“ detaillierter, abwechslungsreicher und spannender.
So wirken die Celtic Crusades wie eine schwächere Neuauflage dieses Buches, nicht zuletzt bedingt durch eine Erzählweise Lawheads, die in meinen Augen schon immer seine Schwäche war: Der ominöse Geheimbund der Célé Dé lässt einen Nachfahren Murdos und Duncans in unserer Zeit die Reisemanuskripte ihrer Vorfahren lesen und… ja was und? Welche Ziele die Célé Dé haben, ist nie klar definiert, auch weiß ich selbst nach zwei Bänden nicht, was sie überhaupt tun. Reliquien sammeln? Besser wird die Geschichte durch die oftmals ins teils Sentimentale rutschenden Gedanken von Duncans Nachfahren nicht. Hier wird nur offenbar, dass Lawhead selbst als ehemaliger Theologiestudent offensichtlich seine Vorliebe für keltische Kultur und Lebensweise in den Célé Dé mit dem Christentum, wie er es sich vorstellt mixt – für die katholische Kirche und den Papst hatte er im Vorläufer sehr wenig übrig, dieses Mal ist diese Kritik nicht so ersichtlich, aber die einzig richtig frommen Christen sind wieder einmal die Célé Dé.
Ein Eigenplagiat mit einer wenig gelungenen übergestülpten Handlung in der Jetztzeit präsentiert erneut Lawheads Liebe zu den Kelten in einer rasanten Rundfahrt durch weite Teile der damaligen Welt. Da die Hauptfiguren recht sympathisch sind und das Ganze sehr gut lesbar ist, die Übersetzung hervorragend, man könnte meinen sie wäre das Original, kann man „Der Gast des Kalifen“ dennoch genießen. Große Höhepunkte sollte man jedoch nicht erwarten. Vielleicht schließt ja der dritte Band die unbefriedigende Geheimnistuerei in der Gegenwart zufrieden stellend ab, allen anderen empfehle ich als ähnliche Lektüre das wesentlich spannendere „Byzantium“, in der dt. Übersetzung als „Aidan – Die Reise nach Byzanz“ und „Aidan in der Hand des Kalifen“ erschienen.
Homepage des Autors: http://www.stephenlawhead.com/
Cornwell, Bernard – Stonehenge
Einen Roman über die Entstehung von Stonehenge konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Geben die „aufgehängten Steine“, so eine mögliche Übersetzung des Namens Stonehenge, doch seit jeher Rätsel auf. Bis heute konnte nur die Frage nach dem Wann? zufrieden stellend gelöst werden, jedoch die Antworten auf das Wie?, Wer? und vor allem Warum? bestehen aus Spekulationen, Vermutungen und purem Rätselraten. Optimale Voraussetzungen für einen umfangreichen historischen Roman rund um das berühmteste Bauwerk dieser Art, dessen sich der britische Autor Bernard Cornwell – u.a. durch seine Arthur-Trilogie bekannt geworden – leidenschaftlich annimmt.
Wahrheit und Fiktion – was was ist, erklärt der ehemalige BBC-Reporter in einem ausführlichen Nachwort selbst, das auch die wissenschaftlichen Ergebnisse in Bezug auf vorgeschichtliche Steinkreis-Anlagen – die in der Zeit von 4000 bis 1500 v.Chr. in ganz Nordwesteuropa entstanden sind – und im Besonderen auf Stonehenge zusammenfasst. Sehr informativ und gut erklärt! Darum werde ich mir einen Vergleich auch sparen, nur so viel sei erwähnt, dass der Autor die geschichtlichen Fakten für ein glaubwürdiges, mitreißendes Spektakel geschickt verwendet und den Leser gekonnt glauben macht: Genau so und nicht anders ist es passiert!
Aber was ist nun passiert?
Fremdländisches Gold zerstört die Idylle von Ratharryn und bringt die Gottheiten zum Wüten. Aufgefunden in einem nicht mehr benutzten Tempel, weiß niemand, woher es stammt und warum es aufgetaucht ist. Und die Fremdländischen wollen es zurück, denn es sind göttliche Schätze, deren Verlust nur Unglück bringen kann. Zwietracht bringt es auch nach Ratharryn, denn des Clanführers ältester Sohn Lengar will es zum Krieg gegen den Nachbarn Cathello verwenden. Doch sein Vater entscheidet, dass es nun zum Stamm gehört, und um die Götter zufrieden zu stellen, muss der Tempel neu erbaut werden.
Lengar kehrt mit den Fremden in ihr Land zurück, womit sein jüngster Bruder Saban nun der zukünftige Clanführer ist, denn der mittlere Bruder Camaban ist verkrüppelt und damit aus dem Stamm ausgestoßen. Doch Camaban schafft es, bei der mächtigen Zauberin Sannas von Cathello in die Lehre zu gehen. Er geht ebenfalls zu den Fremden, mit dem Plan, Slaol, dem Sonnengott, den größten, beeindruckendsten Tempel aller Zeiten zu bauen, denn als Ausgestoßener hat er in eben jenem verfallenen Tempel gelebt, als das Gold kam und Slaol hat schon immer zu ihm gesprochen. Und er will einen Steintempel, genau wie Cathello, nur mächtiger und größer.
Nachdem Saban die Mannbarkeitsprüfung überstanden und Derrewyn aus Cathello geheiratet hat, kehrt Lengar mit einem Vernichtungsfeldzug zurück, tötet seinen Vater, schickt Saban in die Sklaverei zu den Fremden nach Saramennyn und erhebt sich selbst zum neuen Clanführer.
In Saramennyn angekommen, wird Saban wieder frei und lernt die Gebräuche der Fremden kennen. Jedes Jahr zur Mitsommerwende wird eine Sonnenbraut dem Sonnengott durch Verbrennen geopfert, jedoch ist diese Sonnenbraut für einen Monat vorher eine Göttin. Als Aurenna, die neue Sonnenbraut, vom Gott verschont bleibt, wird sie seine neue Frau, allerdings bleibt sie immer in Kontakt mit dem Gott.
Camaban erwählt Saban zum Baumeister und die Suche nach den richtigen Steinen beginnt ca. 135 Meilen von seiner Heimat entfernt. Sie finden nicht nur die Steine, sondern einen fertigen Tempel, den der verrückt gewordene Hohepriester der Fremden auf einem Berganhang gebaut hatte. Saban muss jetzt noch eine Lösung für den unmöglich erscheinenden Transport finden, doch Camaban lässt ihm keine Ruhe und so baut Saban Schiffe, die stark genug sind, um die mannshohen Steine fortbewegen zu können. Der Transport der Steine und der neue Aufbau erstreckt sich über viele Jahre und als der neue Tempel steht, ist er enttäuschend klein und unscheinbar. Ein neuer Tempel soll gebaut werden, diesmal der richtige, denn hinzu kommt, dass der Tempel nun noch mehr Bedeutung hat: Er soll den Sonnengott und die Mondgöttin zusammenführen und damit den Tod, den Winter und alles Leid aus der Welt vertreiben …
Mit jeder Seite von „Stonehenge“ bricht eine Informationswelle über den Leser herein, die einerseits ein wenig erdrückend erscheint, andererseits so detailliert und fesselnd ist, dass ich zumindest nichts überlesen konnte und wollte. Die Story wird nie langweilig, da immer wieder Drehungen und Windungen den roten Faden zu einer Schleifenlinie werden lassen und neue Charaktere einen völlig anderen Wind hineinbringen. Die Charaktere sind überhaupt großartig, allein Camaban fasziniert durch seine herausfallende Entwicklung und den heranwachsenden Wahnsinn, der in der damaligen Zeit sicherlich bei Priestern und Zauberern vorherrschte und somit das Volk in Schach hielt.
Jeder von ihnen besticht durch Lebendigkeit, Kraft und eine ureigene, perfekt ausgearbeitete Persönlichkeit, die zusammengebracht ein Feuerwerk höchsten Lesegenusses auslösen. Lengar, der eiskalte Krieger, Saban, der ruhige, kluge Baumeister, Camaban, der sich selbst als die Verkörperung des Sonnengottes sieht, Derrewyn, die hasserfüllte, gnadenlose Zauberin und schließlich auch Aurenna, die, durch Camaban angesteckt, selbst dem Wahn anheimfällt und glaubt, die Mondgöttin zu sein – sie alle verfolgen ihre eigenen Ziele, haben ihre eigenen Wünsche und doch verbindet sie der Bau des Tempels. Freiwillig oder unfreiwillig, sie beugen sich den Göttern.
Ebenfalls ein wichtiger Beitrag zu diesem Meisterwerk sind die Beschreibung der Gedanken von Camaban, die geistige Entstehung des Tempels und das stetige Wachsen seiner Bedeutung. Beeindruckend schildert Cornwell, wie das Leben seiner Protagonisten voll und ganz auf den Glauben ausgerichtet ist, wie alles mit den Göttern zusammenhängt und welche Abhängigkeit sich daraus ergibt.
Es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass Stonehenge zur Himmelsbeobachtung genutzt wurde, aber auch Rituale wie Beerdigungen, Hochzeiten, Opferungen etc. werden dort stattgefunden haben, doch warum dieses große, beschwerliche, fast übermenschliche Unterfangen? In vielen Urvölkern gibt es die Legende, dass die Sonne und der Mond vor Beginn der Zeit Liebende waren und sich im Streit getrennt haben – vielleicht wurde Stonehenge ja wirklich erbaut, um beide wieder zueinander zu führen?
Auf jeden Fall ist „Stonehenge“ ein Buch, das allemal lesenswert ist, für mich eines der besten historischen Werke, die ich bis jetzt in der Hand hatte.
Homepage des Autors: http://www.bernardcornwell.net
Mehr zu dem Thema:
http://www.england-seiten.de/specials/stonehenge
http://www.stonehenge.brain-jogging.com
Grundy, Stephan – Rheingold
Rheingold – wer jetzt an einen Zug der Bundesbahn denkt, der fährt auf dem falschen Gleis. Der sagenumwobene Nibelungenschatz im Rhein ist hier gemeint.
„Rheingold“ ist das Erstlingswerk und gleichzeitiger Bestseller des Autoren Stephan Grundy, der auf die ältere Wälsungen-Saga zurückgreift. Der 1967 in New York geborene Grundy schrieb seine Doktorarbeit über den germanischen Kriegsgott Wotan, er ist zweifellos ein Kenner der Materie. Sein Verdienst ist es, die Geschichte in eine zeitgemäße Sprache umgesetzt zu haben.
Wer kennt die Geschichte um den Drachentöter Siegfried, den grimmen Hagen und den Untergang der Burgunder nicht, die besonders in der Nazizeit zum deutschesten aller deutschen Epen hochstilisiert und missbraucht wurde? Das Rheingold, ein Zwergenschatz, zu dem auch der verfluchte Ring der Nibelungen gehört, ist jedoch in der bekannten Form eher nebensächlich – bei Wagner’s Oper geht es viel mehr um menschliche Tragödien, Pflichterfüllung und Rachsucht. Bei Grundy erfährt der Leser wesentlich mehr.
Er beschreibt, wie es zum Fluch des Rheingoldes kam. Loki musste eine Blutschuld zahlen für den Sohn seines Gastgebers, den er unwissentlich getötet hat. Um Wotan, der als Geisel zurückblieb, wieder auszulösen, knöpfte er listig den Schwanenjungfrauen und den Zwergen ihren Schatz ab. Doch seine rücksichtslose Betrügerei blieb nicht ohne Folgen, denn die Zwerge verfluchten das Rheingold, insbesondere den Ring. Doch der listige Loki zahlte der Sippe der Wälsungen den Ring und das Rheingold als Wehrgeld…
Vor Gier nach Gold töteten Fafnir und Regin ihren eigenen Vater, Fafnir wurde zum Drachen und behütete den Hort mit dem Gold, Regin wurde Lehrling der Zwerge. Hier zeigen sich erste Unterschiede zum bekannten Nibelungenlied auf, die ich nur stichpunktartig und unvollständig erwähnen werde – so bleibt euch eine gewisse Spannung bestehen, denn die Wälsungen-Saga unterscheidet sich teilweise ganz erheblich von der bekannteren wagnerianischen Fassung!
Im ersten Buch, DIE WÄLSUNGEN, wird erzählt, wie es zum Fluch des Goldes kommt. Streit und Neid in der Sippe führen dazu, dass Sigmund, der Vater Sigfrids, gegen den Gemahl seiner Schwester, Siggeir, Krieg führt. Einem Zweig der Sippe schob Wotan seine Walküre Hild als Frau unter, von dieser rührt die übermenschliche Stärke der Wälsungen her. Mit Sigmunds Tod und der Annahme seiner Frau Herwodis und ihrem ungeborenen Sohn Sigfrid durch den fränkischen Fürsten Alprecht beginnt das zweite Buch.
In SIGFRID beginnt der klassische Teil des Nibelungenlieds, allerdings bekämpft hier Sigfrid nicht den Zwerg Alberich, vielmehr hilft ihm der zum Zwerg gewordene Regin, den Drachen Fafnir zu töten. Auch erbeutet er nicht das Zauberschwert Balmung, sondern er schmiedet das Gram genannte Schwert seines Vaters Sigmund wieder zusammen. Das Verhältnis von Sigfrid zu Gunter und Hagen ist auch differenzierter als bei Wagner: Der grimme Hagen schwört sogar Sigfrid Blutsbrüderschaft, es herrscht kein Hass zwischen den beiden. Auch wird Sigfrid nicht mit Krimhild vermählt, sondern mit Gunters Schwester Gudrun. Die auf Erden gefangene Walküre Brünhild, der er zuvor die Ehe versprochen hat, trickst er ohne eigene Schuld aus, denn ein Liebestrank seiner Schwiegermutter Krimhild lässt ihn alle alten Schwüre vergessen. Doch bald weiß jeder, was Sache ist – und das Unheil nimmt seinen Lauf…
Im letzten Buch, GUDRUN, kommt es zum Streit zwischen Brünhild und Gudrun. Diese fühlt sich betrogen und fordert von allen, den eidbrüchigen Sigfrid zu strafen, zusätzlich fordert sie noch als Königin seinen Kopf. Hagen führt die Pflicht aus, und wird danach von allen gehasst. Gudrun flieht im Zorn auf ihre Brüder und kehrt erst Jahre später zurück, als ihre Mutter Krimhild im Sterben liegt. Sie wird mit Attila, dem König der Hunnen, vermählt. Anders als bei Wagner warnt sie jedoch ihre Brüder Hagen und Gunter, als dieser sie in seine Halle einlädt: Die Römer fordern den Kopf Gunters, und Attila selbst möchte endlich das Gudrun von Sigfrid als Morgengabe überreichte Rheingold. Auch endet das folgende Gemetzel anders, so kämpft Gudrun auf Seiten ihrer Brüder. Mehr verrate ich euch aber nicht.
Es gibt noch einige weitere bemerkenswerte Unterschiede: So wird Sigfrid als starker, mutiger, ehrlicher Kerl beschrieben, der jedoch leichtsinnig und unbedacht handelt, keine Geduld hat und nicht gerade der Hellste ist. Hagen wird als unbeliebter Eigenbrötler beschrieben, der hier jedoch keinen persönlichen Groll gegen Sigfrid hegt, auch nicht als er für das Wohl seiner Sippe – Hagen gehört entfernt zum Zwergengeschlecht der Nibelungen – und für Burgund sich schließlich ins soziale Abseits rückt und Sigfrid tötet. In dieser Fassung hat er sogar eine Frau und einen Sohn, der ihn nach seinem Tod an Attila rächen darf. War bei Wagner die Feindschaft Hagens und Sigfrids sowie der beiden Frauen Krimhild und Brünhild zentrales Thema, wird hier Krimhild zur Drahtzieherin im Hintergrund und durch die nicht rachsüchtige Gudrun ersetzt, Hagen nicht zum Feind Sigfrids, sondern zum doch eher düsteren, aber klugen und bedacht handelnden Vertreter der Zwerge. Auch die Tarnkappe wird anders beschrieben als bei Wagner, die ganze Tötung Fafnirs unterscheidet sich stark von dem, was ich bisher kannte.
Rheingold war wider Erwarten spannend, obwohl ich das Nibelungenlied kannte, insbesondere das erste Buch über die Ursprünge der Wälsungen war mir völlig neu. Alle Personen sprechen ein zeitgemäßes Deutsch, die Sitten, Gebräuche und Anreden, wie „Frowe“ für die Herrin des Hauses, blieben jedoch erhalten. Ebenso das Flair, das eine Sage in meinen Augen ausmacht. Der Sprachstil dürfte jedoch ein breites Publikum ansprechen, ohne dabei auch nur im Geringsten das Nibelungenlied zu profanisieren.
Was mir weniger gut gefiel war ein Hinweis auf Zensur im Nachwort, die „Völsung“-Saga ist in einer wilden und rauhen Zeit entstanden, so wurden Grausamkeiten Siglinds wie das Annähen von Lederhemden in die Haut von Kindern, die sie auf ihr Wälsungen-Blut prüfen will, oder Hagens Rat in der Halle Attilas, das Blut der Gefallenen zu trinken, da Wassermangel herrschte, gestrichen oder durch harmloses Wasser aus der Küche ersetzt. Mich stört das, andere freut es vielleicht, denn obwohl öfter Männer im Kampf sterben, ist das die friedlichste Umsetzung der blutigen Sage überhaupt. Der Kern der Geschichte wird davon nicht berührt, und ich bin mir nicht sicher, ob das Nachwort „in dieser Fassung gestrichen“ nur die deutsche Version oder alle Sprachausgaben von Rheingold meint. So bleiben selbst Szenen wie ein in einen Werwolf verwandelter Sigmund, der Menschen im Wald anfällt, sehr harmlos und unblutig, was das Buch für jüngere Leser eignen würde, aber andererseits zielt es auf ein erwachsenes Publikum ab in Länge, Anspruch und Umfang. Leider erweckt dieser Gewaltverzicht auch oft den Eindruck, Sigfrids Männer wären keine wilden und brutalen Eroberer, oft Vergewaltiger, sondern ein gesitteter Haufen gewesen. Übrigens: Historisch gesichert ist nur die Figur des Gunter, alles andere hat keinen besonders nahen Bezug zur tatsächlichen Geschichte.
Die Übersetzung ist erstklassig, die beiden Übersetzer haben die englischen Varianten der Namen sehr gut und stimmig im Sinne des Autors übersetzt, mein einziger Kritikpunkt an der stilistisch und sprachlich vorzüglichen Leistung: Warum hat man, wenn man heute bekannte Namen wählt und zum Teil auf philologisch korrekte Namensgebung bewusst verzichtet, nicht das heutige SIEGFRIED anstelle von SIGFRID genommen?
Im ganzen Buch ist mir kein einziger Setzungsfehler aufgefallen, Satz und Druck sind ebenfalls ausgezeichnet. Das sehr schöne Titelbild zeigt Brünhild oder Gudrun mit Sigfrids Schwert am Rheinufer. Mit 846 Seiten Umfang, die dicht bedruckt sind in einer platzsparend kleinen Schriftgröße, ist das Buch zudem sehr umfangreich. Selbst Vielleser haben einiges zu tun. Es ist sehr gut gebunden, selten ist ein Softcover so gut verarbeitet, dass die Seiten nicht zur Loseblattsammlung mutieren und es sich nicht selbst zublättert. Zum Glück, bei dem Unfang wäre das auch eine ziemliche Plage.
Ein großer Mythos – für unsere Zeit neu erzählt. So steht es auf dem Buchrevers. Dem kann ich mich nur anschließen. Wer auch nur einen kleinen Funken für Sagen oder Geschichte allgemein übrig hat, sollte sich das Buch unbedingt kaufen. Selbst wer das Nibelungenlied kennt – Grundys Mix aus dem von Wagner her bekannten Stoff und der Völsung-Saga ist gerade wegen der oft gravierenden Unterschiede sehr interessant zu lesen. Wer auf den Geschmack gekommen sein sollte und mehr über den auch hier mysteriösen Hagen lesen möchte, dem sei das inoffizielle Prequel „Wodans Fluch“ vom gleichen Autor empfohlen. „Rheingold“ ist ein Buch, das jeden Cent wert ist.
Hanjo Lehmann – Die Truhen des Arcimboldo

Lehmann studierte Germanistik, Philosophie und Medizin. Der einzige mir bekannte weitere Roman des Autors ist das 2001 erschienene „I killed Norma Jeane“, das wohl missglückt sein soll, wie ich aber nur als Hörensagen wiedergeben kann. Die gebundene Ausgabe des vorliegenden Werkes „Die Truhen des Arcimboldo“ wurde 2002 von Rütten & Loening erneut aufgelegt, die zunächst beim Aufbau-Taschenbuch-Verlag erschienene Broschur gab es dann als Neuausgabe von Bastei-Lübbe, nun wurde von |Aufbau| die Broschur in der 19. Auflage wieder herausgebracht; beides kommt zum echten Kaufmichpreis.