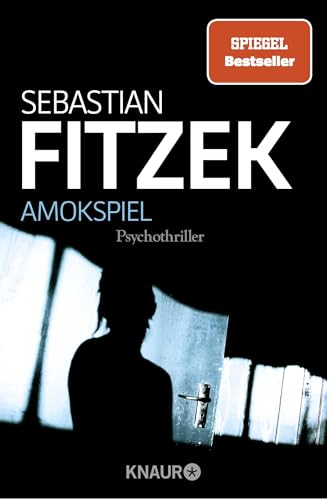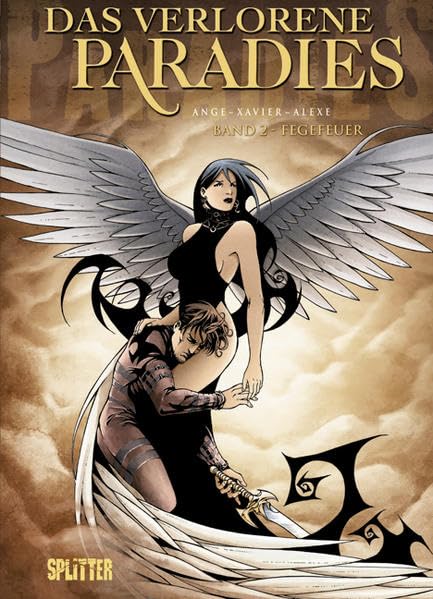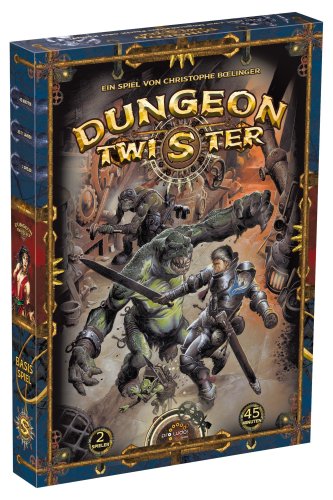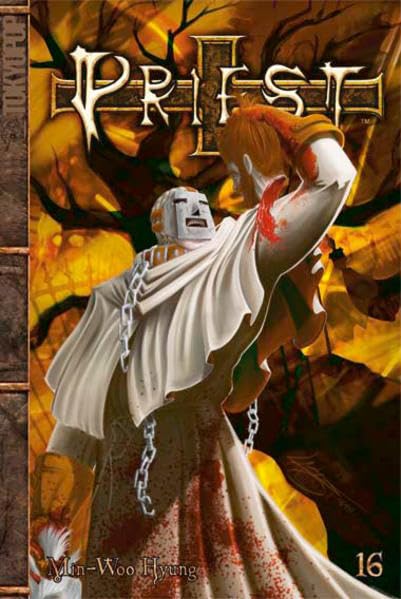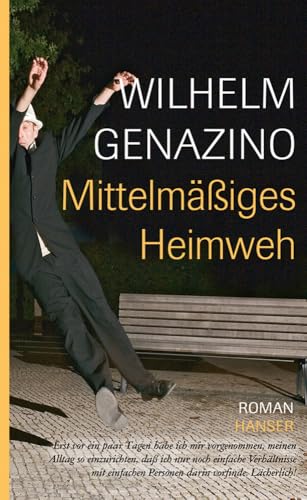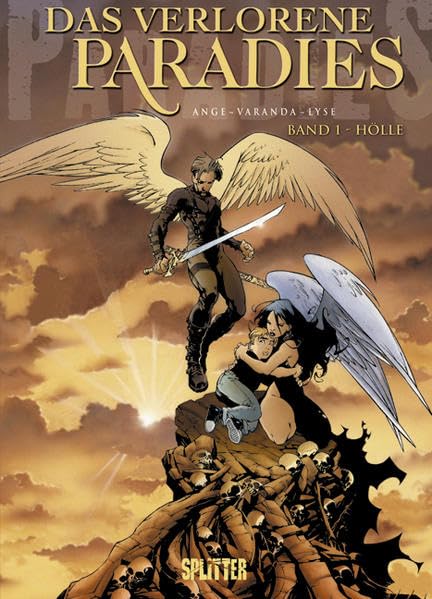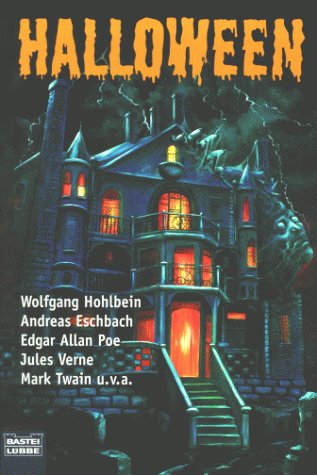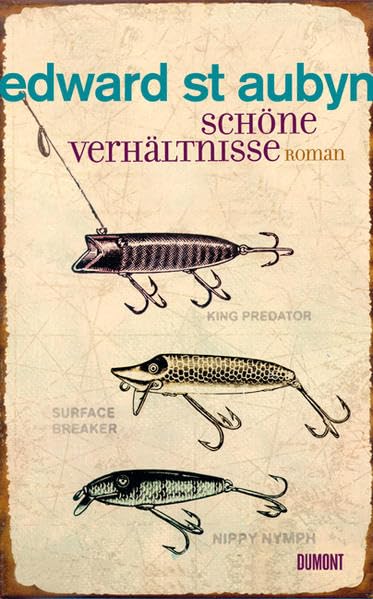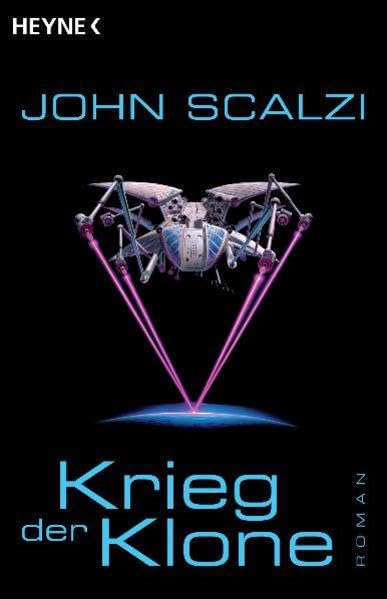Mit seinem Debüt „Die Therapie“ ist Sebastian Fitzek im letzten Jahr ein rundum guter und erfolgreicher Thriller geglückt, der mittlerweile auch schon fürs Kino verfilmt wird. Nun liegt mit „Amokspiel“ sein zweiter Roman vor und man darf gespannt sein, ob Fitzek damit an den Erfolg des Vorgängerwerks anknüpfen kann.
Eigentlich wollte Kriminalpsychologin Ira Samin schon längst ihren geplanten Selbstmord hinter sich gebracht haben, als ihr SEK-Kollege Oliver Götz sie Hals über Kopf zu einem wichtigen Einsatz mitschleppt. Ein unberechenbarer Psychopath hat einen Radiosender besetzt und hält dort mehrere Menschen als Geiseln fest. Er treibt dort ein makaberes Spiel. Wahllos ruft er Leute an. Wenn sie sich mit der Parole „Ich höre 101Punk5 und jetzt lass die Geisel frei“ melden, darf eine Geisel gehen. Sagt der Angerufene etwas Falsche, so soll eine Geisel sterben.
Wie ernst es dem Geiselnehmer ist, stellt sich gleich in der ersten Spielrunde heraus. Das muss auch die Polizei einsehen, und so stehen Ira Samin und ihren Kollegen harte Stunden bevor. Iras Verhandlungen mit dem Geiselnehmer werden live übertragen. Der Geiselnehmer schwört weiterzuspielen, bis seine Verlobte Leonie zu ihm ins Studio gebracht wird, die Monate zuvor unter merkwürdigen Umständen bei einem Unfall gestorben sein soll. Doch ist sie wirklich tot, wie Jan May, der Geiselnehmer, behauptet? Oder ist der Mann einfach ein Wahnsinniger, dem der Realitätsbezug entglitten ist? Ira muss es herausfinden, doch die Verhandlungen sind ein Wettlauf mit der Zeit. In jeder Stunde will der Geiselnehmer „Cash Call“ spielen und jemanden anrufen. Jede Stunde steht damit aufs Neue das Leben der Geiseln auf dem Spiel …
Der Plot verspricht zunächst einmal jede Menge Spannung. Ein Wettlauf mit der Zeit, eine Geiselnahme, die in der Abgeschlossenheit eines Sendestudios stattfindet und damit wenig Ansatzpunkte für die Polizei zur Stürmung bietet. Obendrein ist der Geiselnehmer selbst Psychologe und kann somit die Tricks der Verhandlerin Ira Samin leicht durchschauen. Für die Polizei und das SEK ist die Situation absolut verfahren, und dadurch, dass der Geiselnehmer bei erster Gelegenheit schon beweist, wie ernst er es meint und dass auch sein einziger Verhandlungsspielraum, sein einziges Pfand (nämlich seine Geiseln) ihm nicht sonderlich viel wert ist, will die Polizei das Dilemma möglichst schnell lösen.
Was für Ira und ihre Kollegen die Sache ebenfalls erschwert, ist die Tatsache, dass Jan May keine wirklich konkreten Forderungen stellen kann. Er fordert den Kontakt zu einem Menschen, der nachweislich bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Keiner weiß so recht mit dieser Situation umzugehen, und während Ira versucht, wenigstens einen Aufschub für die nächste Spielrunde zu erzielen, arbeiten die Kollegen fieberhaft an einem Plan zur Stürmung des Studios.
Für Spannung ist allein durch den Plot somit schon zur Genüge gesorgt. Fitzek verschwendet keine Seite mit Ausschmückungen. Er beginnt acht Monate vor der Geiselnahme mit dem Moment, als Jan May von Leonies Autounfall erfährt, und setzt die Geschichte dann unmittelbar am Tag der Geiselnahme fort. Eine kurze Einführung in das Leben der beiden Protagonisten an diesem Tag, und schon beginnt die nervenaufreibende Geiselnahme, die für Spannung bis zur letzten Seite sorgt.
So gesehen ist „Amokspiel“ auf jeden Fall ein Roman mit „Pageturner“-Potenzial. Man mag das Buch einfach nicht mehr zur Seite legen, denn Fitzek versteht es gut, den Leser bei der Stange zu halten. Immer wieder setzt er in Sachen Spannung neue Akzente, streut Andeutungen ein, welche die Neugier anstacheln, und zieht den Leser in den Bann seiner Geschichte.
Einblicke in die Figuren erhält der Leser dabei vor allem während der Verhandlungen. Ira ist eigentlich als Psychologin arbeitsunfähig. Sie fühlt sich verantwortlich für den Selbstmord ihrer ältesten Tochter, ist Alkoholikerin und wollte sich noch wenige Momente vor ihrem Einsatz das Leben nehmen. Im Grunde ist sie ein psychisches Wrack, und dass sie die Verhandlungen mit Jan May dabei noch so gut meistert (auch trotz des einsetzenden Alkoholentzugs), lässt sie leider ein wenig überzeichnet wirken. Sie mag die beste Verhandlerin des SEK sein, aber dass sie in ihrer gegenwärtigen psychischen Verfassung noch so gute Arbeit leistet, lässt dann doch hie und da Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen.
Nichtsdestotrotz machen auch gerade die Verhandlungen einen Reiz des Buches aus. Fitzek lässt insbesondere über die Verhandlungen den Leser einen näheren Blick auf Ira Samin und Jan May werfen. Dass beide gut geschulte Psychologen sind, macht die Verhandlungen nur umso interessanter.
Besonders die Figur des Jan May ist ein interessantes Objekt der Betrachtung. Fitzek lässt den psychopathischen Geiselnehmer im Laufe der Verhandlungen immer menschlicher erscheinen. May wird zu einem Menschen, für den man einerseits Mitleid für seine Situation und andererseits auch eine Portion Sympathie empfindet. Er steht im Grunde ahnungslos einer Situation gegenüber, von deren Ausmaßen er nicht den Hauch einer Idee hat. Mit seiner Forderung versetzt er einige Menschen in rege Betriebsamkeit und setzt eine Reihe von Entwicklungen in Gang, deren ganzes Ausmaß niemand einzuschätzen weiß.
Auch der Leser weiß lange Zeit nicht, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Ist Leonie nun tot oder lebt sie doch noch? Sicher ist nur, dass an der Sache irgendetwas faul ist. Das ganze Ausmaß der Geschichte kann der Leser nicht so leicht erahnen. Es gibt irgendwo im Polizeiapparat einen Maulwurf, doch den hat Fitzek leider nicht sehr gut versteckt, und so gibt gerade diese Rolle in der Auflösung dann doch Anlass zur Kritik. Den Maulwurf zu entlarven, stellt für den Leser keine große Herausforderung dar, und so ist dementsprechend ein Teil der Auflösung recht unspektakulär.
Bleibt unterm Strich ein durchwachsener Eindruck. „Die Therapie“ war im Vergleich zu „Amokspiel“ wesentlich raffinierter konstruiert und konnte auch am Ende noch sehr schön überraschen. „Amokspiel“ ist zwar kein schlechter Thriller, denn immerhin mag man das Buch bei der Lektüre kaum aus der Hand legen, dennoch kann Sebastian Fitzek die hochgesteckten Erwartungen, die „Die Therapie“ geweckt hat, nicht so ganz erfüllen. Dafür ist der Maulwurf bei der Polizei zu offensichtlich platziert und dafür wirken auch manche Aspekte der Figurenskizzierung ein wenig zu überzeichnet. Dennoch ist „Amokspiel“ ein ausgesprochen spannungsgeladener Lesegenuss, der aber eben aus der Masse an Thrillern auch nicht sonderlich deutlich hervorsticht.
http://www.knaur.de