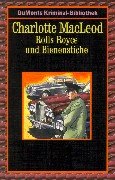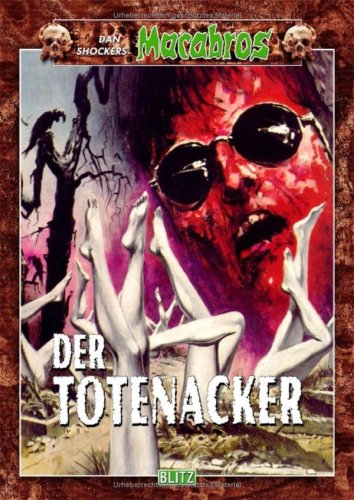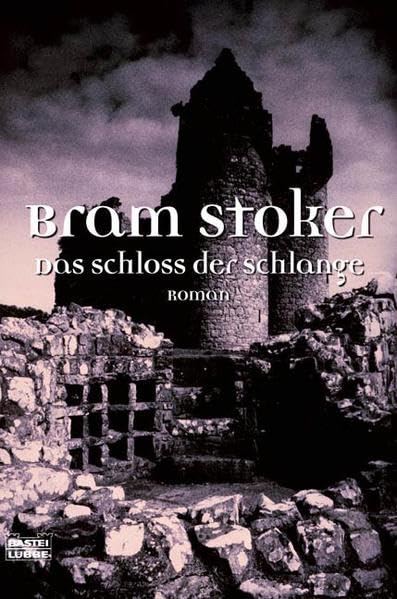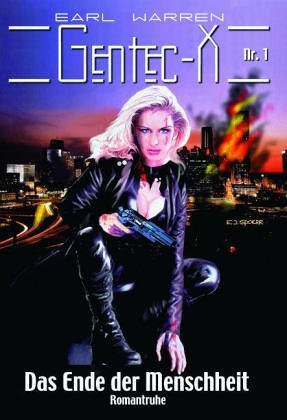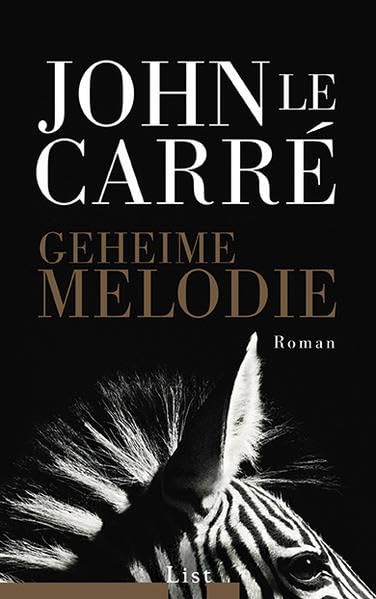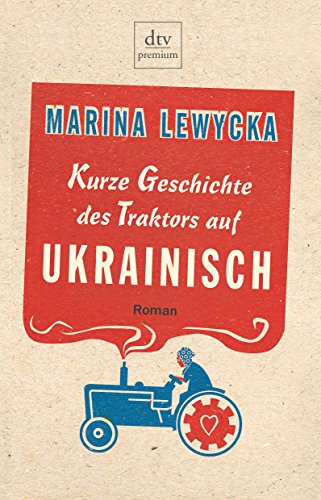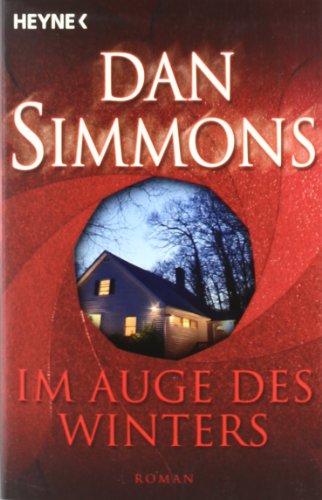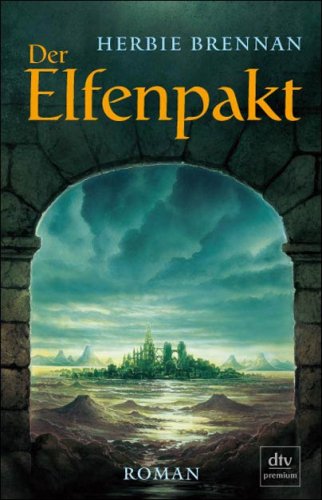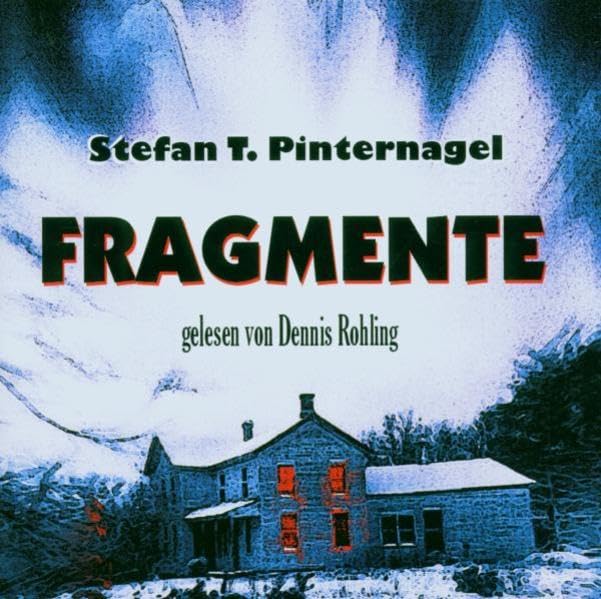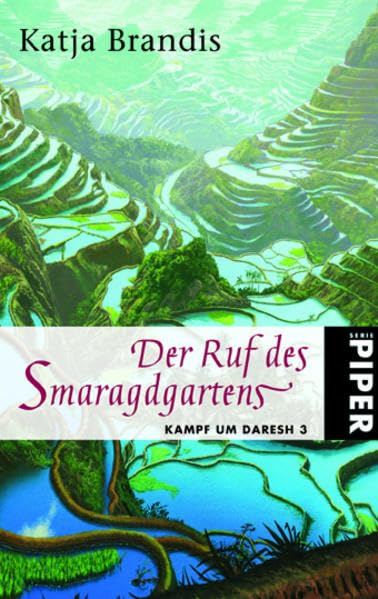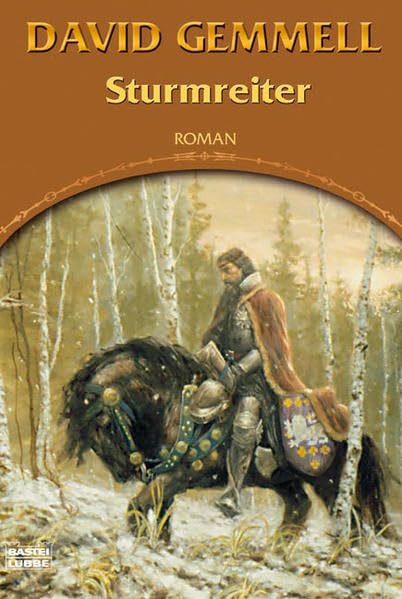Wie in jedem Jahr richtet das Millionärs-Ehepaar Nehemiah und Abigail Billingsgate für seine Familienmitglieder, Verwandten und Freunde auf dem Gelände seines Anwesens vor den Toren der US-Metropole Boston (Massachusetts) ein prunkvolles Renaissance-Fest aus. Unter den zahlreichen Gästen tummeln sich auch Max und Sarah Bittersohn, die heuer nicht nur zur Feier eingeladen wurden, sondern außerdem einen peinlichen Diebstahl aufklären sollen. Die Bittersohns arbeiten als Privatdetektive, und der Hausherr setzt größeres Vertrauen in sie als in Chief Grimpen, den ebenso aufgeblasenen wie unfähigen Polizeichef, dem dennoch noch reichlich Gelegenheit geboten wird, sich tüchtig zu blamieren.
Seit Jahrzehnten sammelt die Familie Billingsgate Luxus-Automobile der Marke Rolls Royce. Der Wert dieser Oldtimer ist enorm, so dass große Aufregung entsteht, als ein Modell „New Phantom“, Baujahr 1927, aus der als Museum eingerichteten und gut gesicherten Großgarage verschwindet. Für das Fest wurden deshalb besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Der alte Hausdiener Rufus bewacht die fest verschlossene Wagenhalle, und regelmäßig schaut Max Bittersohn nach dem Rechten.
Dennoch geschieht das Unfassbare: Auf einem seiner Kontrollgänge findet Max den Wachposten verlassen vor. Nach kurzer Suche entdeckt er den scheinbar saumseligen Rufus: Er hängt mit einem Seil um den Hals hoch im Wipfel eines Baumes! Man hat ihn erst ermordet und dann mit einem Flaschenzug dort hinaufgezogen. Gleichzeitig ist wieder einer der wertvollen Rolls Royces verschwunden – und Boadicea Kelling, eine der zahllosen Tanten Sarahs, die anscheinend den Dieben und Mördern zufällig über den Weg lief und von diesen verschleppt wurde.
Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Da ist zum einen der unausstehliche Grimpen, der nichts lieber täte, als den Fall unter fadenscheinigen Gründen zu den Akten zu legen. Auf der anderen Seite müssen die Billingsgates und die Bitterbaums sich eingestehen, dass der oder die Täter wohl im Kreise der Gäste gesucht werden müssen; eine peinliche Situation, da die Anwesenden nicht nur mit den Gastgebern und untereinander verwandt sind, sondern einander schon seit Jahrzehnten kennen …
Der achte Band der „Boston“-Serie, die sich lose um die kriminalistischen Abenteuer der Amateur-Detektivin Sarah Kelling-Bitterbaum rankt, vermittelt seinen Lesern schon auf den ersten Seiten das beruhigende Gefühl, durch nichts Neues verschreckt zu werden. Seit jeher steht für Charlotte MacLeod weniger der Thrill, d. h. das Verbrechen und seine Aufklärung, im Mittelpunkt, sondern die Beschwörung einer guten, altmodischen, heilen Welt, bevölkert von liebenswerten und skurrilen Gestalten, denen ein Mord auch nicht dramatischer erscheint als ein Familienskandal, der sich vor fünfzig oder mehr Jahren abgespielt hat.
So schlägt MacLeod in der „Boston“-Serie einen Großteil ihres Witzes aus dem unglaublich verzweigten Clan der Kellings, einem genealogischen Albtraum hart an der Grenze zur Inzucht, der quasi die Bevölkerung eines ganzen Landstriches stellt und dem Verschrobenheit offensichtlich schon in die Wiege gelegt wird. Nach sieben Bänden hat sich die daraus erwachsende Komik allerdings ziemlich abgenutzt, doch der wahre (meist weibliche) MacLeod-Fan sieht das natürlich ganz anders und kann gar nicht genug von immer neuen Kellings mit ulkigen Namen und ebensolchen Gewohnheiten in märchenhaft-traulicher Landhaus-Atmosphäre lesen. Weit, weit weg ist die grausame Realität, vor der sich auf diese Weise vortrefflich fliehen lässt. Allzu spannend darf und soll es in dieser gemütlichen Nische nicht zugehen: „Cozys“ nennt man solche baldrianischen Krimis im Angelsächsischen mit gutem Grund. Alles wird schließlich immer wieder gut, während mindestens ein unverheirateter Großonkel zwölften Grades für kauzige Komplikationen sorgt; im vorliegenden Band ist er zwar nicht mehr am Leben, was aber nebensächlich ist, da für die Kellings Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowieso nahtlos ineinander übergehen und in diesem zeitlosen In-sich-selbst-Ruhen selbst tote Verwandte stets präsent bleiben.
Schwierigkeiten mit dem Kelling-Clan kennt die treue MacLeod-Leserschaft nicht. Die Autorin lässt einmal eingeführte Figuren immer wieder die Handlung bereichern, bis sie sich in der ständigen Wiederholung dem Publikum eingeprägt haben. Ansonsten sind sie austauschbar, was die eigentlichen Hauptpersonen nicht ausschließt: Sarah und Max Bittersohn sind liebenswerte Gutmenschen, die als Überdosis genossen durchaus Brechreiz hervorrufen können. In inniger Liebe einander zugetan, gesegnet mit einem gar niedlichen Kindelein und verschont von profanen Sorgen, gehen sie einem (im MacLeodschen Sinn) aufregenden Beruf nach und verkörpern damit, wonach sich viele Leser/innen mindestens unterschwellig sehnen.
Das muss man sich vor Augen führen, wenn man als Neuling in die „Boston“-Welt stolpert. Charlotte MacLeod ist mit ihren Cozys jedenfalls gut gefahren. Im reifen Alter von 57 Jahren erst ist sie 1979 auf die „Boston“-Goldader gestoßen. Noch drei weitere Serien derselben Machart sicherten ihr (mildes) Kritikerlob und ein treues Publikum, das die fleißige Autorin über mehr als zwei Jahrzehnte zuverlässig mit immer neuen Variationen der alten Melodie bei Stimmung hielt.
Nach 1990 verlangsamte sich MacLeods Arbeitstempo merklich. Zum Kummer ihrer zahlreichen deutschen Fans war mit „Der Mann im Ballon“ nicht nur das Dutzend voll, sondern das Ende der Serie erreicht. Weitere Kriminalromane aus der Feder Charlotte MacLeods gab es nicht mehr. Die inzwischen 80-jährige Autorin litt an der Alzheimerschen Krankheit, an deren Folgen sie 2005 starb. Die absolut hirnrissige, geradezu peinliche „Auflösung“, die MacLeod sich für „Rolls Royce und Bienenstiche“ hat einfallen lassen, führt allerdings zu der Frage, ob der geistige Verfall nicht schon ein Jahrzehnt früher eingesetzt hat.
Die „Boston“-Serie:
01. Die Familiengruft (1979; „The Family Vault“) – DuMonts KB Nr. 1019
02. Der Rauchsalon (1980; „The Withdrawing Room“) – DuMonts KB Nr. 1022
03. Madame Wilkins‘ Palazzo (1981; „The Palace Guard“) – DuMonts KB Nr. 1035
04. Der Spiegel aus Bilbao (1983; „The Bilbao Looking Glass“) – DuMonts KB Nr. 1037
05. Kabeljau und Kaviar (1984; „The Convivial Codfish“) – DuMonts KB Nr. 1041
06. Ein schlichter alter Mann (1985; „The Plain Old Man“) – DuMonts KB Nr. 1052
07. Teeblätter und Taschendiebe (1987; „The Recycled Citizen“) – DuMonts KB Nr. 1072
08. Rolls Royce und Bienenstiche (1988; „The Silver Ghost“) – DuMonts KB Nr. 1084
09. Jodeln und Juwelen (1989; „The Gladstone Bag“) – DuMonts KB Nr. 1092
10. Arbalests Atelier (1992; „The Resurrection Man“) – DuMonts KB Nr. 1097
11. Mona Lisas Hutnadeln (1995; „The Odd Job“) – DuMonts KB Nr. 1104
12. Der Mann im Ballon (1998; „The Balloon Man“) – DuMonts KB Nr. 1110
http://www.dumontliteraturundkunst.de/