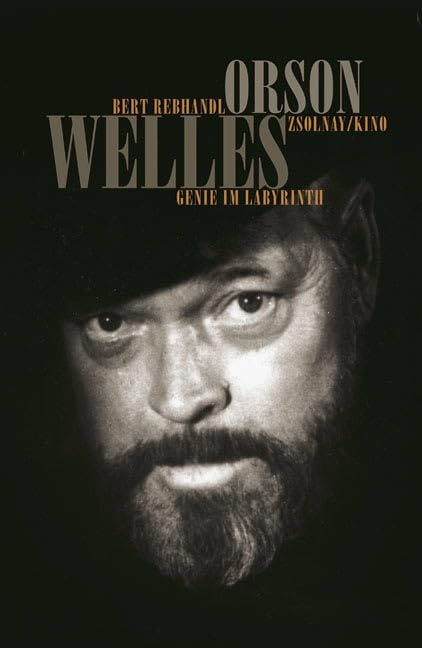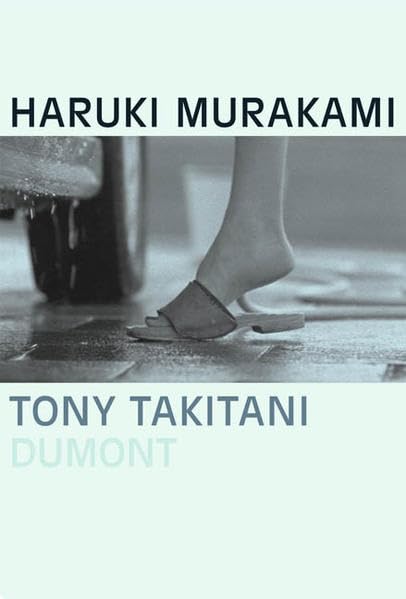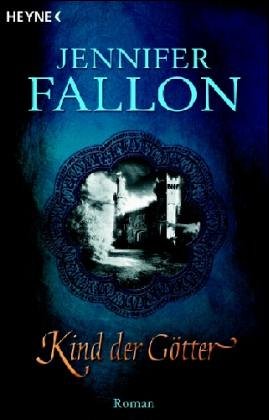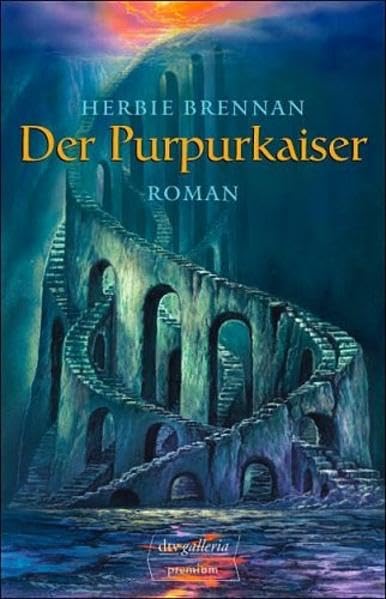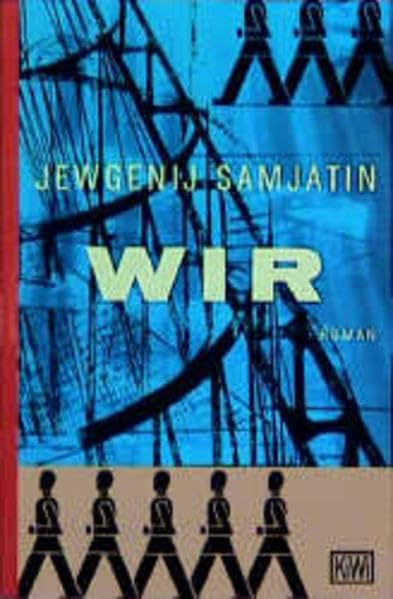Archiv der Kategorie: Rezensionen
Lee, Julianne – Verbannung, Die (Das Schwert der Zeit 2)
Auch im zweiten Band ihrer Saga um „Das Schwert der Zeit“ entführt die Autorin Julianne Lee den Leser in die Zeit der letzten großen schottischen Aufstände gegen die Engländer. Sie bewegt sich dabei in den Spuren erfolgreicher Romane von Diana Gabaldon und Filme wie „Rob Roy“ und „Braveheart“.
Erinnern wir uns: Der Amerikaner Dylan Robert Matheson wurde von der Fee Sinann in die Vergangenheit zurückgeholt, um dem Volk der Schotten zu helfen und das Blatt der Geschichte vielleicht zu wenden. Der Mann aus der Zukunft weigerte sich zwar zunächst, passte sich dann aber an, als er den Clan seiner Vorfahren kennen und lieben lernte – und vor allem die Tochter des Lairds. Doch Neid und Verrat trennte die beiden Liebenden. Während das Mädchen mit einem Kaufmann aus Edinburgh verheiratet wurde, obwohl sie bereits ein Kind von Dylan erwartete, geriet der junge Mann in einen Hinterhalt und schloss sich nach seiner Genesung Rob Roy an, anstatt zum Clan zurückzukehren, weil dort die Verräter Oberhand gewonnen hatten.
Als er durch die schwere Verwundung in einer Schlacht wieder in die Zukunft zurückgeworfen wird, fühlt sich Dylan nicht mehr in der Gegenwart wohl. Er kann sich nicht mehr einleben. Obwohl er weiß, dass er manche Annehmlichkeiten vermissen wird, beschließt er, alle Brücken abzubrechen und in die Zeit zurückzukehren, die ihm mehr am Herzen liegt.
Der erneute Zauber gelingt mit Sinanns Hilfe. Diesmal entgeht Dylan dem beinahe tödlichen Schwertstoß und kann vom Schlachtfeld fliehen. Er beschließt nun seinem Herzen zu folgen und nicht mehr irgendwelchen Idealen, denn die Engländer haben den Aufstand blutig niedergeschlagen und nehmen nun brutal Rache.
Dylan weiß um Catrionaigs Schicksal und hofft, sie aus den Klauen ihres bösartigen Mannes Connor Ramsay zu befreien. Dazu schleicht er sich sogar bei diesem als Leibwächter ein und bekommt so einiges von dessen schurkischen Geschäften mit – unter anderem mit seinem Erzfeind, dem englischen Hauptmann Bedford, der Dylan einst tiefe Narben auf dem Rücken verpasste.
Dylan kann zunächst alles für sich und Catrionaigh zum Guten wenden. Sie kehren nach Hause zurück und werden miteinander vermählt, bauen sich auf dem ererbten Land eine eigene Hütte auf und vergrößern ihre Familie mit einer kleinen Tochter. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer, denn die Schatten der Vergangenheit holen die Liebenden ein – und nur das Wissen einer Freundin aus der Zukunft kann noch Hilfe und Rettung bringen.
Ähnlich wie in „Vogelfrei“, dem ersten Band der Geschichte, entführt uns Julianne Lee in eine wild bewegte Zeit und auf die Seite der Hochlandschotten. Diesmal stehen jedoch weniger große historische Ereignisse im Vordergrund, sondern das kleine, persönliche Schicksal Dylans. Wieder begegnen wir hassenswerten Charakteren wie dem Lowlander Ramsay, der mit den Engländern gemeinsame Sache macht und auch noch anderen Perversitäten frönt, und Dylans liebenswerten Freunden. Die Autorin lässt ihren Helden langsam in die Zeit hineinwachsen – um so krasser ist dann das kurze Wiedersehen mit seiner Jugendfreundin Cody, durch das deutlich wird, wie sehr er das Denken und Fühlen seiner neuen Umgebung bereits verinnerlicht hat.
Auch wenn „Die Verbannung“ eher Gewicht auf die Liebesgeschichte legt, so führt das Buch doch die spannende und abenteuerliche Geschichte gelungen und konsequent weiter und ist ebenfalls lesenswert.
_Christel Scheja_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
Stoker, Bram – Draculas Gast
Bei |LPL records| kennt man sich mit gepflegtem Grusel ja aus. In schöner Regelmäßigkeit werden dort ansprechende Hörbücher mit hochkarätigen Sprechern produziert und der Slogan von LPL, „Gänsehaut für die Ohren“, ist keineswegs ein leeres Versprechen. Bei LPL hat man schon Lovecraft oder Lumley auf CD gebannt, den Zuhörer mit Gruselmärchen unterhalten und HR Giger für eine Zusammenarbeit gewonnen. Bei so viel Gruselpotenzial darf natürlich auch ein Altmeister des gotischen Grauens nicht fehlen: Bram Stoker, wohl am besten (und fast ausschließlich) für seinen [„Dracula“ 210 bekannt, hat eine durchaus stolze Anzahl Romane und Kurzgeschichten geschrieben. Es gibt also keinen Grund, dem Hörer noch eine Interpretation des „Dracula“ zu bieten (die gibt es schon zur Genüge), stattdessen hat man sich bei LPL für drei Kurzgeschichten entschieden.
In „Draculas Gast“, der titelgebenden Geschichte, treffen wir auf Jonathan Harker, der auf seiner Reise nach Transsilvanien gerade einen Stopp in München einlegt. Von der Abenteuerlust gepackt, begibt er sich auf eine Ausfahrt, um die Gegend zu erkunden – die Warnungen seines Kutschers nicht beachtend. Dieser nämlich stirbt fast vor Angst, ist doch grad Walpurgisnacht. Dem Engländer allerdings bedeutet der kontinentale Volksglauben im katholischen Bayern überhaupt nichts, und so treibt er seine Erkundungstour nötigenfalls auch ohne den schlotternden Kutscher voran. Allerdings nicht, bevor dieser ihm eine unheimliche Geschichte von einem verlassenen Dorf ganz in der Nähe erzählt hat, dessen Bewohner offensichtlich Vampiren zum Opfer fielen. Jonathan lacht dem Kutscher – und der Gefahr – ins Gesicht, schickt die Kutsche zurück zum Hotel und geht zu Fuß weiter. Bald trifft er auf einen Friedhof, auf ein seltsames Grab, auf einen starken Schneesturm und und einen viel zu zutraulichen Wolf … Selbst dem überhaupt nicht abergläubischen Jonathan wird es da mulmig.
„Draculas Gast“ ist eigentlich das verworfene erste Kapitel von Stokers großem Roman über den Grafen der Vampyre und damit merkt man der Geschichte den Expositionscharakter auch an. Eigentlich wirft die Geschichte nämlich mehr Fragen auf als sie klärt, besonders nach dem ominösen Schluss (der hier natürlich nicht verraten wird). Stoker nimmt sich viel Zeit, seinen Handlungsort zu schildern und den Leser auf die kommenden unheimlichen Ereignisse einzustimmen. Und auch hier, stärker noch als später im Roman, wird dem Protagonisten seine überhebliche Haltung gegenüber dem Glauben und den Gebräuchen seines Reiselandes zum Verhängnis – offensichtlich ein beliebtes Thema für Stoker, wie die beiden anderen Kurzgeschichten zeigen werden. Zu Hochform läuft Stoker auf, wenn er die aufgewühlte Natur während des Schneesturms beschreibt. Wald und Wetter werden zum personifizierten Gegner, zu einem Charakter innerhalb der Geschichte, der zu großen Teilen für das Unwohlsein seines Zuhörers verantwortlich ist. Harker dagegen ist nur ein Spielball größerer Mächten – sein aufgeklärter Rationalismus hilft ihm angesichts solcher Ereignisse nicht weiter.
In „Das Haus des Richters“ geht es traditioneller und geordneter zu. Der Student Malcolm Malcolmson zieht sich aufs Land, genauer ins Städtchen Benchurch, zurück, um dort ungestört für sein Mathematikexamen lernen zu können. Er mietet sich in einem leer stehenden Haus ein, das im Ort nur als „das Haus des Richters“ bekannt ist, was bei der Gastwirtin hysterische Anfälle auslöst, ohne dass sie erklären könnte, was es mit dem Haus genau auf sich hat. Doch Malcolm, genauso rational veranlagt wie Jonathan Harker, lässt sich von einem neurotischen Frauenzimmer nicht schrecken und macht es sich in dem Haus bequem. Zunächst kommt er mit dem Lernen auch gut zurecht und lässt sich selbst von den zahlreich vorhandenen Ratten nicht stören (er ist eben sehr stoisch). Zwar befindet sich unter den Ratten auch ein besonders großes Exemplar, das sich ganz selbstverständlich auf einem Sessel niederlässt, doch kann er das Tier vertreiben, indem er es mit Büchern bewirft (was für eine Taktik). Nun sollte ihm zu denken geben, dass seine Mathematikbücher keine Wirkung zeigten und die Ratte sich nur durch die geworfene Familienbibel vertreiben ließ – doch Malcolm ist wie gesagt Rationalist und fröhnt keinesfalls dem Aberglauben.
Natürlich wird ihm letztendlich genau diese Einstellung zum Verhängnis und das Haus des Richters macht seinem Namen alle Ehre. Und so hat der arme Malcolmson ganz umsonst für sein Examen gelernt, stellt sich doch letztendlich heraus, dass die riesige Ratte gar keine Ratte ist.
„Das Haus des Richters“ ist eine klassische Gruselgeschichte über ein Spukhaus, das dennoch (oder gerade deswegen) seine Wirkung nicht verfehlt. Zwar bleiben einige Fragen offen, doch überzeugt Stoker gerade in der Beschreibung der Abgeschiedenheit seines Handlungsortes. Und natürlich läuft sein Protagonist Malcolmson sehenden Auges in sein Unglück, sodass man nur begrenztes Mitleid für ihn entwickeln mag.
Die dritte Geschichte, „Die Sqaw“, ist gleichzeitig der makabre Höhepunkt des Hörbuchs. Ein Ehepaar in den Flitterwochen (doch ihre romantischen Neigungen halten sich in Grenzen) befinden sich auf Sightseeingtour in Nürnberg. Ihnen schließt sich der Amerikaner Hutcheson an, der das Ehepaar durch seine Anwesenheit fortan nicht nur vom Streiten abhält, sondern es auch mit Abenteuergeschichten unterhält. Die beiden fressen, aus irgendeinem unverständlichen Grund, sofort einen Narren am laustarken und überheblichen Hutcheson, der beweist, dass das Stereotyp des unverdient selbstbewussten Amerikaners nicht erst eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist. Und so stellt sich Hutcheson selbst zwar als liebenswürdig und empfindsam dar, beschreibt die Indianer seiner Heimat aber als brutale Barbaren und ist sich nicht zu schade, eine Geldbörse aus Menschenhaut bei sich zu tragen. Kurzum: Dem Leser stößt Hutcheson mehr und mehr auf. Und das geht auch einer Katze so, auf die das Trio auf der Nürnberger Burg stößt. Hutcheson erschlägt – ganz aus Versehen natürlich – deren Junges mit einem Stein und spätestens seit Poe wissen wir, dass mit Katzen nicht zu scherzen ist. Hutcheson wird sein Ende finden, und es wird besonders blutig und besonders unangenehm sein.
Wieder ereilt den Protagonisten, der unfähig ist, andere Kulturen zu verstehen und zu akzeptieren, ein tödliches Schicksal. Doch wo Harker und Malcolmson noch Sympathien beim Leser hervorrufen konnten, da sieht man sich in „Die Sqaw“ unversehens auf der Seite der Katze wieder, die geschickt Rache an Hutcheson nimmt und so den Tod ihres Nachwuchses rächt. Das Ende, das Hutcheson ereilt, wird von Stoker lange und genüsslich vorbereitet und der Leser weiß längst, welchen Ausgang die Geschichte nehmen wird, als Hutcheson sich noch lautstark amüsiert.
Es ist wirklich eine Bereicherung, mal etwas anderes von Stoker genießen zu können als immer nur „Dracula“, wenn natürlich, der Gerechtigkeit halber, hinzugefügt werden muss, dass „Dracula“ sein bestes und suggestivstes Werk bleiben wird. Doch Stokers gotische Kurzgeschichtenschrecken vermögen auch heute wohlige Schauer hervorzurufen, gerade wenn sie von einem so patenten Sprecher wie Lutz Riedel vorgetragen werden. Mit Freude arbeitet er jeweils auf den Höhepunkt der Geschichte hin, um diesen dann ausgiebigst auszukosten. Billige Effekte braucht es da nicht. Stimme und Wortgewalt reichen vollkommen aus. Abgerundet wird das Hörbuch wie immer durch die Musik von Andy Matern, dessen dräuende Melodien dem Hörer wohlige Schauer über den Rücken laufen lassen werden. Mal wieder ist |LPL| damit ein Treffer ins Schwarze gelungen!
George Orwell – 1984
Die Ära des Kommunismus, auf die Orwell mit seiner omnipotenten, bedrohlichen und in ihrer Gesamtheit niemals erklärbaren Partei, dem Hinweis auf Drei-Jahres-Pläne (vgl. die kommunistischen/sozialistischen Fünf-Jahres-Pläne) und dem beständigen Mangel an Konsumgütern bei gleichzeitiger Planerfüllung, die mit Hilfe von Manipulationen erreicht wird, anspielt, ist Geschichte. Doch, obwohl kein totalitäres System im Ausmaße von „1984“ existiert (fraglich, ob es so umfassend jemals existieren könnte), sehen wir gerade heute wieder ganz deutlich die Gültigkeit von Orwells Analyse der Funktion von Krieg. Auch einer der interessantesten Komponenten des Romans wollen wir die nötige Aufmerksamkeit schenken: der Funktion von Newspeak (dt. Neussprech), der Manipulation von Sprache.
Wehrli, Reto – Verteufelter Heavy Metal (Erweiterte Neuausgabe)
Dass Heavy Metal in Teilen unserer Gesellschaft nicht gerade den besten Ruf genießt, ist bekannt. Ebenso die Tatsache, dass Heavy-Bands ab und an für Skandale sorgen und damit Aufruhr seitens des Gutbürgertums auslösen, was immer wieder in zensorischen Eingriffen gipfelt. Doch was genau steckt dahinter? Mit dieser Frage beschäftigt sich Reto Wehrli im vorliegenden Buch „Verteufelter Heavy Metal“.
Das Werk gliedert sich in zwei Hauptteile – „Grundlagen und Geschichte“ sowie beispielhafte „Falldarstellungen“. Abgerundet wird das Ganze durch viele beanstandete Songtexte und insgesamt 295 Abbildungen, darunter viele der im Text beschriebenen Corpora Delicti, womit man Reto Wehrlis Werk wohl ohne zu zögern ebenfalls in die Liste jugendgefährdender Kunst und Kultur aufnehmen müsste. Ein paar der Bilder weisen jedoch keine gute Qualität auf, da sie zu unscharf aussehen. Kuriose Folge dessen ist, dass die Abbildung manches wegen Gewaltdarstellung beanstandeten CD-Covers (z.B. CANNIBAL CORPSE) in diesem Buch aussieht, als wäre sie gerade deshalb unkenntlich gemacht worden, was aber vom Autor keinesfalls so beabsichtigt war.
Reto Wehrli arbeitet sehr viel mit Zitaten und hat für sein Werk eine sehr umfangreiche Recherche betrieben, was für hohe Objektivität und differenzierte Schilderungen sorgt.
Im Unterschied zur Erstausgabe wurde der Umfang sehr stark erweitert, es wurden mehr Bilder abgedruckt, und die strikte Trennung der beiden oben genannten Teile vorgenommen (in der Erstausgabe waren die Falldarstellungen in die jeweiligen Kapitel eingearbeitet). Hier wird man als Leser allerdings vor die Entscheidung gestellt, ob man sich zuerst in die allgemeinen Abhandlungen und dann in die Fallbeispiele vertieft oder ob man gemäß der Referenzierung der Beispiele immer hin und her pendelt. Bestimmte Sachverhalte tauchen daher auch doppelt auf, z. B. die empörte Aufregung von Tipper Gore über die Obszönitäten auf einem PRINCE-Album, welche die Gründung des PMRC (Vereinigung besorgter Mütter zur Säuberung der Gesellschaft von teuflischer Rockmusik) zur Folge hatte, oder der Selbstmord eines Jugendlichen, der zu dieser Tat angeblich durch den OZZY OSBOURNE-Song ‚Suicide Solution‘ angestiftet wurde, und der dann sogar Gegenstand eines Gerichtsverfahrens gegen den Madman war.
Doch nun erst einmal ein paar Worte zum Aufbau von „Verteufelter Heavy Metal“. Zunächst wird der Ursprung des Heavy Metal geklärt und der Autor nimmt eine grundsätzliche Charakterisierung dieser „Teufelsmusik“ sowie von deren Anhängern vor. Gerade die Vergleiche zu anderen Genres wie Blues oder dem Horrorfilm machen die Einordnung sehr gelungen. Es werden die Anfänge der Zensurbestrebungen und ihrer Ursachen geschildert, und zum besseren Verständnis erfolgt auch noch eine Abhandlung über die „Psychologie des christlichen Fundamentalismus“. Nachdem damit quasi die Grundlagen der Thematik geklärt sind, widmet Wehrli noch ein paar „Besonderheiten“ eigene Kapitel. Da wäre zunächst das Phänomen des Backward Maskings (Rückwärtsbotschaften in Rocksongs), in dem er sowohl die typischsten Beispiele (ich sage nur ‚Stairway To Heaven‘) für solche Anschuldigungen detailliert beschreibt, als auch die Wirksamkeit solcher Botschaften vom wissenschaftlichen Standpunkt aus untersucht. Ein weiteres Kapitel reflektiert Literatur von bekennenden Heavy-Metal-Gegnern, deren Thesen er nicht nur auf argumentatorisch hohem Niveau entkräften kann, sondern denen er gleichzeitig auch noch ungenügende Detailkenntnisse und ein oberflächliches, unwissenschaftliches Vorgehen nachweist. Auch dem NS-Black-Metal wird ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem sehr detailliert auf die Vorgänge in Skandinavien als auch im deutschen Raum in den neunziger Jahren eingegangen wird.
Bei den Falldarstellungen, in denen sehr viel Detailwissen wiedergegeben wird, tauchen natürlich auch die hierzulande bekanntesten Beispiele von Zensur und öffentlicher Entrüstung auf; es seien hier exemplarisch die Indizierung von CANNIBAL CORPSE-Covern, die im Zuge der Schulschießereien von Littleton respektive Erfurt massiv angefeindet und dafür (mit-)verantwortlich gemachten Bands MARYLIN MANSON, RAMMSTEIN und SLIPKNOT, oder auch die Playgirl-Nacktfotos eines Peter Steele (im Buch übrigens mehrfach gemächtig abgebildet) genannt. Es sei in diesem Zusammenhang auch gleich darauf verwiesen, dass hier beileibe nicht nur Heavy-Metal-Bands abgehandelt werden, vielmehr werden alle mit Zensurbemühungen in Berührung gekommenen Künstler und damit verschiedenste Musikstile anhand von Beispielen reflektiert, wobei die ältesten vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammen.
Einige der Fallbeispiele kommen ob ihrer Charakteristik für die Thematik dieses Buches sehr umfangreich daher (das sind vor allem die von den SEX PISTOLS, MADONNA und MICHAEL JACKSON), die trotz ihrer Länge stets sehr interessant zu lesen sind, zumal sie zumeist ein recht differenziertes Bild (im Gegensatz zum durch die Medien verbreiteten Kurzeindruck des jeweiligen Künstlers) zeichnen und auch mit psychologischen Interpretationsversuchen und Verhaltensdeutungen nicht hinter dem Berg halten. Vereinzelt sind auch kritische Töne des Autors gegenüber den Künstlern zu hören (beispielhaft seien hier das exzentrische Getue von GUNS ‚N ROSES-Sänger Axl Rose und der „unreife Satanismus“ derer von BELPHEGOR genannt), insgesamt sind die Darstellungen aber sehr objektiv gehalten.
Auch sehr aktuelle Geschehnisse wurden bereits in die Neuauflage eingearbeitet (z. B. JANET JACKSON und der „Nipplegate“-Skandal), am zeitnahsten ist allerdings die „Entgleisung“ von Prinz Harry, der als Faschingskostüm eine Rommel-Uniform mit Hakenkreuz trug, was Wehrli zu einer Bemerkung ob der prophetischen Gabe der SEX PISTOLS veranlasste. Als besonders spannend empfand ich persönlich hingegen gerade die Beispiele der Künstler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da der Autor hier einen interessanten Kontrapunkt zur heutigen Zeit setzt, indem gezeigt wird, womit man damals bereits Provokationen und Empörung auslösen konnte.
Ein paar kritische Bemerkungen müssen jedoch auch getroffen werden, denn bei Reto Wehrli haben sich hie und da ein paar Ungenauigkeiten eingeschlichen. Bei den Ausführungen zum Thema Songtexte offenbart der Autor m. E. ein etwas zu eingeschränktes Sichtbild. Die Feststellung, dass es im Heavy Metal keine Songtexte gibt, die eine positive und optimistische Grundaussage beinhalten und vielleicht sogar Hoffnung oder Romantik propagieren, halte ich in dieser Deutlichkeit für falsch. Natürlich sind solche Lyrics klar in der Minderheit gegenüber den Schilderungen vom zwanglosen Ausleben von Sex, Drugs & Rock ’n‘ Roll sowie Beschreibungen von Chaos, Vernichtung und Tod – nichtsdestoweniger gibt es einige (auch sehr bekannte) Bands, deren Songtexte konträr dazu stehen. Das beschränkt sich dann auch nicht auf die christlichen White-Metal-Bands, es sei nur einmal auf Gruppen wie SAVATAGE oder PAIN OF SALVATION verwiesen.
Bei der Thematisierung der in den Lyrics zum Ausdruck gebrachten Gesellschaftskritik hätte der Autor zudem auch ruhig darauf eingehen können, dass sich eben jene Kritik nicht nur am Spießbürgertum bzw. an den aufdiktierten Normen und der Scheinheiligkeit der „heilen Welt der Etablierten“ fest macht, sondern durchaus auch „massenkompatible“ Kritik zur Sprache kommt, die der textlichen Thematisierung von Tod, Zerfall und Verderben sogar zum Teil entgegensteht. Als Beispiel (viele andere wären möglich) sei hier nur einmal die aktuelle KREATOR-Scheibe „Enemy Of God“ erwähnt, auf der mit Kriegstreibern wie George W. Bush aufgeräumt und generell die Lösung von politischen Konflikten mittels Gewalt angeprangert wird.
Auch die Charakterisierung (oder vielleicht sollte ich es eher Psychoanalyse nennen) des typischen Metallers empfinde ich als etwas zu oberflächlich und einseitig. Obgleich Heavy-Metal-Fan zu sein, für die meisten Betroffenen nicht nur den Musikgeschmack, sondern das Lebensgefühl reflektiert, wäre hier eine differenzierte Reflexion angebracht gewesen. Es ist schon ziemlich gewagt, bestimmte Charakter- und Wesenszüge sowie Verhaltensmuster zu definieren und zu behaupten, dass sich in dieses Schema der überwiegende Teil der Metal-Anhänger einordnen lasse. Außerdem scheint mir der Autor den gemeinen Metalfan zu sehr in der Gruppe der Jugendlichen anzusiedeln, die nach Orientierung und eigenen (nicht von außen aufdiktierten) Wertvorstellungen im Leben suchen. Dabei lässt er die Tatsache unter den Tisch fallen, dass Heavy Metal nicht wie noch in den achtziger Jahren als „Teenie-Mucke“ kategorisiert werden kann. Natürlich zeichnet sich der Heavy Metal durch eine gewisse rebellische Attitüde aus, zu sehr verallgemeinern sollte man hier dennoch nicht. Auch wird Heavy Metal nicht mehr ausschließlich von Weißen produziert, auch wenn diese natürlich nach wie vor die absolute Mehrheit darstellen. Die Ausführungen zu den angesprochenen Punkten sind somit zwar durch eine unbestreitbar gekonnte Argumentationsführung, allerdings auch durch eine gewisse Einseitigkeit gekennzeichnet.
Es ist allerdings festzuhalten, dass dies die absolute Ausnahme darstellt, und die Argumentationen insgesamt sehr fundiert und für den Leser nachvollziehbar sind. Sprachlich liest sich das Werk hingegen recht unterschiedlich. Mitunter schmeißt der Autor mit komplizierten Fachbegriffen nur so um sich, so dass wohl der eine oder andere Leser nur unter Zuhilfenahme des Dudens den gesamten Sinn erfassen kann. Hier scheint sich der Autor ein bisschen in hochtrabenden Wortkonstruktionen sonnen zu wollen. Auf der anderen Seite hat die Wortwahl stellenweise aber auch schon fast Straßenslang-Charakter, wobei man über solche phantasievollen Umschreibungen wie bspw. „nymphomanischer Wanderpokal“ (als Bezeichnung für die jugendliche MADONNA, S. 465) durchaus herzhaft lachen kann.
Gerade bei den Falldarstellungen kommt die Sprache immer wieder auf die Werbewirksamkeit von politischen Boykottaufrufen oder gesetzlichen Zensurmaßnahmen für die betroffenen Künstler und darauf, wie vorhersehbar die Reaktionen auf eine gelungene Provokation doch immer wieder ausfallen und sogar Inhalt von geschickt kalkulierten Marketingstrategien sind. Aber auch der umgekehrte Fall ist typisch, wie dem sehr interessanten Abschnitt „Zensur durch marktwirtschaftliche Lenkungsmaßnahmen“ zu entnehmen ist, der die schleichende Zensur durch Boykott thematisiert.
Zu den Fallbeispielen ist noch zu sagen, dass die Liste natürlich noch beliebig hätte verlängert werden können, was aber sinnvoll gewesen wäre, da sie bereits jetzt fast 400 Seiten umfasst (und damit über die Hälfte des gesamten Buches) und sich zudem die Skandale sowieso ständig wiederholen. Vielleicht hätte man auf die gerade in Deutschland doch recht populären Fälle der Bands EISREGEN (deren Alben in schöner Regelmäßigkeit verboten und damit Livekonzerte nahezu unmöglich gemacht werden) oder MOTÖRHEAD (die von Kritikern immer mal wieder in die rechte Ecke gedrängt wurden, obwohl man Mastermind Lemmy Kilmister wohl viel eher ein gesteigertes historisches Interesse bescheinigen muss) eingehen können, aber insgesamt sind es wohl eher schon zu viel Skandalschilderungen als zu wenige.
Andererseits birgt die komprimierte Zusammenfassung der Beispiele und deren Unteilung in den angloamerikanischen Raum sowie den Bereich Deutschland/Frankreich/Schweiz hochinteressantes Vergleichspotenzial. So werden gerade in den USA jegliche Form von Sexualität, Satanismus (im deutschen Raum tendenziell nur vergleichbar mit dem Freistaat Bayern), sowie „unpatriotische Auswüchse“ in der Kunst gegeißelt, während es im deutschspachigen Raum eher Gewaltdarstellungen sind und Dinge, die mit der unrühmlichen Geschichte Deutschlands zusammenhängen (und zwar solche, die ganz im Gegensatz zur USA zu „patriotisch“ bzw. nationalistisch anmuten). Müßig zu erwähnen, dass die Gewichtung dabei des Öfteren sehr merkwürdig erscheint. So musste z. B. für das SODOM-Album „Til Death Do Us Unite“ ein Alternativcover angefertigt werden, das nüchtern betrachtet weit mehr Anlass zur Beanstandung geboten hätte. So ist auch der Autor der Meinung, dass ein Überdenken der gesellschaftlichen Wertbilder dringend angesagt scheint, wenn es besser ist, einen bis an die Zähne bewaffneten Knarrenheinz aufmarschieren zu lassen, als den Bauch einer schwangeren Frau zu zeigen. Auch der „Nipplegate“-Skandal um JANET JACKSON passt in diese Ecke. Hier gibt Wehrli ein Zitat von Lewinsky (nicht Monica) wieder: „Durch Amerika, wo Mord und Totschlag lange nicht so obszön sind wie ein unverhülltes sekundäres Geschlechtsmerkmal, ging ein Aufschrei der Empörung. Im Land der Heuchler, wo man gegen einen Krieg wenig einzuwenden hat, solange die Leichen seiner Opfer nur züchtig bekleidet bleiben, übten sich die Moralapostel in Entrüstung“ (S. 538) (aus „Die wirklich wichtigen Dinge“ von C. Lewinsky). Nothing more to say …
Ähnlich im deutschsprachigen und amerikanischen Raum ist jedoch die meistens sehr oberflächliche Auseinandersetzung der Kritiker mit dem beanstandeten Material, die auch oftmals in schlichter Fehlinterpretation kumuliert. Sogar die Leipziger Popper DIE PRINZEN wurden wegen ihres Songs ‚Bombe‘, der nun wirklich absolut unzweifelhaft ein Anti-Nazi-Statement abgibt, angefeindet, was beweist, wie wenig differenziert und vor allem sachlich ungenau sich manche Menschen mit Kunstprodukten verschiedener Art auseinandersetzen, bevor sie diese verdammen. Auch diese Thematik kommt in Wehrlis Buch immer wieder zur Sprache. In diesem Zusammenhang sei auch auf die absolut nachvollziehbare Logik verwiesen, dass durch den Heavy Metal real existierende Probleme und Missstände nicht hervorgerufen werden, sondern auf sie aufmerksam gemacht wird. Aber das Prinzip, dass der Bote für die überbrachten schlechten Nachrichten zu büßen hat, ist ja nun wahrlich kein neues, weil damit so herrlich von der schmerzhaften Realität abgelenkt werden kann.
Eine Bemerkung sei bei dieser Gelegenheit noch zum Abschnitt über die BÖHSEN ONKELZ erlaubt. Wenn sie tatsächlich nicht als (ehemalige) Neonazi-Kapelle zu bezeichnen sind, wie es der Autor behauptet, dann stellt sich natürlich die Frage, warum sich die Frankfurter Band dennoch mehrfach genötigt sah, sich von der eigenen Vergangenheit deutlich zu distanzieren.
Auch die Assoziation, dass die alleinige Betrachtung des Textes des FALCO-Songs ‚Jeanny‘ lediglich an einen schleimigen Verführer, der ein Mädchen anbaggert, erinnert, kann ich nicht so richtig teilen, was natürlich nicht bedeuten soll, dass ich die moralische Entrüstung in Bezug auf diesen Song teile oder gutheiße. Hier gilt wie für so viele andere Beispiele auch, dass deutlich extremere Songtexte unbeanstandet durch die Jugendschutzkontrollen kommen, sofern sie nur in englischer Sprache verfasst sind. Wahrscheinlich sind die verantwortlichen Personen in der Bundesprüfstelle der englischen Sprache einfach nicht mächtig oder gestehen diese Fähigkeit dem jugendlichen Hörer schlicht nicht zu.
Als sehr wichtig erachte ich es, dass dem Leser bei der Lektüre genug Raum gelassen wird, selbst zu entscheiden, wie er den verschiedenen Provokationen und Skandalen persönlich gegenübersteht. Es erfolgt auch nicht zwangsläufig eine Reinwaschung der betroffenen Künstler. Es geht dem Autor in erster Linie darum, Fakten darzustellen, Vergleiche anzubringen und gesellschaftliche Vorgänge zu hinterfragen. Im Blickpunkt steht somit die Beschneidung von künstlerischer Freiheit im Allgemeinen, die Wertung der eigentlichen skandalträchtigen „Aktionen“ erfolgt nur ansatzweise (und kann dann sowohl als Entlarvung einer stumpfsinnigen Provokation als auch als gelungenes Aufzeigen eines Spiegelbildes der Gesellschaft geschehen), was für mich einen entscheidenden Aspekt darstellt. Ob eine Provokation positiv oder negativ in Inhalt und Ausdruck ist, liegt somit im Auge des Betrachters bzw. Lesers, und genau diese mündige Entscheidungsfreiheit wird dem Bürger durch staatliche Zensurmaßnahmen ja abgesprochen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, der durch dieses Werk verdeutlicht werden soll.
Fazit: Schon allein aufgrund des immensen Umfangs (700 Seiten + Anhang) und der intensiven Recherche zu diesem Buch ist „Verteufelter Heavy Metal“ als Referenzwerk für dieses Thema zu bezeichnen. Hier bekommt der Leser eine Menge geboten und kann sich weit mehr als nur einen bloßen Überblick verschaffen. Ich kann dieses Buch somit jedem empfehlen, dessen Interesse über das bloße Hören der Musik hinausgeht.
http://www.telos-verlag.de/
Henning Mankell – Tea-Bag

Jesper Humlin veröffentlicht genau ein Buch pro Jahr und zwar eine Gedichtsammlung, die sich im Schnitt etwa tausendmal verkauft, doch seinem Verleger ist das nicht mehr genug, er möchte Jesper davon überzeugen, endlich einen Kriminalroman zu schreiben. Dabei ist Jesper doch erfolgreich auf seinem Gebiet, seine Gedichte sind anerkannt und gerade erst ist er von einer monatelangen Südseereise zurückgekommen, die er sich nur durch ein Stipendium finanzieren konnte. Sein wichtigstes Anliegen ist ihm nun eigentlich seine Sommerbräune, die er so lange wie möglich aufrecht erhalten möchte, doch neben seinem unzufriedenen Verleger stellt auch seine Freundin Andrea immer mehr Ansprüche. Sie möchte endlich ein Kind mit ihm und droht mit der Trennung und der Veröffentlichung ihres Privatlebens in Romanform. Es ist nicht so sehr die Angst vor der Trennung, die ihm schwer im Magen liegt, sondern die Möglichkeit, dass Andreas Buch sich besser verkaufen könnte als seine Gedichtsammlung.
Rebhandl, Bert – Orson Welles. Genie im Labyrinth
Mit nur einem Jubiläum wäre man dem Radio-, Theater-, Kino-, Fernseh- und Zirkusmenschen Orson Welles wahrscheinlich nicht gerecht geworden. Also bejubelt bzw. betrauert man ihn 2005 doppelt: Am 6. Mai wäre er 90 Jahre alt geworden, am 9. Oktober jährt sich sein Todestag zum zwanzigsten Mal. Jetzt, wo er tot ist und nicht mehr stört, kann man ihn weltweit als Ausnahmetalent abfeiern. Das war er tatsächlich, obwohl das Genie mit seinem Spieltrieb niemals mithalten konnte und von inneren Konflikten stärker als lange deutlich wurde geprägt war. Orson Welles versuchte viel, es gelang ihm wenig – das Ergebnis ist ein Leben voller Experimente und Brüche, das sich je nach Veranlagung des Kritikers als reich & bunt oder tragisch interpretieren lässt.
Bert Rebhandl geht mit „Orson Welles. Leben im Labyrinth“ zwangsläufig den zweiten Weg. Er konzentriert sich auf die Widersprüche, die Welles’ Leben und Werk prägen, wobei er vor allem die Querverbindungen zwischen beiden Welten aufdeckt: Der öffentliche und der private Orson Welles sind Geschöpfe, die eine immer stärkere Personalunion eingehen, bis man sie schließlich nicht mehr unterscheiden kann. Welles selbst hat das ebenfalls nicht mehr geschafft – nach Rebhandl eine weitere Quelle seiner nur bedingt geglückten bzw. glücklichen Selbstmystifizierung.
Nach mehr als einem Vierteljahrhundert Welles-Literatur ist es schwer, zwischen Wahrheit, Mythos und Kritikerinterpretation zu unterscheiden. Rebhandl bezeichnet sein Werk ausdrücklich nicht als Forschungsarbeit. Er stützt sich auf Material, das zugänglich ist: Welles’ Kino- und Fernsehfilme, seine Texte, seine berühmten Fragmente und Seltsamkeiten, die er im ungebrochenen Schaffensrausch seiner isolierten späten Jahren zustande brachte.
Biografische Entdeckungen schließt Rebhandl aus. Sie lassen sich aus Welles’ Werk nur bedingt erschließen und werden daher nur dort explizit ins Spiel gebracht, wo sie für die Kunst eine unmittelbare Rolle spielen. Seine Darstellung dieser Kunst gliedert der Verfasser in drei Linien:
– eine kulturkritische, die am Beispiel von Orson Welles der Frage nachgeht, wie oder ob sich künstlerische Subjektivität in einer kunsthandwerklichen Industrie behaupten kann;
– eine medienhistorische, die Welles folgt, der eine Spur durch praktisch sämtliche mediale Ausdrucksformen des 20. Jahrhunderts zog;
– eine autobiografische, welche die Werke und persönlichen Äußerungen Welles’ nutzt, um seine multiple Persönlichkeit zu erkennen und zu entschlüsseln.
Rebhandl kommt zu dem Ergebnis, dass diese drei Linien niemals ein exaktes Gesamtbild des Menschen Orson Welles ergeben können; dazu hat dieser zu erfolgreich an seinem eigenen Welles-Bild gearbeitet. Auch Rebhandl interpretiert, wobei er mögliche Missverständnisse oder Fehler (besonders in den biografischen Passagen) keineswegs ausschließt.
Damit steht er nicht allein, obwohl viele seiner Vorgänger es nicht zugeben mochten. Orson Welles (1915-1985), die „Erste Person Singular“, der große Medien-Magier, der an seiner Maßlosigkeit und am Unverständnis einer Welt, die seine Grandiositäten nicht finanzieren wollte, langsam und kläglich zu Grunde ging: So etwa sieht das Welles-Bild aus, das gern gemalt wird. Die Vorlage lieferte der Meister selbst, der gleich mit mehreren Donnerschlägen seine Karriere startete (u. a. „Krieg der Welten“, 1938 – Welles lässt marsianische Invasoren in den USA landen und sorgt für eine landesweite Panik; „Citizen Kane“, 1941 – Welles schreibt, dreht und spielt den bzw. in einem der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte), um seinen Wunderkind-Status in den nächsten Jahren systematisch zu demontieren, ohne jemals Einsicht in die Tatsache zu zeigen, dass auch der bedeutendste Künstler das System nicht permanent vor den Kopf stoßen und erwarten kann, von ihm getragen und gefördert zu werden. Welles hat genau dies sein Leben lang gefordert, den Bogen überspannt und ist dennoch auf seinem einsamen Marsch gegen die Institutionen geblieben. Lange Zeit ist es ihm gelungen, das daraus resultierende Scheitern als Sieg des Individuums als Märtyrer der Kunst zu verbrämen.
Erst allmählich verschaffen sich Ketzer Laut, die a) das Scheitern eines Künstlers nicht automatisch mit dem Scheitern eines großen Künstlers gleichsetzen, b) künstlerische Größe nicht primär an den Schwierigkeiten messen, denen ein Künstler sich in der bösen Banausenwelt ausgesetzt sieht, und c) Welles, den Breitband-Künstler, und sein Werk unter die Lupe nehmen und dabei entdecken, dass dieser oft auch nur mit Wasser kocht, um es salopp auszudrücken.
Dies ist kein Wühlen in biografischem Müll, sondern eine Entmystifizierung, die an der Bedeutung Orson Welles’ für die Kunst des 20. Jahrhunderts rein gar nicht rüttelt. Schließlich gibt es einen Welles nach „Citizen Kane“, dem u. a. Regie-Meisterwerke wie „Othello“ (1952), „Touch of Evil“ (1958) oder „Chimes at Midnight“ (1966) gelangen – ganz zu schweigen vom Schauspieler Welles, der zwar grausigen Zelluloidmist drehte, um eigene Projekte finanzieren zu können, aber immer wieder zu Glanzleistungen auflief, wenn man ihm eine angemessene Rolle bot („The Third Man“, 1949; „Moby Dick“, 1956 oder [„Catch-22“,]http://www.powermetal.de/video/anzeigen.php?id__video=335 1970; um nur drei von mehr als 100 Filmen nicht von aber mit Welles zu nennen).
Bücher über Genies – gerade über missverstandene – neigen zu einer gewissen Seitenfülle. Im Falle von Orson Welles, der sich gern als verhinderter Renaissancemensch sah, läge dies besonders nahe. Viele von Ehrfurcht gepackte Welles-Biografen und –Interpreten sind in diese Richtung gegangen. Bert Rebhandl verweigert sich dem. Er fasst zusammen und interpretiert neu, wofür ihm 192 Seiten reichen. Als Leser hat man nicht das Gefühl, dabei informativ zu kurz zu kommen.
Vor allem wirkt Rebhandls Buch nicht wie ein Schnellschuss zum Welles-Jubiläum, obwohl es natürlich von dem weltweiten Rummel – so stand u. a. im August 2005 eine Retrospektive von Welles-Werken auf dem Filmfestival von Locarno an – profitiert. Erstaunlicherweise liegt Welles’ filmischer Nachlass nicht irgendwo in den USA, wo ihm das Filmestablishment seine Eskapaden nie wirklich verzieh, sondern in Europa, das ihn wesentlich herzlicher empfing. (Finanziell auf dem Trockenen ließ man ihn freilich auch hier sitzen.) In München bemüht man sich – ebenso hilfsbereit wie argwöhnisch beobachtet von Welles’ letzter Lebensgefährtin Oja Kodar – seit 1995 um dieses Erbe, das Bert Rebhandl die Chance bot, manchen selten gesehenen oder gelesenen Film oder Text in seine Betrachtungen einfließen zu lassen.
Hier und da verfällt Rebhandl auf genau den Fehler, welchen er auch vielen Welles-Kritikern vorwirft: Er verbeißt sich um seiner Grundhypothese willen in Einzelheiten, die er förmlich zu Tode interpretiert, ohne dabei überzeugen zu können. Letztlich ist es „Rebhandls Welles“, der uns hier vorgestellt wird. Aber das hatte uns der Autor ja gesagt, also überspringen wir solche Passagen und werden rasch wieder mit angenehm formulierter Sachlichkeit belohnt, die uns die Lektüre zum informationsreichen Vergnügen werden lässt.
Murakami, Haruki – Tony Takitani
„Tony Takitani“ ist ein Buch, das aus dem Rahmen fällt. Recht großformatig geschnitten, etwas minimalistisch gestaltet und für den Zyniker geradezu papierverschwenderisch gedruckt. Gerade mal 64 Seiten, gerade mal etwa eine Dreiviertelstunde Lesevergnügen, für die der geneigte Leser satte 16 €uro auf den Tisch zu legen hat. Ganz haarspalterisch betrachtet, sind das 25 Cent pro Buchseite oder gar 35 Cent pro Leseminute. Manch einer wird angesichts dieses Preis-/Lesezeitverhältnisses nicht nur schlucken, sondern gleich die Finger von dem Buch lassen. Das ist einerseits verständlich, andererseits ob der Inhalte aber auch bedauerlich, denn „Tony Takitani“ ist ein waschechter Murakami, mit all seinen Qualitäten – nur eben in Kleinstausgabe.
Dass Haruki Murakami ein Ausnahmeautor ist, haben viele Leser schon längst begriffen. Er hat ein außerordentlich vielfältiges Repertoire, hangelt sich von Genre zu Genre, erzählt Romantisches, Visionäres und Fantastische, versteht sich aber auch auf ernste Themen mit dokumentarischem Charakter. Alles auf gleichsam hohem Niveau. Schon mit „Wie ich eines schönen Morgens im April das 100%ige Mädchen sah“ oder mit „Der Elefant verschwindet“ hat Murakami bewiesen, dass er auch über die kurze Distanz zu erzählen und den Leser gefangen zu nehmen weiß. Mit „Tony Takitani“ liefert er einen weiteren Beleg dafür.
Darüber hinaus ist „Tony Takitani“ der erste Murakami, der nicht nur als Buch Eindruck machen kann, sondern auch als Kinoverfilmung. Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des Buches läuft auch der gleichnamige Film in den deutschen Programmkinos an, wenngleich auch sicherlich eher vor kleinem Publikum. Das mag wieder den Zyniker auf den Plan rufen, der einwirft, dass er für einen Buchkauf auch zweimal ins Kino gehen könnte, so teuer wie das Buch ist. Das lässt sich alles nicht leugnen und ob ein so hoher Preis für lediglich eine Novelle gerechtfertigt ist, da darf man sicherlich so manchen Zweifel hegen.
Über jeden Zweifel erhaben ist dagegen der eigentliche Inhalt des Buches. Murakami erzählt wieder einmal eine Geschichte über Zwischenmenschliches – über Nähe und Isolation, über Liebe, Einsamkeit und Verlust.
Tony Takitani, Hauptfigur und Namensgeber der Geschichte, hat keine leichte Kindheit. Die Mutter stirbt drei Tage nach seiner Geburt, das Verhältnis zum Vater bleibt stets ein wenig unterkühlt. Obendrein wird er aufgrund seines amerikanischen Vornamens gehänselt, teilweise gar als vermeintliches Mischlingskind verspottet. Dabei ist Tony Takitani ein waschechter Japaner.
Seine Kindheit verläuft ansonsten unspektakulär. Der Vater verdient seine Brötchen als Jazz-Posaunist, während Sohnemann seine Leidenschaft für das Zeichnen entdeckt. Ganz akkurat und geradezu detailbesessen führt Tony Takitani den Bleistift. Dass er später technischer Zeichner wird, verwundert niemanden. Ähnlich akkurat und leidenschaftslos wie seine Zeichnungen, verläuft auch Tony Takitanis Privatleben. Er ist allein und lebt recht unspektakulär vor sich hin. Tony Takitani hat sich mit seiner Einsamkeit abgefunden.
Das ändert sich, als er eines Tages eine junge Frau kennen lernt. Schnell erkennt er, dass diese Frau für ihn etwas Besonderes bedeutet. Er verliebt sich in sie – eine Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Die beiden heiraten und Tony Takitani findet in seinem Leben endlich das, was ihm immer gefehlt hat. Der einzige Schatten, der dieses Glück trübt, ist die Besessenheit, mit der Tony Takitanis Frau Kleider kauft. Als ihre Kleider irgendwann schon ein ganzes Zimmer in Tony Takitanis Haus füllen, bittet er seine Frau, sich doch vielleicht ein bisschen zu mäßigen. Sie zeigt sich einsichtig, weiß um das Krankhafte ihrer Leidenschaft und verspricht sich zu bessern.
Kurz darauf verunglückt die Frau tödlich mit dem Auto. Tony Takitani ist untröstlich. Der Anblick des Zimmers voller Kleider ist ihm unerträglich. Er versucht all die abgestreiften Hüllen, die seine Frau zurückgelassen hat, wieder mit Leben zu füllen und macht sich auf die Suche nach einer 1,61 m großen Frau mit Kleidergröße 34 …
„Tony Takitani“ ist eine Geschichte, die einem so schnell nicht aus dem Kopf geht und somit ein typischer Murakami. Murakami ist ein Meister im Erzählen von Geschichten, die einem nicht aus dem Kopf gehen und so steht „Tony Takitani“ in bester Murakami-Tradition.
Schon nach wenigen Zeilen nimmt uns die Geschichte gefangen. Haruki Murakamis Erzählstil wird von einer merkwürdigen Poesie getragen. Seine Geschichten haben etwas Magisches, dem sich der Leser nur schwer entziehen kann. Er fesselt, durch seine Art zu erzählen, durch seinen bedachten Umgang mit Worten, durch die Bilder, die er im Kopf erzeugt. Seine Erzählweise, die auf den ersten Blick ein wenig kühl und distanziert wirken mag, ist bei näherer Betrachtung das genaue Gegenteil: eindringlich und emotionsgeladen – aber eben auf ihre ganz eigene Art und immer wieder auch ein wenig verstörend.
Auch „Tony Takitani“ zeigt deutlich diese Mischung. Auf der einen Seite Distanz und deutlich spürbare Kühle. Auf der anderen Seite ein tiefer Einblick in Emotionales. Tony Takitanis Frau bekommt nicht einmal einen Namen, man erfährt nichts über ihr Leben, weiß nur um ihre Kleiderbesessenheit. Ihr Tod kommt plötzlich und unerwartet, geradezu beiläufig und gerade darin liegt bei Murakami so viel Wucht: |“In diesem Moment raste ein Lastwagen, der noch bei Gelb über die Kreuzung fahren wollte, mit voller Geschwindigkeit in ihren Renault Cinque. Ihr blieb nicht einmal Zeit, etwas zu spüren.“|
Tony Takitani ist fortan wieder allein. Und trotz der Kürze der gesamten Geschichte kann man sehr gut mit ihm fühlen. Diesmal erwischt die Einsamkeit ihn eiskalt. Isoliert steht er da, während das Leben vor seiner Tür weiterzieht und er scheint unfähig, daran teilzuhaben. Einsamkeit war ihm von früherer Zeit so vertraut und doch ist sie ihm so neu. Murakami schafft es mit ganz einfachen Mitteln, mit so wenigen Worten, dies einfühlsam zu vermitteln.
Es sind Erzählelemente, die recht typisch für Murakami sind. Liebe und Einsamkeit, Verlust und Isolation spielen oft eine Rolle in seinen Erzählungen und dennoch zeigt „Tony Takitani“ noch eine eigene Spielart. Unstrichen wird diese auch durch die Aufmachung des Buches. „Tony Takitani“ ist in zweifacher Hinsicht ein Kunstwerk – literarisch und visuell.
Das Buch mit dem dicken, schlichten Pappeinband ist angereichert mit Bildern aus der Verfilmung von Jun Ichikawa. Bilder, die schon einen recht guten Eindruck vermitteln und Lust auf den Film machen. Bilder, die all die Emotionen widerspiegeln, die auch Murakami auf erzählerische Art vermittelt. Entfärbt und in schlichtem, kühlem Blaugrau gehalten, erzeugen die Bilder ein absolut stimmiges Bild. € 16,- für eine 64-seitige Novelle mögen schon sehr teuer sein, aber zweifelsohne bekommt man dafür auch ein ungewöhnliches Buch geboten.
Haruki Murakami beweist mit „Tony Takitani“ einmal mehr auf eindrucksvolle, nachhaltig beeindruckende Art, dass er ein Meister des Erzählens ist. Man denkt auch nach dem Ende der Erzählung immer wieder an Tony Takitani zurück. So leidenschaftslos sein Leben auch wirken mag, er ist dennoch eine Figur, die einem immer wieder in den Sinn springt, aber das haben Murakami-Figuren auch irgendwie so an sich. Ein Murakami zieht nicht spurlos an einem vorbei – auch dieser nicht. Ein Autor, der Eindruck macht und eine Erzählung, die im Gedächtnis haften bleibt.
Murakami-Fans werden so auch weiterhin daran festhalten, den Nobelpreis für ihren Star zu fordern. Oder, wie ich es einst in einer Kundenrezension des Online-Buch-Giganten |Amazon| las: „Sie haben noch nie einen Murakami gelesen? Sie Glücklicher. Dann haben Sie das Beste ja noch vor sich.“
Isau, Ralf – Jahrhundertkind, Das (Der Kreis der Dämmerung, Teil 1)
Seit Jeff Fenton Waise ist, schlägt er sich mit kleinen Diebstählen und Gelegenheitsarbeiten durch. Da kommt ihm das Angebot eines gewissen Nekromanus wie ein echter Glücksfall vor. Er soll einen Tag lang in der Küche Lord Belials für ein erkranktes Küchenmädchen einspringen und dafür zwei ganze Shillinge verdienen! Pünktlich findet er sich auf dem abgelegenen Landgut ein und wird einem japanischen Koch zugeteilt, der ihm beim Putzen und Schnippeln von Gemüse ununterbrochen von seiner Heimat vorschwärmt. Letztlich landet er zu seiner Überraschung beim Servierpersonal, das allerdings im Augenblick noch die Zeit mit Warten totschlägt. Jeff meldet sich freiwillig, den Kutschern der Gäste Tee hinauszubringen. Auf dem Rückweg macht er eine brisante Entdeckung. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Jeff flüchtet Hals über Kopf …
Rund achtzehn Jahre später, auf den Glockenschlag genau um Mitternacht des ersten Januar 1900 wird in Japan David Viscount of Camden geboren, als Sohn eines Botschafters, des Earl Geoffrey of Camden. Das Baby hat schlohweiße Haare. Die Hebamme erklärt den Eltern, es sei ein Jahrhundertkind, dazu geboren, in einer Zeit, in der das Yin, der Aspekt des Bösen, ein Übergewicht gegenüber dem Yang erhalte, den Ausgleich wieder herzustellen. Schon bald zeigen sich auf unspektakuläre Art die besonderen Gaben des Kindes, das sich unter anderem mit dem Enkel des Tenno, Hiruhito, anfreundet. Die Camdens hätten recht glücklich sein können, wenn nicht Davids Vater überaus empfindsam auf jegliche Arten von umstürzlerischer Aktivität wie Attentate, Aufstände und Putsche reagiert hätte. Jede solche Nachricht stürzt ihn in immer größere Depression, und als in Davids dreizehntem Lebensjahr ein Attentat auf die Familie verübt wird, entschließen sich die Camdens, Japan zu verlassen. Die Familie zieht nach Wien, doch kaum dort angekommen, bricht der Erste Weltkrieg aus. Alle Diplomaten werden in die Heimat zurückbeordert, also kehrt Geoffrey of Camden mit Frau und Kind in sein Stadthaus in London zurück. Dort holt ihn ein Schatten aus seiner Vergangenheit heim, der seinen endgültigen Absturz in die Depression bewirkt. David kann das alles überhaupt nicht nachvollziehen. Erst als seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen und David vom Notar der Eltern das Tagebuch des Vaters erhält, findet er heraus, was für eine ungeheure Bürde ihm auferlegt ist …
Das Buch ist in drei Teile gegliedert, wobei der kurze erste Teil auf die Erlebnisse Jeff Fentons, also sozusagen die Einleitung, entfällt. Der zweite Teil erzählt von Davids Kindheit und Jugend, der dritte von der Zeit bis 1929.
In der Hauptsache ist es natürlich Davids Geschichte: seine Kindheit in Japan, seine Freunde Hito und Yoshi, seine Ausbildung in japanischer Kampfkunst, später seine Schulzeit in England und sein Freund Nick. Es ist parallel dazu, zumindest bis 1916, auch die Geschichte seines Vaters und dessen fortschreitender geistiger Zerrüttung. Vor allem aber ist es auch Geschichte! Historik!
David – und auch der Leser – erlebt das schier unaufhaltsame Hineinrutschen in den Ersten Weltkrieg hautnah mit, vor allem deshalb, weil diese Entwicklungen so eine gravierende Auswirkung auf den Gesundheitszustand seines Vaters haben. Die Schrecken des Ersten Weltkrieges erlebt David umittelbar als Soldat, und obwohl sich der Autor mit blutigen Details extrem zurückhält, gelingt es ihm, das ungeheure Ausmaß dieser Katastrophe überdeutlich zu vermitteln und nebenbei noch die Unfähigkeit und Menschenverachtung sämtlicher Heerführer herauszustreichen. Zu Recht trägt der zweite Teil des Buches die Überschrift „Jahre des Wahnsinns“. Damit ist nicht nur Davids Vater gemeint!
Der dritte Teil rückt die historischen Ereignisse etwas in den Hintergrund. Wirtschaftskrisen und ähnliches werden nur am Rande erwähnt, denn David hat endlich seine Bestimmung akzeptiert und sich daran gemacht, den „Kreis der Dämmerung“ zu suchen, jenen Zirkel, der sich dazu verschworen hat, die Menschheit auszulöschen. Nebenbei hat er sich verliebt, und so erzählt die zweite Hälfte des Buches hauptsächlich von seiner Suche nach Anhaltspunkten, von seiner Heirat und seinen Reisen, und von seiner ständigen Verfolgung durch den Schatten.
David ist der zentrale Charakter des Buches. Ein Junge mit einem einfühlsamen, freundlichen Herzen, durch seine Jugend in Japan weltoffen und vorurteilslos und mit einem scharfen Verstand begabt, der ihm schon in jungen Jahren ein gesundes Misstrauen gegenüber den Mächtigen der Welt vermittelt. Sein ausgeprägtes Mitgefühl macht es ihm unendlich schwer zu töten, was ihn an der Front, wo er sich vorzugsweise mit der Bergung verletzter Kameraden beschäftigt anstatt auf den Feind zu schießen, in ziemliche Schwierigkeiten bringt. Erst als er mit seiner großen Liebe Rebekka verheiratet ist, siegt sein Bedürfnis, sie zu beschützen, über seine Ablehnung jeglicher Gewalt.
Rebekka ist ein quirliger Wirbelwind, fröhlich und voller Leben, aber auch klug und ausnehmend hübsch. Sie hat es sich in den Kopf gesetzt, David zu heiraten, davon können sie auch seine Bedenken im Hinblick auf die Gefahren seiner Lebensaufgabe nicht abhalten. Rebekka ist eine starke Frau. Trotz allem, was David ihr abverlangen muss, unterstützt sie ihn in jeder Hinsicht.
Die übrigen Charaktere des Buches geben sich sozusagen die Klinke in die Hand. Denn der Schatten, der David verfolgt, neigt dazu, alle Personen aus dem Leben zu befördern, die David in irgendeiner Weise halfen oder nahe standen. Dennoch gelingt es dem Autor, ihnen allen Leben einzuhauchen, ganz gleich, wie knapp sie auch umrissen sein mögen.
Bemerkenswert ist die Figur Lord Belials. Schon der Name weckt einen bestimmten Verdacht. Isau hat darauf verzichtet, die äußere Erscheinung genauer zu beschreiben, und sich stattdessen auf Gefühle, Eindrücke, Empfindungen konzentriert, die das Böse in Jeff bewirkt. Das Grauen ist gesichtslos. Eine in der aktuellen Fantasy eher unübliche Vorgehensweise, wie sie Tolkien, der angeblich ja Vater aller Fantasy ist, ebenfalls verwendet hat. In dieser Hinsicht scheinen ihm seine Jünger allerdings eher ungern folgen zu wollen.
Eine weitere Hommage an den Vater der Fantasy findet sich im Auftreten von Tolkien selbst! David trifft ihn in Oxford in einem Pub und unterhält sich lange mit ihm. Tolkien erwähnt sein Vorhaben, den |Herrn der Ringe| zu schreiben, vor allem aber hilft er David bei seiner Suche nach dem Kreis der Dämmerung auf die Sprünge, indem er die Ursprünge des Wortes Kreis beleuchtet und damit beim Ring landet. Und vielleicht enthält ja auch das Motiv der Ringe, die Lord Belial den Mitgliedern des Kreises übergab, und dem besonderen, der ihm selbst gehörte, eine Verbeugung vor dem berühmten Schriftsteller.
Anlass zum Schmunzeln bot dagegen eine Hommage Isaus an sich selbst. So durften David und seine Frau Rebekka kurz nach ihrer Trauung Zeuge des Trauerzuges zum Gedenken an Jonathan Jabbok werden. Die |Neschan|-Trilogie war Isaus erste große Veröffentlichung.
Nicht nur Personen wurden von Ralf Isau geschickt in Davids Leben eingebaut, auch weniger bedeutsame Ereignisse sowie solche jenseits der Politik lässt er am Rande in den Handlungsfaden einfließen, ganz ohne Hänger oder Stolperer zu verursachen. So findet die Hinrichtung Saccos und Vanzettis ebenso Erwähnung wie der Untergang der |Titanic| oder die Entdeckung des Penicillins.
Aus diesen Zutaten ergibt sich eine ganz eigene Mischung. Im Grunde ist es ein Fantasy-Roman: die Bedrohung der gesamten Welt durch ein übermächtiges Böses sowie die Beschreibungen Lord Belials, seines Schattens Nekromanus und Davids magischer Fähigkeiten sind typische Kennzeichen des Fantasy-Genres. Während die meisten Fantasy-Autoren jedoch eine eigene Welt für ihre Geschichten erfinden oder diese in ferner Vergangenheit – vorzugsweise dem Mittelalter – ansiedeln, hat Ralf Isau seine Handlung an die jüngste Vergangenheit geknüpft. An unsere Vergangenheit! Die unserer Eltern und Großeltern! Isaus Geschichte spielt nicht vor langer, langer Zeit oder an einem weit entfernten Ort. Sie spielt hier. Und das Ende des letzten Jahrhunderts ist noch nicht lange her. Das war vorgestern. Er erzählt unsere Geschichte.
Durch die enge Verbindung mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts mutet die Erzählung fast ein wenig wie ein Historienroman an, allerdings in einem ganz anderen Stil, als man es sonst von diesem Literaturzweig kennt. Ralf Isau hat seine eigene Art etwas zu erzählen. Jenseits der trockenen Betrachtungsweise des Geschichtsunterrichts, der sich hauptsächlich mit dem politischen Geschehen als solchem und seinen Ursachen und Wirkungen beschäftigt, spricht der Autor von Menschen und ihrer Wahrnehmung der Ereignisse, und das in durchaus unsachlicher Weise, aber auch frei von jeder Polemik, einfach nur mit der Stimme des gesunden Menschenverstands.
Isau erzählt nicht nur einfach eine fantastische Geschichte. „Der Kreis der Dämmerung“ ist mehr als reine Unterhaltungsliteratur, er macht nachdenklich.
Lediglich eine einzige Frage stellte sich mir bezüglich der ganzen Geschichte: Warum hat Lord Belial nicht sofort nach dem Verlust seines Rings, der offensichtlich von größter Wichtigkeit für ihn ist, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihn wiederzubekommen? Jeff war ihm offensichtlich weit weniger gewachsen als David!
Im Hinblick auf den gelungenen Rest des Buches sei jedoch darüber hinweggesehen.
Alles in allem hat Ralf Isau mit „Das Jahrhundertkind“ einen hervorragenden Roman vorgelegt. Er ist spannend, unterhaltsam und vor allem intelligent! Sollten die drei Folgebände des Zyklus das Anfangsniveau halten, dann darf „Der Kreis der Dämmerung“ mit Fug und Recht als ganz großer Wurf gewertet werden. Auf jeden Fall erhält dieser erste Band von mir das Prädikat: unbedingt lesen!
Ralf Isau, gebürtiger Berliner, war nach seinem Abitur und einer kaufmännischen Ausbildung zunächst als Programmierer tätig, ehe er 1988 zu schreiben begann. Aus seiner Feder stammen außer der Neschan-Trilogie und dem Kreis der Dämmerung unter anderem „Der Herr der Unruhe“, „Der silberne Sinn“, „Das Netz der Schattenspiele“ und „Das Museum der gestohlenen Erinnerungen“. In der Reihe Die Legenden von Phantásien ist von ihm „Die geheime Bibliothek des Thaddäus Tillmann Trutz“ erschienen. Im Juli dieses Jahres wird der erste Band der Chroniken von Mirad unter dem Titel „Das gespiegelte Herz“, im September „Die Galerie der Lügen“ herausgegeben. In der Zwischenzeit arbeitet der Autor an den Folgebänden der Chroniken von Mirad.
Taschenbuch: 751 Seiten
ISBN-13: 978-3-404-15318-3
http://www.luebbe.de/
http://www.isau.de/index.html
Der Autor vergibt: 



http://www.isau.de
Petru Popescu – Die Vergessenen von Eden
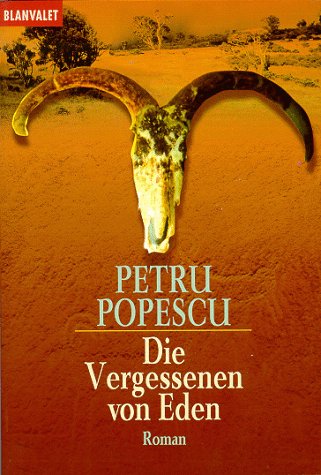
Weber, Wolfgang H. – Vindepos der Barde. Ein Keltenroman
Vindepos wächst in Vindelica auf, einem Gebiet, das vom Bodensee bis zum Inn und vom Alpenrand bis an die Donau reicht. Sein Onkel ist der Fürst der Ambronen, sein Vater ein berühmter Barde. Dementsprechend erhält Vindepos eine sehr gute Erziehung zusammen mit seinem Vetter, wenngleich man sagen muss, dass Vindepos ganz offensichtlich nicht zum Krieger geboren ist. Wie sehr sich Vindepos tatsächlich von seiner Familie unterscheidet, wird erst klar, als er eines Tages anfängt, Albträume zu haben. Zuerst ist es nur einer, den er immer wieder träumt, dann kommt ein zweiter dazu, und schließlich ein dritter, der nicht wirklich ein Albtraum ist. Vindepos weiß nicht, mit wem er darüber reden soll, also schweigt er.
Da geschehen zwei Dinge:
Ein brutales Gewitter überrascht die Fischer des Dorfes auf dem See. Das Boot des Fürsten, an Bord auch Vindepos Vater, läuft aus, um die Männer des gekenterten Boote zu retten, doch ein Blitz schlägt in den Mast ein. Das Schiff sinkt. Nur ein einziger Mann überlebt.
Bald darauf erhält die Festung seines Onkels Besuch von Raitorix, einem Sohn des obersten Fürsten Vindelicas. Raitorix hat einen Druiden in seinem Gefolge, der sofort erkennt, dass Vindepos ein besonderes Kind ist. Er schlägt der Mutter vor, ihn auf dem Rückweg seiner Reise mit in die Hauptstadt zu nehmen, um ihn dort ausbilden zu lassen. So folgt Vindepos einige Zeit später dem Druiden Queiragnos nach Cambodunon. Schon bald wird er in Rivalitäten und Intrigen hineingezogen.
„Vindepos, der Barde“ wirft den Blick auf einen Geschichtsabschnitt, der schon allein deshalb interessant ist, weil es so wenig darüber zu lesen gibt. Es gibt nicht viele Romane, die sich mit dem vierten Jahrhundert vor Christus beschäftigen, und wenn, dann erzählen sie in der Regel vom Mittelmeerraum, von Griechenland oder Ägypten. Der Ort der Handlung findet sich hauptsächlich in Romanen über die Eroberung Germaniens durch die Römer wieder, und das Volk der Kelten bringt der Leser zunächst einmal mit Irland, Großbritannien und Artus in Verbindung.
Tatsächlich siedelten die Kelten davor bereits im süddeutschen Raum, im Alpengebiet, in Norditalien und in Frankreich. Diese frühere Keltenkultur ist die Basis für die Geschichte von Vindepos.
Vindepos ist ein intelligentes Kind von eher ruhigem Naturell. Der Verlust des Vaters trifft den Jungen tief, vor allem, weil er sich Vorwürfe macht. Er glaubt, er hätte seinen Vater retten können, denn die Ereignisse des Schiffsunglücks waren Gegenstand seines ersten Albtraumes. Sein Verdacht, dass diese stets wiederkehrenden Träume mehr sind als einfache Nachtmahre, wird schließlich durch den Druiden Queiragnos bestätigt. Doch noch versteht Vindepos zu wenig vom Wirken der Götter, um die Bedeutung dessen ganz zu begreifen. Seine Ausbildung ist vor allem die zum Barden, auch wenn der Druide des Hochfürsten, Dannorix, darauf besteht, ihm noch eine Menge anderer Dinge beizubringen. Selbstredend wird Vindepos auch noch eine weiter gehende Ausbildung brauchen. Zuvor jedoch muss er einen Reifeprozess durchlaufen, dessen Katalysator die diesseitige Welt ist.
Vonatorix, der eheliche Sohn des Hochfürsten und sein designierter Nachfolger, hat mit Vindepos gemeinsam Unterricht. Er liebt es, gemeinsam mit seinem Klüngel ausgiebig auf Vindepos herumzuhacken. Als die Jungen älter werden, werden sie außerdem zu Rivalen um die Gunst der hübschen Bardala. Vonatorix, gewohnt, alles zu bekommen, was er will, reizt Vindepos bis zur Weißglut und liefert sich sogar eine Schlägerei mit ihm. Als Bardala sich letztlich doch für Vindepos entscheidet, speit Vonatorix Gift und Galle.
Raitorix ist der älteste Sohn des Hochfürsten, allerdings ein Bastard. Von seinem Vater in der Thronfolge nicht berücksichtigt zu werden, wurmt ihn gewaltig. Raitorix ist ein guter Krieger und versteht es außerdem, Leute für sich zu gewinnen. Dass er noch weit mehr ist als das, wird dem Leser im Laufe der Erzählung nur zu bald klar. Vindepos und sein Lehrmeister scheinen allerdings die Einzigen zu sein, die etwas davon bemerken. Raitorix scheint fest entschlossen, Vindepos‘ Förderer zu werden. Vindepos gefällt das gar nicht, und spätestens als Raitorix beginnt, ihm nachzustellen, ist der Bruch absehbar.
Queiragnos ist der undurchsichtigste Charakter des Buches. Zu Anfang ist er Vindepos durchaus eine Hilfe, im weiteren Verlauf jedoch wird seine Handlungsweise immer zwiespältiger. In seiner Eigenschaft als Druide und mit einer gewissen Fähigkeit des Sehens begabt, lässt er sich nicht so einfach beurteilen. Seine Gedanken bleiben vage, sein Mienenspiel undeutbar. Über seine Gefühle und Beweggründe wird nichts verraten. Der Leser wird sich wohl bis zum bitteren Ende mit der unbeantwortbaren Frage herumschlagen müssen, wer Queiragnos wirklich ist: der Druide, der nur den Willen der Götter vollzieht, die ihn zum Judas bestimmt haben, oder der Mann, der aus eigener Überzeugung handelt. Wie weit ist er bereit zu gehen?
Aus diesen gekonnt und glaubhaft geschilderten Personen und vor dem Hintergrund der altertümlichen Keltenkultur hat Wolfgang H. Weber einen gelungenen Roman konstruiert. Die Handlung ist eher ruhig gehalten, Charaktere und Intrigen nehmen einigen Raum ein, trotzdem passiert noch genug, um keine Langeweile aufkommen zu lassen, angefangen bei dem erwähnten Gewittersturm, über Krieg und Schlacht bis hin zu Entführung und Mord. Beide Seiten hat der Autor gekonnt ausbalanciert.
Die Lebensumstände der Menschen, manchmal lediglich im Detail angedeutet, kommen dennoch sichtbar zum Ausdruck. Rechtsprechung, Währung, Kleidung, Bräuche, Religion, das alles fügt sich zum Bild einer durchaus komplexen Kultur zusammen. Um dies zu unterstützen, hat der Autor an vielen Stellen Wörter aus der keltischen Sprache eingefügt. In Bezug auf religiöse Begriffe oder Worte, die Charakteristisches der damaligen Kultur beschreiben, wie den Kriegerbund des Raitorix, war das durchaus gelungen, als es dann aber an Begriffe ging, die lediglich Verwandtschaftsverhältnisse darlegten, wurde es etwas übertrieben. Immerhin war das Glossar vorbildlich aufgebaut, sodass es beim Nachschlagen keine Probleme gab, und mit der Zeit erübrigte sich das auch.
Abgesehen von besagtem Nachschlagen liest das Buch sich leicht und flüssig. Nebensätze in den Hauptsatz einzubetten, anstatt sie hintendran zu hängen, ist inzwischen zwar nicht mehr allzu üblich und zwingt deshalb zu etwas mehr Konzentration, das schadet aber nichts. Das Lektorat war ausnehmend gut!
Da Vindepos bisher „nur“ bis zum Barden gekommen ist, steht die Religion noch eher im Hintergrund, was sich im zweiten Band aber ändern dürfte, denn der trägt den Titel „Vindepos der Seher“. Das Bedauerliche ist nur, dass dieser Folgeband offenbar noch nirgendwo erschienen ist, obwohl der erste bereits im Jahr 2000 veröffentlicht wurde und der dritte Teil „Vindepos der Druide“ auch schon geschrieben ist! Der Homepage des Autors ist zu entnehmen, dass er offenbar keinen Verlag finden kann.
Vielleicht hat der erste Band nicht die erwarteten Verkaufszahlen gebracht. Das hätte das Buch in der Tat nicht verdient! Mag sein, dass der Grund dafür in dem schlichten, unauffälligen Cover zu suchen ist, das ich persönlich als edel und recht passend empfinde. Im Gros der bunten Umschläge dürfte es durchaus auffallen, ob es aber auch zum Kauf animiert … Manch einer fühlt sich eventuell auch durch den Preis abgeschreckt, der mit 14,00 Euro für nicht mal dreihundert Seiten doch ziemlich hoch liegt.
Trotzdem: Ich fand das Buch auf jeden Fall äußerst lesenswert, eine angenehme Abwechslung für jemanden, der sich für diese Kultur interessiert, von den Massen an Artus-Literatur aber allmählich genug hat.
Wolfgang H. Weber studierte Germanistik und Geschichtswissenschaft und schreibt bereits seit 15 Jahren, nicht nur Historienromane, sondern auch Science-Fiction. „Vindepos der Barde“ ist das einzige seiner Bücher, das bisher verlegt wurde. Äußerst schade! Nicht nur, weil ich gerne wüsste, wie Vindepos‘ Geschichte weitergeht, auch einige andere Titel aus seiner Liste klingen sehr vielversprechend!
http://www.wolfganghweber.de/romane.htm
http://www.wolfganghweber.de/einleitu.htm
Martin, Julia Wallis – Tanz mit dem ungebetenen Gast
Lyndle Hall im Naturschutzpark Northumberland an der Grenze zu Schottland ist ein Ort, an dem es quasi spuken |muss|: Einsam mitten im düsteren, feuchten Moor gelegen und dort schon im Mittelalter erbaut, ist der gewaltige Bau – mehr Trutzburg als Gutshof – heute zu einer halb verfallenen, eigentlich unbewohnbaren Ruine heruntergekommen. Doch die letzten Nachfahren der einst mächtigen und reichen Familie Herrol harren stur in dem alten Gemäuer aus: Claudia, die herrische Dame des Hauses, und ihr Gatte Francis, der gleichzeitig ihr Cousin ist. Der zweifelhaften Verbindung entsprang Sohn Nicholas, der schon seit frühester Kindheit zwischen Lyndle Hall und der Nervenklinik Broughton pendelt.
Zu allem Überfluss beginnen nun auch böse Geister aus dem Jenseits den jungen Mann zu piesacken: Aus dem Nichts erscheinen üble Bissmale auf seinem Körper. Da die Attacken immer heftiger werden, wendet sich die ratlose Mutter an das „British Institute for Paranormal Research“ in Edinburgh. Dort versucht man seit Jahren eher schlecht als recht dem Übernatürlichen auf die Spur zu kommen und reagiert sehr interessiert auf Claudias Bitte, ihr einen Spezialisten zu schicken. Aus trauriger Erfahrung klug und misstrauisch geworden, schickt das Institut Dr. Audrah Sidows, die spezialisiert darauf ist, scheinbare parapsychologische Phänomene und Schwindler zu entlarven. Weil sie in den vielen Jahren ihrer Tätigkeit nie einen echten Spuk entdecken konnte, hat sie nun ihre Kündigung eingereicht: Lyndle Hall wird ihr letzter Hausbesuch sein.
In Lyndle beginnen sich zur selben Zeit sehr irdische Mächte zu formieren. Die Polizei, verkörpert durch Detective Inspector Tate, bemüht sich, die junge Studentin Ginny Mulholland zu finden. Sie war einer Einladung Nicholas Herrols gefolgt, sich als Haushaltshilfe in Lyndle Hall zu verdingen. Seitdem ist sie verschollen – ebenso wie Francis, der Hausherr, mit dem sie nach Auskunft Claudias durchgebrannt ist. Tate mag dem nicht recht Glauben schenken und vermutet eher eine Bluttat des inzwischen völlig irre gewordenen Nicholas‘.
Ginny Mulhollands Verschwinden hat die Aufmerksamkeit der Medien erregt – und den mysteriösen John Cranmer nach Lyndle gelockt. Dieser hat sich einen Namen als Medium gemacht und rühmt sich seiner Kontakte zum Jenseits. Zu gern würde er mit der Polizei zusammenarbeiten und erregt durch seinen Eifer Tates Misstrauen. Aber Cranmer ist gerissen, und niemand weiß dies besser als Audrah Sidows, die ihm schon lange auf die Schliche kommen möchte. Denn er kennt Audrahs gut gehütetes Geheimnis: Vor acht Jahren verschwand ihr Gatte Lars während eines Waldspaziergangs, während er praktisch neben ihr lief – er wurde nie gefunden, und seitdem hofft Audrah insgeheim auf Hilfe aus dem Geisterreich. Cranmer reizt und quält sie mit Andeutungen, die vorgeblich auf seine Sehergabe zurückgehen und gerade so viel Wahrheit enthalten, dass ihm wissenschaftlich oder juristisch nicht beizukommen ist.
Die Situation verwirrt sich weiter, als unweit von Lyndle Hall die junge Rachel Harvey aufgegriffen wird. Sie hat von einer Tante ein Cottage geerbt und dort nun einen Geist gesehen, wie sie behauptet. Solche Neuigkeiten sind Wasser auf die Mühlen von Marion Thomas, die vor zwei Jahren ihre Tochter bei einem tragischen Unglück verloren hat. Die Mutter vermutet allerdings einen vertuschten Mord und terrorisiert die Behörden und die Presse mit ihrem zur fixen Idee geronnenen Verdacht. Da sich der berühmte Cranmer in Lyndle aufhält, beschließt Marion, ihn dort aufzusuchen und um Hilfe zu bitten.
In Lyndle Hall sind die Dinge inzwischen dramatisch in Bewegung geraten. Der emsige Tate hat sich einen Durchsuchungsbefehl beschafft und findet tatsächlich die Leiche einer unter bizarren Umständen umgekommenen jungen Frau – sie muss allerdings schon viele, viele Jahre dort gelegen haben. Der nächste Leichenfund folgt kurze Zeit später, doch auch dieses Opfer ist keineswegs die viel gesuchte Ginny. Das wahre Geheimnis von Lyndle Hall ist höchst komplex; die Beteiligten werden noch manche unschöne Überraschung erleben, bis es endlich gelüftet ist …
Dass die wahren Ausgeburten der Hölle auf dieser Welt in der Regel dem menschlichen Geist entspringen, ist heute eine allseits bekannte und auch akzeptierte Tatsache. Allerdings gibt es da eine Nische oder besser gesagt ein Reservat, in dem einige Fabeltiere aus der Frühzeit der Vernunft bis ins 3. Jahrtausend überleben konnten: das Jenseits oder das Reich der Geister, wo sich die Seelen der Verstorbenen mit Dämonen aller Art und Bosheit ein Stelldichein geben. Wenn sie sich dort langweilen, kommen sie gern auf einen Sprung in diese Welt und geben sich mal kryptisch, mal finster. Auf jeden Fall sind sie schwer zu verstehen und noch schwieriger zu fassen, was praktisch für eine bestimmte Sorte Mensch ist, die sich als Mittler zwischen den Sphären versteht, um auf diese Weise Ruhm oder Geld zu erlangen oder wenigstens die eigene Mittelmäßigkeit zu überwinden.
Alle hier skizzierten Typen treffen wir in „Tanz mit dem ungebetenen Gast“ wieder. Geradezu didaktisch stellt sie uns Julia Wallis Martin vor. Dies geschieht in der ersten Hälfte ihres neuen, im Original wie in der Übersetzung anscheinend gleichzeitig erscheinenden Werkes mit dem dieser Autorin eigenen Geschick, eine spannende Handlung nicht nur erfinden, sondern zügig und einfallsreich und mit vielen unerwarteten Hakenschlägen einem furiosen Höhepunkt zuzutreiben. Das Ganze spielt in einer liebevoll gestalteten Kulisse, die ohne Angst vor dem Klischee (und wohl auch ein wenig ironisch) mit allen Requisiten ausgestattet wurde, die uns die klassische Gespenstergeschichte lieb und teuer werden lässt.
Der Abstecher ins Phantastische überrascht dabei nur im ersten Augenblick. Wie immer bei Martin steht im Mittelpunkt der Mensch, der keine Geister braucht, um sich und den Seinen das Leben schwer zu machen. Deshalb folgt in der zweiten Hälfte die „logische“ Auflösung aller seltsamen Ereignisse, die sich beim „Tanz“ zugetragen haben. Dies sei an dieser Stelle verraten, ohne dass dadurch dem Leser die Spannung genommen werde; eine echte Überraschung ist es ohnehin nicht, da Wallis selbst diese Katze frühzeitig aus dem Sack lässt.
Überhaupt sind zur zweiten Hälfte von „Tanz mit dem ungebetenen Gast“ einige kritische Anmerkungen zu machen. Martin verfängt sich dort sichtlich im Geflecht ihrer Handlung, das sie selbst so kunstvoll gewoben hat. Vielleicht hätte sie besser nicht das gesamte Handbuch des Okkulten und einen Crashkurs in Küchen-Psychologie zu einem einzigen, dazu nicht sehr umfangreichen Roman verarbeitet. Die Erklärungen für das scheinbar Übernatürliche sind jede für sich überzeugend. In ihrer Gesamtheit und vor allem im Zusammenspiel stellen sie die Geduld des Lesers indes auf manche Probe. Und während ihn die Thriller-Maschine zunächst gut geölt und wie auf Schienen dem Höhepunkt entgegenträgt, schaut er im Finale unter die weit geöffnete Motorhaube: Nun wird allzu offensichtlich, wie die Geschichte konstruiert ist, und das mindert den Spaß an der Reise.
Viel macht Martin im Detail wieder wett. Unter die Haut geht auf jeden Fall die Figur der Marion Thomas, die über den Tod ihrer Tochter gemüts- oder gar geisteskrank geworden ist, an ein simples Unglück als Erklärung weder glauben kann noch will und stattdessen Gott und die Welt verfolgt und bedrängt auf der Suche nach einem Schuldigen, den es nicht gibt – ein Kabinettstück echten psychologischen Thrills, auch wenn diese Marion Thomas mit der eigentlichen Geschichte streng genommen gar nichts zu tun hat. Sie existiert allein zu dem Zweck, die Figur des Mediums Cranmer stärker zu konturieren. Dabei kann dieser auch ohne rasendes Muttertier sehr gut bestehen. Ist er ein geltungssüchtiger Lügner, oder hat er doch einen Draht nach drüben? Auch als im Finale erklärt und erläutert wird, bis des Lesers Kopf raucht und die Geister in hellen Scharen zurück in die Twilight Zone fliehen, bleibt ein Rest Ungewissheit: ein kluger Schachzug der Autorin. Solche Offenheit hätte man sich öfter gewünscht; nicht weil Martin die Geistergläubigen dieser Welt so unbarmherzig zaust – denen kann eine Dosis gesunder Realitätssinn (oder ein tüchtiger Tritt in den Hintern) eigentlich niemals schaden -, sondern um der Geschichte willen.
So muss Julia Wallis Martin letztlich vor demselben Problem kapitulieren, das seit jeher auch Autoren größeren Kalibers zu schaffen macht: Das Grauen im Angesicht des Übernatürlichen ist schwierig heraufzubeschwören und ein flüchtiges Gut. Erklärungen lassen es dahinschmelzen wie Butter unter der Sonne. Doch der Leser einer fiktiven Geschichte wie der vom „Tanz mit dem ungebetenen Gast“ will nicht belehrt, sondern unterhalten werden. Daher ist er bereit zu billigen, was er in der Realität verlacht. Werden seine Illusionen gar zu unbarmherzig zerstört, stellt sich kein zufriedener „Aha!“-Effekt, sondern Enttäuschung ein – und genau das geschieht hier und fügt dem Roman unnötigen Schaden zu.
Fallon, Jennifer – Kind der Götter (Dämonenkind Band 2)
Nach den dramatischen Ereignissen Ende des [ersten Bandes 1328 ist R’shiel nun im Sanktuarium angekommen. Die Harshini nehmen sie sehr freundlich auf, und mit den Scharen von Dämonen, die ebenfalls dort leben, schließt R’shiel schnell Freundschaft. Sie lernt, das Band zwischen ihrem Harshini-Blut und den Dämonen zu verstehen und ihre magischen Kräfte zu gebrauchen. Am liebsten würde sie im Sanktuarium bleiben, letztlich jedoch stellt sich heraus, dass sie das auf Dauer nicht tun kann. Sie kehrt zurück zu ihren Freunden …
Tarjanian Tenragan weilt inzwischen an der Grenze zu Karien, zusammen mit Hochmeister Jenga, Schwester Mahina Cortanen und Damin Wulfskling aus Hythria. Und mit Frohinia Tenragan. Die Erste Schwester stellt inzwischen keine Bedrohung mehr dar. Dafür allerdings ein ernstes Problem. Denn das Konzil der Schwesternschaft steht bevor, und diese hat noch keinerlei Kenntnis von den Geschehnissen. Da taucht Obrist Garet Warner auf, geschickt vom Quorum, das sich über die neuen Befehle der Ersten Schwester etwas wundert.
Während die Hüter so gut es geht ihre Nordgrenze sichern, befindet sich die fardohnjische Prinzessin Adrina auf dem Weg nach Karien. Sie soll dort den karischen Kronprinzen Cratyn ehelichen, als sichtbares Zeichen eines Bündnisses zwischen Karien und Fardohnja. Denn ihr Vater gedenkt, den Krieg zwischen Karien und Medalon auszunutzen. Die Karier möchten, dass er Medalon im Süden angreift. König Hablets begehrlicher Blick jedoch richtet sich nach Hythria, mit dem er schon seit Jahrzehnten im Zwist liegt. Die Karier zu unterstützen, liegt ihm fern.
In Karien indes sammelt sich das Heer zum Angriff auf Medalon. Kaum ist der Kronprinz eingetroffen und vermählt, begibt er sich an die Front. Seine Gemahlin besteht darauf, ihn zu begleiten, allerdings keineswegs aus Anhänglichkeit! Karien indes beschränkt sich nicht darauf, Truppen an die Front zu schicken. Kariens Gottheit Xaphista persönlich mischt durch ihre Priester gehörig mit. Und er ist nicht der einzige Gott, der sich einmischt …
Der Aufenthalt im Sanktuarium hat R’shiel geholfen, ihr Harshini-Erbe zu akzeptieren, auch wenn sie die Anrede „Dämonenkind“ noch immer nicht leiden kann. Mit der Mission als solcher will sie noch immer nichts zu tun haben. Ihre Treue und ihr Einsatz gelten eindeutig ihren Freunden und Medalon. In allererster Linie will sie die Karier aus dem Land fern halten, dafür geht sie sogar das enorme Risiko ein, in die Zitadelle zurückzukehren. Sie will versuchen, das Schwesternkonzil zu beeinflussen. Sämtliche Warnungen Brakandarans und auch der Hinweis von Dacendaran, in der Zitadelle hielten sich Anhänger Xaphistas auf, können sie davon nicht abbringen.
In dem Maße, wie R’shiel an geistiger Reife gewinnt, verliert ihr Aufpasser Brakandaran seine Vorbehalte gegen sie. Als R’shiel in Gefahr gerät, und Zegarnald ihn daran hindert, ihr zu helfen, wird er schier tobsüchtig. Für die angeführten Gründe des Kriegsgottes hat er kaum mehr übrig als für die ihm von den Göttern aufgezwungene Gratwanderung zwischen der Aufgabe als R’shiels Beschützer und ihrem Henker.
Frohinia ist als Gegenspielerin weggefallen. Ihren Platz nimmt in ausgeweiteter Form der Hüter-Soldat Loclon ein, ein sadistisches, feiges Schwein, das R’shiel und Tarjanian bereits im ersten Band schwer zu schaffen machte. Beide hasst er mit Inbrunst, aber vor allem an R’shiel will er sich rächen, koste es, was es wolle. Trotz seiner Charaktermängel hat es dieser Kerl – wie so oft im wirklichen Leben – auf nicht nachvollziehbare Weise geschafft, zum Hauptmann befördert zu werden und nicht nur das! Anstatt in Grimmfelden zu verschimmeln, darf er jetzt Kadetten ausbilden. In der Zitadelle!
Abgesehen von diesen werden in „Kind der Götter“ zwei neue Charaktere wichtig, die im ersten Teil nur am Rande erwähnt wurden.
Damin Wulfskling, einst Tarjanians Gegenspieler an der Südgrenze, findet sich durch Brakandarans Eingreifen plötzlich als Verbündeter der Hüter gegen Karien wieder. Das ergibt sogar Sinn, denn es ist klar: Sollte Medalon unterliegen, kann nichts die Karier davon abhalten, als nächstes Hythria anzugreifen. Von der gegenseitigen Achtung, die beide Männer bereits im Kampf voreinander hatten, ist es nicht allzu weit bis zur Freundschaft, wenn man einen gemeinsamen Gegner hat. Gleich und gleich gesellt sich nun mal gern, und Damin ist tatsächlich von ähnlichem Schlag wie Tarjanian, wenn man davon absieht, dass er dazu neigt, ernste Situationen nicht ernst zu nehmen.
Adrina ist eine echte Prinzessin: verwöhnt, zickig und mit einer äußerst scharfen Zunge bewaffnet. Zimperlichkeit dagegen kann man ihr nicht nachsagen, auch nicht gegen sich selbst. Die Tatsache, dass sie aus Fardohnja stammt, wo die Menschen in ihrer Kleidung und ihrem Liebesleben eher freizügig sind und Frauen durchaus um ihre Meinung gefragt werden, muss zwangsläufig zu Konflikten mit den Kariern führen, wo Tugendhaftigkeit und Sittenstrenge groß geschrieben werden und das Los der Frauen sich durch Gehorsam gegenüber ihren Männern auszeichnet. So muss Adrina recht schnell erkennen, dass ihr Gemahl im Grunde zwar ein Waschlappen sein mag, sie aber aufgrund des karischen Ehegelübdes fast vollständig in der Hand hat. Doch Adrina wäre nicht die gefüchtetste Tochter ihres Vaters, wenn sie nicht dennoch Mittel und Wege fände, sich zu wehren.
Die Handlung verläuft diesmal weit ruhiger als beim letzten Mal, was durchaus kein Nachteil ist. Obwohl es mehrere Handlungstränge gibt, weil aus dem Blickwinkel mehrerer Personen erzählt wird, liegt die Gewichtung – nach Adrinas Ankunft dort – auf der Front, sprich auf Adrina und Damin, und auf der Zitadelle, sprich auf R’shiel und Loclon.
Der Handlungsteil an der Front ist dabei ausführlicher und überraschenderweise weniger spannend als der andere. Der Schwerpunkt liegt hier eher auf der Entwicklung der Beziehung zwischen Damin und Adrina, die sich zunächst spinnefeind sind.
Damin kannte Adrina zwar bisher nicht persönlich, dafür umso besser ihren Ruf als zänkische, herrische Furie. Er weiß, dass sie mit aller List und Tücke ums Entkommen kämpft, auch mit Verführung. Jenga hofft auf Informationen über die Karier, Damin allerdings ist überzeugt, dass zumindest die Hälfte ihrer Aussagen gelogen ist. Der karische Bengel, den sie bei sich hatte, offenbar ihr Page, hat ganz andere Gründe für ihr überraschendes Auftauchen in Medalon genannt als sie selbst.
Adrina ihrerseits ist von Damin Wulfskling äußerst überrascht. Sie hat ihn für einen läppischen, rückgratlosen Weichling gehalten, wie sein Onkel, den sie kennt, einer ist. Stattdessen trifft sie auf einen abgehärteten, derben Krieger, den sie als höchst ungehobelt empfindet. Viel lieber würde sie sich mit Tarjanian abgeben, sie hält ihn für leichter verführbar. Stattdessen hat sie hauptsächlich mit Damin zu tun, der allerdings eine außerordentlich tiefe Abneigung gegen sie hegt.
Der Schlagabtausch zwischen diesen beiden ist durchaus amüsant, auch wenn es letztlich doch kommt, wie es kommen muss …
Ansonsten kommt in diesem Strang nur eine einzige Schlacht vor, die man allerdings kaum als solche bezeichnen kann und deren Ausgang von vornherein feststeht. Hauptsächlich zeichnen sich die Kriegsparteien eher durch Nichtstun aus. Die Medaloner können nur warten, denn die Schwesternschaft lehnt den Krieg eigentlich ab, und ein Angriff käme für sie nie in Frage. Die Karier haben da keine Bedenken, umso erstaunlicher ist die Sorglosigkeit, mit der die Medaloner sich nach der ersten Schlacht besaufen oder den Gründungsfesttag feiern!
Das lange Stillhalten der Karier kann nur bedeuten, dass sie auf etwas Bestimmtes warten. Allerdings steht der Winter vor der Tür, für die schwer gepanzerten Ordensritter ein ernstes Hemmnis. Und selbst Jenga wundert sich irgendwann, dass die Karier sich seit ihrem ersten Angriff so ruhig verhalten. Ich dagegen wunderte mich, warum er nicht versucht, es rauszufinden. Spionage kann ihm angesichts der Intrigen in der Zitadelle doch kaum fremd gewesen sein! Diese Art und Weise, direkt ins Verhängnis zu laufen, empfand ich als höchst unbefriedigend.
Zumal im anderen Erzählstrang, der sich um R’shiel und die Zitadelle dreht, das Verhängnis schon vor R’shiels Aufbruch absehbar ist, was an der Front aber natürlich niemand weiß. Obwohl dem Leser frühzeitig klar ist, dass R’shiel in eine Falle läuft, weiß die Autorin den Leser durch kleine Winkelzüge bei der Stange zu halten, die dem scheinbar Unabwendbaren stets aufs Neue eine andere Richtung geben. Letztlich erstaunt es allerdings doch ein wenig, wie leicht es der Gefahr gelang, in den Palast der Schwestern einzudringen! In Anbetracht der Tatsache, dass Xaphista bereits zweihundert Jahre zuvor nach der Herrschaft über den gesamten Kontinent lechzte, sollte man meinen, dass er so etwas schon viel früher hätte versuchen können anstatt auf die Reife eines Dämonenkindes zu warten, das eine Bedrohung für ihn darstellt.
Der zweite Band hat mir besser gefallen als der erste. Jennifer Fallon ist weniger auf den Teil um Magie und Götter eingegangen, als ich es erwartet hatte, aber vielleicht kommt das noch, wenn es ins Finale geht. Loclons stumpfe Brutalität ist leider kein gleichwertiger Ersatz für Frohinias geschliffene Intelligenz, dafür ist Adrinas Charakter ein echter Gewinn. R’shiels Entwicklung ist gut dargestellt, und obwohl im Nachfolger weit weniger Action herrscht als im Vorgänger, fand ich ihn nicht weniger spannend. Vor allem reduzierte sich das Fliehen und Gefangengenommenwerden diesmal auf den Endteil, sodass das ermüdende Gefühl endloser Wiederholung ausblieb.
Die Ausdrucksweise der Autorin ist, was Stellung von Nebensätzen und Hauptsätzen angeht, manchmal etwas eigentümlich, aber das liegt vielleicht auch an der Übersetzung. Wirklich störend wirkt es nicht. Das Lektorat dagegen hat sich in keiner Weise gebessert! So heißt der König der Harshini – im ersten Band noch Korandellen genannt – jetzt plötzlich Korandellan! Und gelegentlich hat man den Eindruck, ein Satz wurde formuliert, dann teilweise umformuliert, aber die ursprüngliche Formulierung wurde vergessen zu streichen! Wer auch immer so was verbockt, sollte nachsitzen!
Jennifer Fallon stammt aus einer großen Familie mit zwölf Geschwistern. Sie hat in den verschiedensten Jobs gearbeitet, unter anderem als Kaufhausdetektivin, Sporttrainerin und in der Jugendarbeit. Letzteres scheint ihr immer noch nachzuhängen – unter ihrem Dach leben außer drei eigenen Kindern einige obdachlose Jugendliche als Pflegekinder. Schreiben tut sie nebenher. Die Trilogie |DemonChild| war ihre erste Veröffentlichung und gleich oben auf den Beststellerlisten. [„Kind der Magie“ 1328 und „Kind der Götter“ sind bereits auf Deutsch erschienen, auf den dritte Band „Kind des Schicksals“ müssen die Leser noch bis zum Herbst warten.
http://www.jenniferfallon.com/
_Jennifer Fallon bei |Buchwurm.info|:_
[„Kind der Magie“ 1328 (DemonChild Band 1)
[„Kind der Götter“ 1332 (DemonChild Band 2)
[„Kind des Schicksals“ 1985 (DemonChild Band 3)
[„Erbin des Throns“ 2877
Michel Parry (Hg.) – Raritäten aus des Teufels Küche
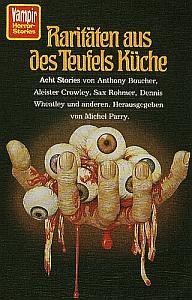
Michel Parry (Hg.) – Raritäten aus des Teufels Küche weiterlesen
Jungstedt, Mari – Den du nicht siehst
_Sommer in Gotland_
Helena Hillerström und ihr Lebensgefährte Per Bergdal machen Kurzurlaub in ihrem Ferienhaus auf Gotland und feiern mit Freunden eine kleine Party, zu der auch Helenas guter Freund Kristian Nordström eingeladen ist. Als sie ausgelassen mit Kristian zu tanzen beginnt, entreißt Per seine Freundin aus Kristians Armen und zerrt sie auf die Veranda. Dort schlägt er sie und beendet damit die zunächst so heitere Party. Als Helena am nächsten Morgen vor Per erwacht, geht sie mit ihrem Labradorhund Spencer am Strand spazieren. Im Nebel sieht sie nicht, wie sich ihr Mörder langsam nähert … Kurz darauf findet ein Spaziergänger ihre Leiche im Wald.
Nun beginnen für Anders Knutas und seine Kollegen von der Gotländer Polizei die Ermittlungsarbeiten. Zunächst wird Per Bergdal als Tatverdächtiger festgenommen, auch wenn Knutas an dessen Unschuld glaubt. Doch als die zweite Frauenleiche entdeckt wird, während Bergdal in Untersuchungshaft sitzt, muss von einem Serientäter ausgegangen werden, der sich noch in Freiheit aufhält.
Der Journalist Johann Berg ist zusammen mit seinem Kameramann Peter Bylund nach Gotland gereist, um vor Ort über die Morde zu berichten. Dabei lernt er Emma Winarve kennen, eine gute Freundin Helenas, die noch unter dem Verlust ihrer Freundin leidet. Während Johann sich Hals über Kopf in Emma verliebt, beginnt es in deren Ehe zu kriseln.
Als die dritte Frau brutal ermordet wird, gerät Knutas immer mehr unter Druck, die Touristensaison auf der malerischen Ferieninsel steht bevor, doch wächst die Angst unter der Bevölkerung, sodass die Urlauber auszubleiben drohen …
_Eine Schnitzeljagd_
Mit „Den du nicht siehst“ hat Mari Jungstedt einen spannenden und temporeichen Debütroman vorgelegt, der auf vielversprechende Fortsetzungen hoffen lässt. Ähnlich wie ihr schwedischer Kriminalautorkollege Henning Mankell verschwendet auch Jungstedt anfangs keine Zeit, kurz stellt sie das erste Opfer vor, um dann auch sogleich den Mörder zuschlagen zu lassen. So gibt es im gesamten Buch keine einzige Durststrecke, stetig baut Jungstedt mehr Spannung auf, indem sie ihren Lesern nach und nach immer mehr Details über den Mörder präsentiert, die zum Miträtseln animieren und dem Leser tatsächlich schon früh die nötigen Informationen zuspielen, um den Mörder etwa auf der Hälfte des Buches zu entlarven. An dieser Stelle merkt man dann auch, dass die Autorin ihre Schnitzeljagd noch nicht so ausgefeilt inszeniert wie erfahrene Kriminalautoren, die ihre Leser gekonnt an der Nase herumführen können.
In diesem Roman sind es also nicht die ganz subtilen Hinweise, die den Täter erahnen lassen, sondern konkrete Informationen, die schnell in die richtige Richtung weisen. Auch streut Jungstedt zwischendurch kursiv gedruckte Abschnitte ein, die uns in die Gedanken des Serienmörders hineinversetzen und seine Motive und Teile seiner Vergangenheit erkennen lassen. Während Anders Knutas und seine Kollegen also lange im Unklaren gelassen werden über die Verbindungen zwischen den Opfern, ahnt der Leser bereits den Zusammenhang und ist dem Ermittlungsstand der Polizei dadurch meist weit voraus. Knutas tappt lange Zeit im Dunkeln, da die Polizei nur wenige Spuren finden kann und dem Tatmotiv und Mörder kaum auf die Schliche kommt. An mancher Stelle hätte ich mir diese Schnitzeljagd etwas raffinierter gewünscht, denn den ermittelnden Beamten werden zu wenige Beweisstücke geliefert, um wirklich intensiv nach dem Mörder fahnden zu können.
Den Spannungsbogen lässt die Autorin geschickt ansteigen, denn nach dem ersten Mord werden zunächst einige interessant erscheinende Personen vorgestellt und ein paar falsche Fährten ausgelegt, bevor es dann auch bald zum zweiten Mord kommt. Mari Jungstedt verschwendet wirklich keine Zeit, schreibt nur kurze Kapitel und lässt genau im richtigen Moment den nächsten Mord geschehen, um ihre Leser so sehr an das Buch zu fesseln, dass einem beim Lesen die Finger kribbeln und das Herz zu rasen beginnt. Die Autorin lässt eine dermaßen spannungsgeladene und düstere Stimmung aufkommen, dass man gebannt ist von der Erzählung und das drohende Unglück spüren kann.
_Aufkeimende Liebe_
Umrahmt wird die spannende Kriminalgeschichte von dem Kennenlernen zwischen Emma Winarve und Johann Berg, die sich im Laufe der Ermittlungen und von Johanns Nachforschungen für seine Fernsehberichte begegnen und sogleich ihre gegenseitige Anziehung spüren. Doch Emma ist verheiratet und Mutter von zwei kleinen Kindern, sodass ihr schlechtes Gewissen sie zunächst von Johann fernhält und an ihrer Ehe festhalten lässt. Aber gerade die schrecklichen Ereignisse sind es, bei denen ihr fürsorglicher Ehemann Olle ihr nicht genügend Rückhalt geben kann, sodass Emma sich in Johanns Arme flüchtet. Mari Jungstedt nimmt sich viel Zeit, um diese beiden Personen, ihre Gedanken und Gefühle vorzustellen.
Auf der einen Seite haben wir den ehrgeizigen Journalisten Johann Berg, der sich seinen geheimen Informanten zunutze macht, um als Erster brisante Details veröffentlichen zu können, die die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen gerne zurückhalten würde. Johann handelt hier teilweise sehr rücksichtslos und ist nur auf seine eigene Karriere bedacht, die er egoistisch vorantreiben will. Erst als er Emma kennen lernt und sich in sie verliebt, zeigt er seine menschlichen Charakterzüge. Auf der anderen Seite haben wir die einst so glückliche Emma Winarve, der nach dem Mord an ihrer besten Freundin zum ersten Mal bewusst zu werden scheint, dass ihre Ehe ihre besten Tage offensichtlich schon gesehen hat. Erst die tragischen Ereignisse und die Begegnung mit Johann rütteln sie auf und lassen sie nachdenklich werden; Jungstedt beschreibt gekonnt Emmas zwiespältige Gefühle und lässt bis zum Schluss offen, für welchen Mann Emma sich entscheiden wird.
Gegen Johanns und Emmas detailreiche Vorstellungen rückt Anders Knutas fast schon in den Hintergrund, obwohl er die Ermittlungen leitet und somit eine zentrale Stellung einnimmt. Doch auch Knutas erhält seinen Raum in dieser Erzählung, er wird uns sehr realistisch präsentiert, mit einem ausgefüllten Privatleben, einer verständnisvollen Ehefrau und mit aufkeimenden Zweifeln und einer Verzweiflung angesichts der schrecklichen Geschehnisse auf der idyllischen Ferieninsel. Knutas ist ein Hauptkommissar, der trotz seiner Arbeit immer Mensch geblieben ist. In seiner Darstellung gefällt Knutas gut, sodass ich gern mehr über ihn lesen möchte.
In ihren Ausführungen offenbart Mari Jungstedt ein Talent für Personenbeschreibungen und die realistische Wiedergabe menschlicher Gefühle. Besonders eindrucksvoll gelingen ihr die Schilderungen von Emmas Trauer, die sich in vielen Passagen wiederfindet, beispielsweise in dieser: |“Im Moment musste sie alle Kraft aufwenden, um durchzuhalten. Um nicht zusammenzubrechen. Sie musste sich um die Kinder kümmern. Um Sara und Filip. […] Aber wie sollte Emma das alles schaffen? Natürlich würde der Schock irgendwann abklingen. Würde die Trauer weniger greifbar sein, aber sie vermisste Helena so sehr, dass es wehtat. Und damit würde sie nicht so schnell fertig werden. Und wie sollte sie verarbeiten, was hier passiert war? Dass ihre allerbeste Freundin auf eine Weise ermordet worden war, die sonst nur in Filmen vorkam?“| In diesen Momenten kann der Leser Emmas Trauer und Verzweiflung praktisch selbst mitfühlen, man möchte Emma in den Arm nehmen und trösten, so sehr lässt Jungstedt uns trotz der an sich so schnörkellosen Sprache Anteil haben an den Gefühlen ihrer Protagonisten.
_Ein beachtliches Debüt_
„Den du nicht siehst“ ist ein temporeicher Kriminalroman, der seine Leser gekonnt fesseln kann, sodass man nicht umhin kommt, das Buch so schnell wie nur irgend möglich durchzulesen. Mit fast zittrigen Händen hält man den Roman, während es einem kalt den Rücken herunterläuft, weil man das drohende Unglück fast schon körperlich spürt. Mari Jungstedt weiß ihre Leser mitzureißen und zu unterhalten, sie baut eine bedrohliche Atmosphäre auf und entwickelt glaubwürdige Charaktere, mit denen man fühlt und über die man mehr lesen möchte. Die Schnitzeljagd ist nicht ganz so ausgefeilt, wie man sich das gewünscht hätte; leider schafft Jungstedt es nicht, den passionierten Krimileser an der Nase herumzuführen, denn mit seinem ersten Tipp kann man den Mörder korrekt entlarven. Dennoch bleibt „Den du nicht siehst“ ein beachtlicher Erstlingsroman, der auf mehr hoffen lässt.
John MacLachlan Gray – Der menschliche Dämon
London ist 1852 ein Schmelztiegel unzähliger Menschen, die meist mehr schlecht als recht ihr Leben fristen. Unter ihnen: Edmund Whitty, Sonderberichterstatter des „Falcon“, ein überarbeiteter, unterbezahlter, verschuldeter Zeilenschinder, der Tragödien, spektakuläre Unfälle und Verbrechen publizistisch ausschlachtet. Die ständige Jagd nach der nächsten Sensation hat ihn zermürbt, den Katzenjammer betäubt er mit Alkohol und Drogen, Schuldeneintreiber jagen ihn.
Lange hat der Frauenmörder „Chokee Bill“ die finsteren Gassen der Slums unsicher gemacht. Jetzt wartet er in der Todeszelle auf den Henker. Allerdings leugnet er, ein Serienmörder zu sein. Whitty besucht Bill – eigentlich William Ryan –, hört seine Geschichte und wird nachdenklich. Zwar glaubt er dem Mann nicht unbedingt, aber er braucht dringend eine neue Story. John MacLachlan Gray – Der menschliche Dämon weiterlesen
Brennan, Herbie – Purpurkaiser, Der (Faerie Wars 2)
In [„Das Elfenportal“ 313 hat der junge Henry tatkräftig dabei mitgeholfen, das Elfenreich, dessen Kronprinz er zufällig im Garten gefunden hat, vor einem Bürgerkrieg zu bewahren.
Jetzt ist er auf dem Weg zu Mr. Fogarty’s Haus. Mr. Fogarty hat ihn gebeten, dort nach dem Rechten zu sehen und seinen Kater Hodge zu füttern. Denn Mr. Fogarty ist nicht mehr allzu oft zu Hause, seit er Torhüter im Kaiserpalast des Elfenreiches ist. An diesem Tag jedoch ist er zu Henrys Überraschung da, unter anderem, um ihm mitzuteilen, dass er, Henry, zu Kronprinz Pyrgus‘ Krönung eingeladen ist. Dessen Vater, der Purpurkaiser Apatura Iris, war nämlich bei Henrys letztem Besuch im Elfenreich ermordet worden.
Selbstverständlich nimmt Henry die Einladung begeistert an. Seine Begeisterung wird allerdings schwer gedämpft, als Pyrgus‘ Schwester Holly Blue auftaucht und ihm mitteilt, dass jemand vorhat, ein Attentat auf Pyrgus zu verüben. Während Mr. Fogarty Blue zurück ins Elfenreich folgt, muss Henry erst noch nach Hause und dafür sorgen, dass seine Mutter und seine Schwester ihn nicht vermissen, solange er fort ist. Das ist weiter kein Problem, nur ist leider der Portalöffner, den Mr. Fogarty gebaut hat, aus seinem Schrank verschwunden!
Während Henry in Mr. Fogartys Haus zurückkehrt und dort haareraufend versucht, so gut wie möglich einen neuen Portalöffner nachzubauen, überstürzen sich im Purpurpalast die Ereignisse: Lord Hearstreak strebt immer noch nach der Macht im Reich. Es ist ihm gelungen, an Pyrgus Stelle dessen kleinen Bruder Comma als designierten Purpurkaiser durchzusetzen und, da Comma noch nicht mündig ist, sich selbst als Reichsverweser! Pyrgus, Blue und Mr. Fogarty werden in die Verbannung geschickt. Als Henry endlich im Purpurpalast eintrifft, haben einige äußerst merkwürdige Veränderungen stattgefunden …
Vorweg gesagt: Auch die Fortsetzung des „Elfenportals“ ist eine höchst amüsante Lektüre! Der Leser begegnet sämtlichen Figuren wieder, die bereits den ersten Band so bunt und lebendig machten.
Brimstone, der Leimfabrikant, ist auf der Flucht vor dem Dämonenfürst Beleth bei einer grässlichen alten Vettel untergetaucht, die ihn ständig mit Knochensuppe füttert! Nicht ohne Hintergedanken, wie sich zeigt, denn eines Tages macht sie Brimstone das erstaunliche Angebot, ihn mit in ihr idyllisches, kleines Landhaus zu nehmen und nur noch die besten Speisen für ihn zu kochen, wenn er einwilligt, sie zu heiraten. Brimstone zögert, stimmt letztlich aber zu, mit dem Hintergedanken, sie danach so bald wie möglich umzubringen. Die Hochzeitszeremonie ist kaum vorrüber, da beginnt zwischen den beiden ein Wettlauf, wer wen zuerst umbringt!
Brimstones Teilhaber Chalkhill, den Prinzessin Blue als Spion Hearstreaks entlarvt hat, sitzt im Kittchen. Hearstreak lässt ihn dort schnurstracks herausholen, denn er will, dass Chalkhill Pyrgus für ihn tötet, und zwar während der Krönungsfeierlichkeiten. Chalkhill wird eine Tarnung verpasst, die allerdings nur mäßig funktioniert, weil Chalkhill ein schrecklicher Trampel ist und sich einfach nicht richtig bewegen kann. Ein Wurm soll ihn unterstützen, der in seinem Körper platziert wird. Chalkhill stimmt nur ungern zu, und kaum sitzt der Wurm in ihm drin, erfährt er auch schon, dass er ihn gar nicht mehr braucht, weil die Sache abgeblasen wurde. Fortan läuft Chalkhill mit einem unerwünschten Gast in seinem Hinterteil herum, der ihm ununterbrochen das Hirn vollquasselt. Aber es kommt noch schlimmer!
Zusätzlich zu den altbekannten Figuren tauchen auch neue auf. Die Seidenherrinnen, die den Auftrag hatten, Holly Blues Garderobe für die Krönungsfeier herzustellen, erweisen sich unvermutet als nützliche Verbündete, und die grün gekleideten Krieger, die Pyrgus, Blue und Mr. Fogarty auf dem Weg ins Exil angreifen, stellen sich als Waldelfen heraus. Das bislang für rückständig und ärmlich gehaltene Volk entpuppt sich als hochtechnisiert, diszipliniert und schlagkräftig.
Mit ihnen gehen eine Menge neuer Ideen einher: die der besonderen Seide, die die Seidenherrinnen verarbeiten, und ihre verschiedenen Wirkungen, ein Obsidian-Labyrinth, eine Menge Magie wie schwebende Flöße zur Fortbewegung, Verschleierungszauber und vor allem das Durchschreiten von Wänden, aber auch überdurchschnittliche Waffen! Folglich wundert es nicht, dass, während die Unterstützung der Seidenherrinnen eher passiver Natur ist, die Königin der Waldelfen vor aktivem Eingreifen durchaus nicht zurückschreckt.
So kommt es, dass wieder mal eine Menge Leute kräftig damit beschäftigt sind, ihr eigenes Netz zu spinnen, und sich dabei ständig in die Quere kommen! Hearstreak will Pyrgus aus dem Weg räumen, Pyrgus will Hearstreak Hochverrat nachweisen und ihm den gestohlenen und missbrauchten Leichnam seines Vaters wieder abnehmen, Chalkhill will Hearstreak ein Schnippchen schlagen und Purpurkaiser werden, Brimstone will seinen Hals vor Beleth retten, Beleth will sich an Hearstreak rächen, der ihn nach der Panne mit der Bombe („Das Elfenportal“) hat hängen lassen, und die Königin der Waldelfen will ihren Wald von Dunkelelfen und Dämonen säubern.
Klingt verwirrend, ist es aber gar nicht! Die einzelnen Handlungsstränge wechseln ziemlich oft, doch sind die Erzählabschnitte äußerst kurz gehalten, sodass nicht die Gefahr besteht, bis zur Fortführung des Strangs vergessen zu haben, wie er geendet hat. Der Plot ist nicht übermäßig kompliziert, der scheinbare Widerspruch zwischen Attentat und Pyrgus‘ Absetzung löst sich recht bald auf. Die Jagd und ihre Verwicklungen jedoch bieten so viel Abwechslung, dass keine Langeweile aufkommt. Die überraschende Enthüllung, wer der Dieb des kaiserlichen Leichnams war, tat ein Übriges. Insgesamt höchst angenehm zu lesen, auch wegen des wohltuend guten Lektorats, das nur einen einzigen Fehler durchließ.
„Der Purpurkaiser“ ist eine würdige Fortsetzung des „Elfenportals“. Henrys Welt tritt diesmal zugunsten des Elfenreichs fast vollständig in den Hintergrund, was ich fast ein wenig schade fand. Die Spannungen zwischen den beiden so verschiedenen Welten, die im ersten Band für einiges Amüsement sorgten, kommen nur in dem kurzen Teil vor, wo Henry und Blue versuchen, Mr. Fogarty aus einer Polizeistation herauszuholen. Trotzdem war ich während der gesamten Lektüre dauernd am Schmunzeln und konnte so manches Mal auch lauthals lachen. Die Tatsache, dass Pyrgus ganz offensichtlich für die Prinzessin der Waldelfen schwärmt, sowie Hearstreaks unverminderte Ambitionen, an die Macht zu kommen, lassen darauf hoffen, dass Henry noch weitere Abenteuer im Elfenreich zu bestehen haben wird. Ich bin jetzt schon neugierig.
Herbie Brennan lebt und arbeitet in Irland, und das sehr fleißig. Er hat Unmengen von Büchern geschrieben, von Historik über Psychologie und Esoterik bis Fantasy, von Romanen über Kurzgeschichten bis zu Software, für Erwachsene ebenso wie für Kinder und Jugendliche. Außerdem arbeitet er fürs Radio.
http://www.herbiebrennan.com
http://www.faeriewars.com
http://www.dtv.de/special__brennan/elfen__index.htm
Jewgenij Samjatin – Wir
1920 schreibt der Russe Jewgenij Samjatin (auch: Evgenij Zamjatin) seine Antiutopie (auch negative Utopie oder Dystopie genant) „Wir“ und nimmt damit in fast prophetischer Weise die Mechanismen der kommunistischen Diktatur in den sozialistischen Ländern vorweg.
Samjatin hatte seine eigene, von der offiziellen kommunistischen Linie abweichende Vorstellung von der Aufgabe eines Literaten. Dieser sollte zeitkritisch sein und über einen einmal erreichten Zustand hinausdenken können, anstatt ihn zu bestätigen. Er forderte die Eigenverantwortung des Künstlers bei der kritischen Darstellung gesellschaftlichen Lebens. Die Emanzipation eines Menschen und der Gesellschaft würde nur durch Infragestellung und Widerspruch erreicht werden.
DBC Pierre – Jesus von Texas
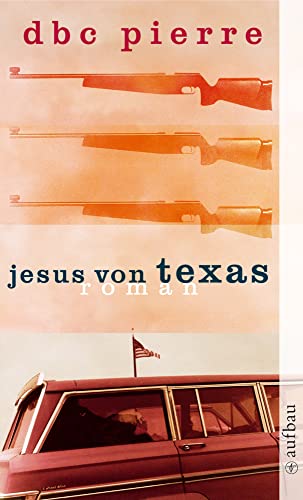
_Shit happened_
Hearn, Lian – Glanz des Mondes, Der (Der Clan der Otori Band 3)
Da ist er nun auch schon, der letzte Band um den Otori-Krieger Takeo von Lian Hearn. Nach dem beeindruckenden ersten Buch „Das Schwert in der Stille“ und dem ebenbürtigen, spannungsvollen Nachfolger [„Der Pfad im Schnee“ 968 findet die dramatische Fantasy-Geschichte aus dem mittelalterlichen Asien hier ihr Ende, und wie schon bei den Vorgänger-Bänden lässt Hearn die Tragik der gesamten Handlung auch dieses Mal nicht außen vor. Im Gegenteil; es geht um ein finales Gefecht, um die entscheidende Schlacht, aber auch um die große, endlich vereinte Liebe mit all ihren Emotionen, aber eben auch mit all ihrer Trauer.
_Story:_
Endlich sind Takeo und Kaede vereint und können ihre lang anhaltende Liebe mit ihrer Hochzeit besiegeln. Doch in den Genuss ihres Familienglücks kommen sie nur für kurze Zeit, denn der Clan, der gegen diese Vermählung war, lässt ihnen keine ruhige Minute. Die Otori-Lords erkennen den Herrschaftsanspruch des jungen Kriegers nicht an und bereiten sich daher auf den Kampf gegen den Träger des legendären Schwertes Jato vor. Takeo stellt sich diesem Kampf und versammelt seine zahlreichen Anhänger um sich. Verbündet ziehen die Männer in den Kampf: für Gerechtigkeit, für Frieden im Land der Lords, für das Ende der Schreckensherrschaft des Clans und schlussendlich für den inneren Seelenfrieden, für die Liebe ihres Anführers zu der hübschen Gemahlin Kaede.
Doch bevor es überhaupt zur endgültigen Schlacht kommen kann, müssen die Krieger auf ihrem Weg in das von Feinden belagerte Land der verstorbenen Lady Maruyama einige harte Prüfungen bestehen und sich gegen die am Wegesrand lauernden Gefahren durchsetzen. Stets muss Takeo sich vor seinen Gegnern fürchten, denn die Schergen des Clans wollen nur eines: seinen sofortigen Tod und das Ende seines Freiheitskampfes.
Die Liebe zwischen Kaede und Takeo wird dabei erneut auf eine harte Probe gestellt, denn ihre Wege trennen sich sehr bald wieder. Doch ihre feste Entschlossenheit, ihr Mut, sich gegen das Böse durchzusetzen und damit auch für das gleiche Ziel zu kämpfen, bleibt ihr dauernder Antrieb, sich ihrer Verpflichtung zu stellen. Und nur so kann Takeos Prophezeihung, dass sich das Land unter ihm von Meer zu Meer in Frieden erstrecken wird, in Erfüllung gehen. Doch bis dahin haben der junge Kämpfer und seine Gattin noch einen langen, steinigen Weg zu bewältigen …
_Eindrücke:_
Wie nicht anders zu erwarten war, so ist auch „Der Glanz des Mondes“ ein unheimlich faszinierendes Werk geworden und in diesem Maße dann auch ein mehr als würdiger Abschluss dieser Trilogie. Trotzdem kann es im direkten Vergleich zu den beiden anderen Bänden nicht ganz mithalten, weil Hearn in diesem letzten, düstersten Teil nicht so ausschmückend und weitschweifig erzählt, wie man dies bislang gewohnt war. Es passiert in kürzester Zeit eine ganze Menge, und besonders im mittleren Teil des Buches, wo Hearn das Erzähltempo mächtig anzieht, fehlt ein wenig diese stille Romantik des ersten Teils, die ich aus heutiger Sicht immer noch am meisten bewundere.
Nichtsdestotrotz ist auch die Geschichte des dritten Buches einfach nur toll. Lian Hearn glänzt durch eine weit reichende Phantasie, Ideenreichtum im Bezug auf die verschiedenen Wendungen innerhalb der Handlung und einen erneut wunderschönen, wenngleich auch nicht mehr so detailverliebten Stil, der besonders den heimlichen Romantikern unter den Lesern sehr zusagen sollte.
Das Schöne dabei ist letztendlich, dass man nie so richtig ahnt, wie die Geschichte letztlich enden könnte, denn dort wo man zunächst denkt, die Auflösung des Ganzen zu kennen, ändert sich urplötzlich der Handlungsstrang und man steht wieder |tabula rasa| da. So bleibt das Buch immerfort auf dem Höhepunkt, und in dem Moment, in dem die finale Klimax abklingt, hat man auch schon die letzte Seite erreicht. Ist das nicht eine traumhafte Bestätigung für die Verfasserin?
Natürlich muss man die ersten beiden Otori-Bücher gelesen haben, um die Geschichte in ganzem Umfang zu verstehen, aber wenn dies bereits geschehen ist, wird man sich schnell in diesem Buch zurechtfinden und sich erneut in die Geschichte um Takeo und Kaede verlieben. Trotz ein paar hektischer Momente ist auch „Der Glanz des Mondes“ ein Traum von einem Buch und im Dreierpack mit den anderen beiden Bänden mein persönlicher Lesetipp im Bereich der nicht-standesgemäßen Fantasy.
Als Letztes noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die bereits länger vom Otori-Fieber gepackt wurden: Derzeit wird der erste Teil der Reihe in den Staaten verfilmt. Die Geschichte ist also doch noch nicht zu Ende …
http://www.otori.de/