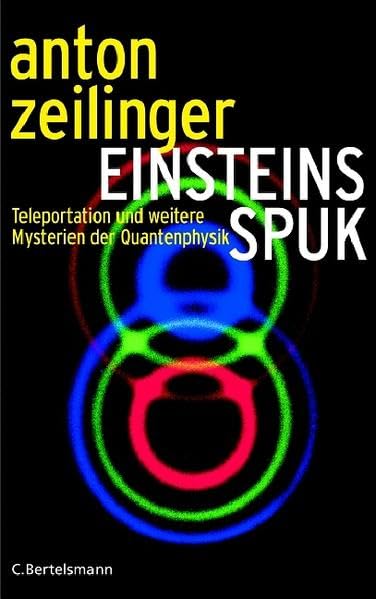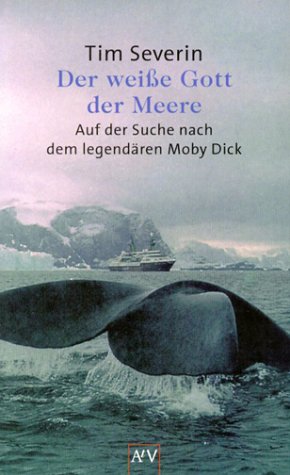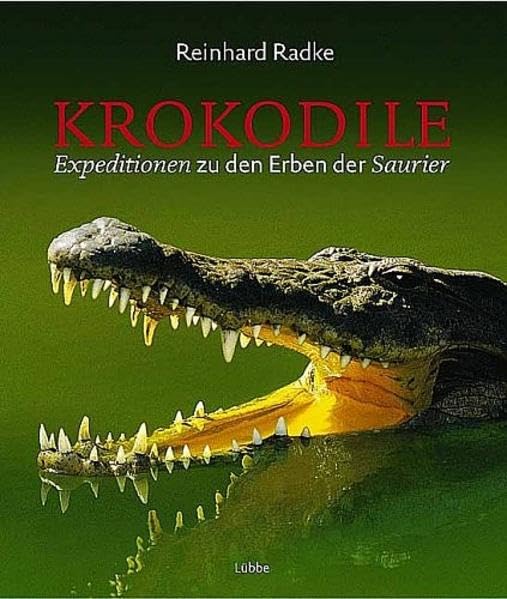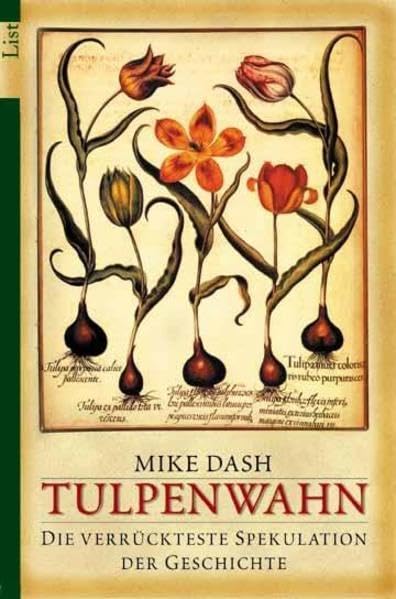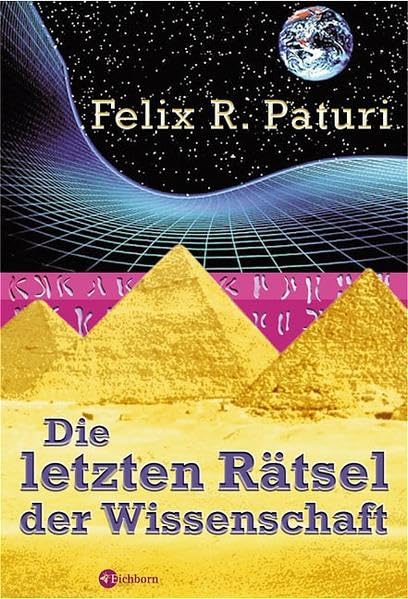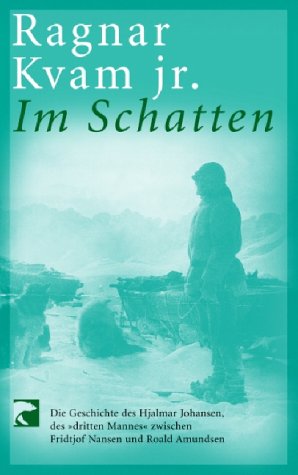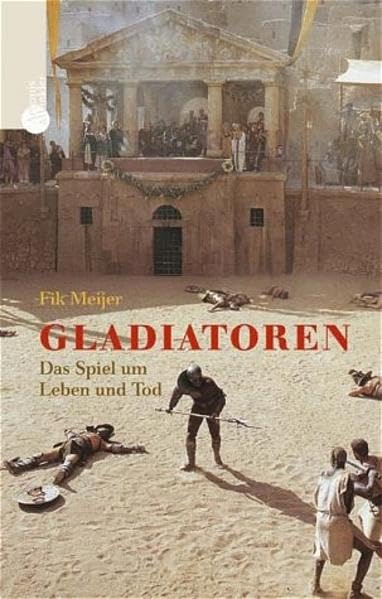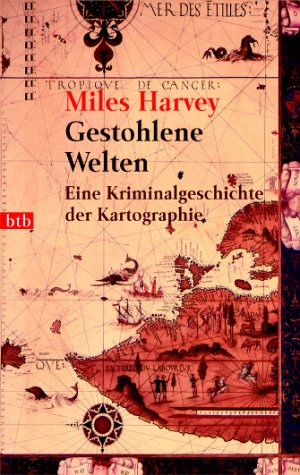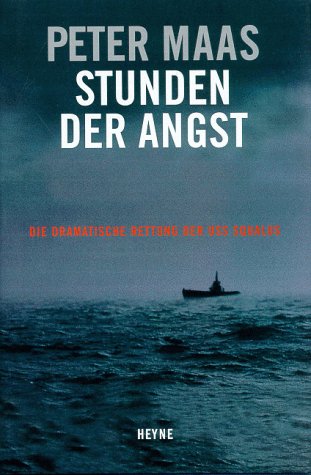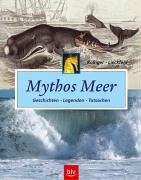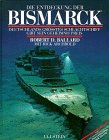Zu Beginn des 20. Jahrhunderts scheint der Mensch erstmals und endlich in der Lage zu sein, die Welt zu verstehen und nach seinem Willen zu formen. Details machen ihm noch zu schaffen, aber auch das wird sich binnen kurzer Zeit gewiss ändern. Der berechtigte Stolz darauf, was Technik und Wissenschaft in den geschaffen haben, geht freilich leicht in Hybris über. Diese Lektion muss die aufstrebende Weltmacht USA im Sommer des Jahres 1900 auf grausame Weise lernen.
Vielleicht ist gesunder Menschenverstand zu viel verlangt für ein nationalstolzes Land, das sowohl energisch als auch erfolgreich daran arbeitet, politisch und militärisch seine Konkurrenten auszuschalten. Gerade erst haben die Vereinigten Staaten einen Krieg mit Spanien vom Zaun gebrochen, mit geradezu spielerischer Leichtigkeit gewonnen und die karibische Kolonie Kuba in ihren Besitz genommen.
Isaac Cline ist der perfekte Repräsentant der neuen Zeit. Der junge Mann stammt aus relativ einfachen Verhältnissen, doch mit seinem messerscharfen Verstand, seiner nie versiegenden Energie und seinem unerhörten Arbeitseifer gelingt ihm die Realisierung des „Amerikanischen Traums“, der ihn binnen weniger Jahre zu Reichtum, Anerkennung und gesellschaftlichem Aufstieg führt. Clines Interesse gilt dem Wetter und vor allem der Möglichkeit, es vorauszusagen. Um 1900 beginnt sich die Meteorologie von einer Schwarzen Kunst in eine Wissenschaft zu verwandeln und in ein Politikum: Unter der Flagge der Vereinigten Staaten fährt um die Jahrhundertwende eine der mächtigsten Flotten der Welt.
Wissen ist tatsächlich Macht
Die größte Gefahr droht diesen Schiffen nicht von ihren Feinden, sondern von unvorhergesehenen Stürmen auf hoher See. Besonders in der Karibik, dem gerade gewonnenen Vorhof der jungen Großmacht, gehen auf diese Weise jährlich zahlreiche Schiffe und ihre Besatzungen buchstäblich zugrunde. Die besonderen Wetterverhältnisse führen über dem Golf von Mexiko in jedem Sommer zur Entstehung von Hurrikans, gewaltigen tropischen Wirbelstürme, die von ihrer Wiege, dem afrikanischen Kontinent, über den Atlantik kommend, entlang der Küstenlinie des nördlichen Südamerikas und Mittelamerikas eine Kurve nach Nordosten über die USA schlagen und dabei alles verwüsten, was ihren Weg kreuzt.
Zu den besonders gefährdeten Bundesstaaten gehört Texas, das dem Europäer eher durch Prärien und kleine Städte des Wilden Westens präsent ist, tatsächlich jedoch über eine lange Küste zum Golf von Mexiko verfügt. Hier liegen die beiden Städte Houston und Galveston, die um 1900 darum wetteifern, zur Hauptstadt ihres Staates zu werden. Die Waagschalen neigen sich allmählich zu Gunsten Galvestons. Das US Wetteramt siedelt seinen Chef Meteorologen für Texas hier an, da Galveston einen Logenplatz auf die labile Wetterlage der westindischen Region bietet.
Seit gut einem Jahrzehnt steht Isaac Cline der angesehenen Wetterstation in Galveston vor. Er gehört zur Prominenz der Stadt, hat nebenbei Medizin studiert, schreibt Artikel über seine Arbeit, gibt Vorlesungen und hat sogar die Zeit gefunden, eine Familie zu gründen. Alles ist planmäßig gelaufen im Leben Clines, der im Jahre 1900 auf der Höhe seiner Karriere steht. Er glaubt alles über das Wetter zu wissen, was die moderne Meteorologie, als deren hervorragender Vertreter er sich ohne falsche Bescheidenheit sieht, herausgefunden hat. Dass er sich quasi anmaßt, die Naturgesetze zu diktieren, ist ihm nicht bewusst. Hurrikans, davon ist Cline überzeugt, kündigen sich durch unverwechselbare Vorzeichen an. Solange er diese nicht am Himmel erkennt, wird es ergo auch kein Unwetter geben.
Ein verhängnisvoller Irrtum
Der große Hurrikan von 1900 will sich nicht in Clines Weltbild fügen. Eine Reihe klimatischer Ausnahmebedingungen lässt ihn direkten Kurs auf Galveston nehmen. Die Katastrophe naht nicht unbeobachtet, doch Cline, der den Himmel über Galveston und die Gezeiten beobachtet, kommt zu dem Schluss, dass der Sturm sich auflösen wird, bevor er die Stadt erreicht. So gibt es für die Bürger von Galveston keine Vorwarnung. Ahnungslos gehen sie ihren alltäglichen Geschäften nach, während der Hurrikan sich über dem Golfstrom nähert und dabei eine gewaltige Flutwelle vor sich aufzuschieben beginnt.
Galveston ist eine Boomstadt, die praktisch planlos und genau dort an der Küste errichtet wurde, wo es zwischen Meer und Land keinerlei Hindernis gibt, die eine Flutwelle brechen oder einen Sturm ablenken könnte. Die Bürger haben es aus Bequemlichkeit und Kostengründen nie für nötig befunden, einen schützenden Damm zu bauen. So nimmt das Verhängnis seinen ungehinderten Lauf: Binnen weniger Stunden wird Galveston ausgelöscht. Mindestens 6000 Menschen, vielleicht aber auch die doppelte Anzahl, verlieren ihr Leben. Genau wird man es niemals wissen, weil sich die Stadt in eine riesige Schlamm und Trümmerwüste verwandelt hat, unter der zahllose Opfer für immer begraben liegen.
Die verdrängte Katastrophe
Der Untergang der Stadt Galveston gehört zu jenen Ereignissen, die aus zunächst unerfindlichen Gründen zu einer Fußnote der Weltgeschichte herabgesunken sind. Bei näherer Betrachtung trifft man allerdings sehr alte Bekannte wieder, die dafür verantwortlich sind: Dummheit, Ignoranz, Selbstgefälligkeit, vor allem aber der tief verwurzelte menschliche Drang, unangenehme Erfahrungen zu verdrängen besonders dann, wenn man sie zwar verschuldet hat, aber selbst nicht betroffen ist.
Die wahre Tragödie ist weniger die Katastrophe selbst, sondern die Tatsache, dass sie in diesem Ausmaß hätte verhindert werden können. Dieser Erkenntnis mochte man sich bisher nicht einmal in Galveston selbst stellen. Dort sang man lieber das hohe Lied des Heldentums im Angesicht der drohenden Gefahr, und am lautesten erklang das Lob für Isaac Cline, den angeblichen Helden, der selbstlos seine Mitbürger noch vor dem Hurrikan warnte, als die Sturmflut bereits ganze Häuserzüge durch die Luft wirbelte. Cline hat persönlich an seinem Denkmal gearbeitet, und das gelang ihm angesichts seines publizistischen Geschicks hervorragend, zumal er so alt wurde, dass er jene, die es besser wussten, in der Mehrzahl einfach überlebte.
Erik Larson hatte es folglich nicht leicht, als er sich daran machte, die Geschichte Galvestons und des großen Hurrikans von 1900 zu rekonstruieren. Der Sturm hat die frühen Archive vor Ort vollständig vernichtet. Aber in den Familien der zahllosen Opfer fand Larson viele Augenzeugenberichte, die ein in dieser Klarheit bisher nicht gekanntes Bild der Katastrophe zeichnen. Die detaillierte Schilderung des Sturms und seiner Folgen ergänzt Larson durch einen ausführlichen Blick auf die Geschichte der Vereinigten Staaten an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Ohne würden die Ereignisse in Galveston unverständlich bleiben. Nicht fehlen darf eine Einführung in die Wetterkunde und hier naturgemäß in die Genese großer Wirbelstürme.
Der Leser als Zeuge
Larson wählt für sein Buch die Form des Tatsachenromans. Er schildert, was gewesen ist, scheut sich aber nicht, Lücken durch (allerdings gut abgesicherte) Vermutungen zu schließen. Wie der große Hurrikan vor der westafrikanischen Küste entstand und seinen verhängnisvollen Weg nahm, ist inzwischen geklärt. Larson präsentiert die komplizierten Mechanismen des Wetters verständlich und spannend zugleich. Dies gilt auch für die politischen Intrigen im und um das Wetteramt, die wohl hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass der Sturm ein völlig ahnungsloses Galveston traf.
„Isaacs Sturm“ ist nicht nur die Chronik einer Katastrophe, sondern auch die Tragödie eines Mannes, der (zu) viel wusste und doch unwissend war. Um 1900 benannte man große Stürme nach prominenten Opfern. Larson greift diese Tradition auf. Auch wenn Isaac Cline (1862 1955) das Unglück überlebte und niemals zur Rechenschaft gezogen wurde, blieb er für den Rest seines langen Lebens gezeichnet: Mit seiner Frau kam sein ungeborenes jüngstes Kind um, und in Augenblicken echter, von Selbstbetrug freier Reflexion begriff Cline durchaus, dass er und sein verehrtes Wetteramt kapitale Fehler begangen hatten.
Eric Larson ist mit „Isaacs Sturm“ zu Recht ein Bestseller gelungen. Mit dem Talent des echten Erzählers behält er die Fäden seiner Geschichte, die den halben Erdball umspannen, jederzeit fest in der Hand. „Spannend wie ein Krimi“ ist ein Urteil, das (viel zu) oft über ein Buch gesprochen wird, doch auf „Isaacs Sturm“ trifft es
zweifellos zu. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann das Fehlen von Bildern, die es in großer Zahl gibt. Aber das Internet gleicht dieses Manko aus. Die Eingabe der Begriffe „Galveston“ und „hurrican“ genügt, um zeitgenössische Fotos aus der dem Erdboden gleichgemachten Stadt betrachten zu können.
Autor
Erik Larson (geb. 1954) wuchs in Freeport, Long Island, auf. Er absolvierte die University of Pennsylvania, die er mit einem Abschluss in Russischer Geschichte verließ. Klugerweise ergänzte er dies mit einem Studium an der Columbia Graduate School of Journalism. Im Anschluss arbeitete er viele Jahre für diverse Zeitungen und Magazine.
Inzwischen hat Larson diverse Sachbücher veröffentlicht, von denen „Isaac’s Storm“ (1999, dt. „Isaacs Sturm“) ihm den Durchbruch und Bestseller-Ruhm brachte. Der Autor lebt mit seiner Familie in Seattle.
Taschenbuch: 373 Seiten
Originaltitel: Isaac’s Storm. A Man, a Time, and the Deadliest Hurricane in History (New York : Crown Publishers 1999)
Übersetzung: Bettina Abarbanell
http://www.fischerverlage.de
Der Autor vergibt: