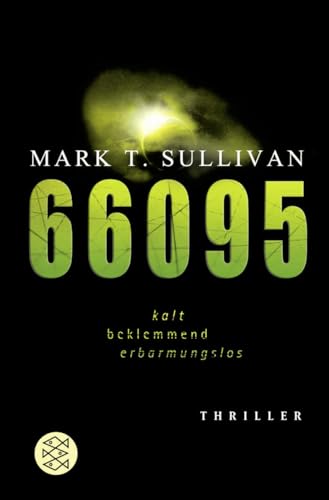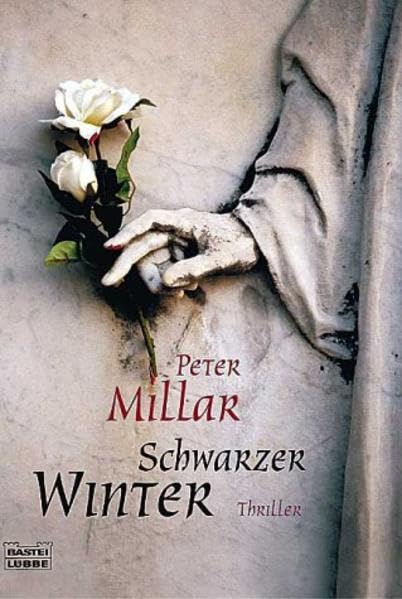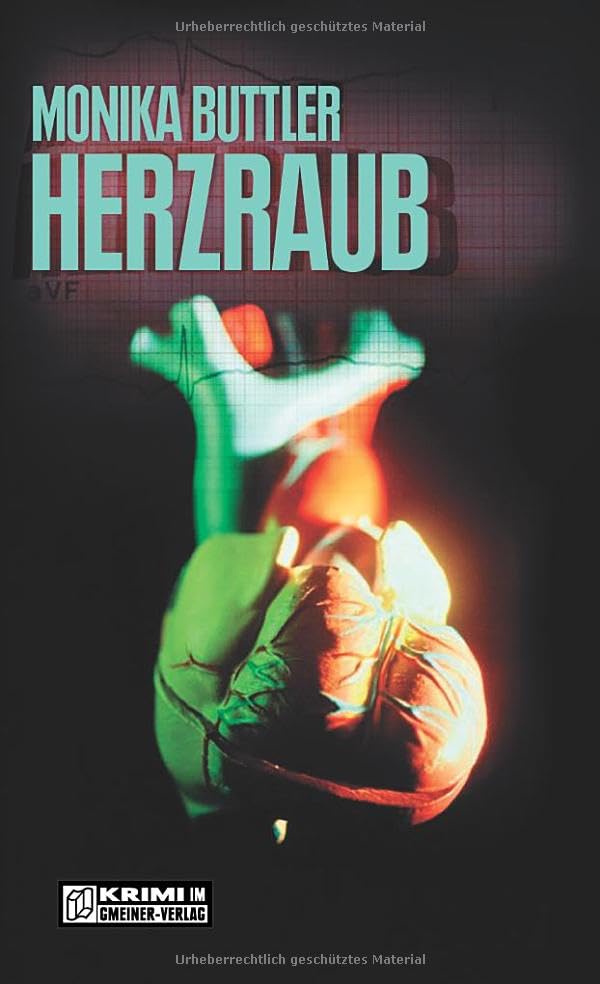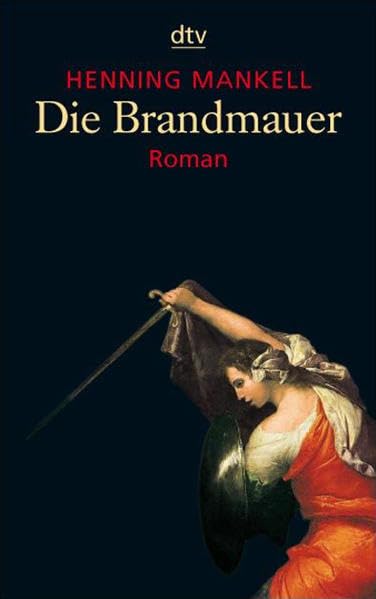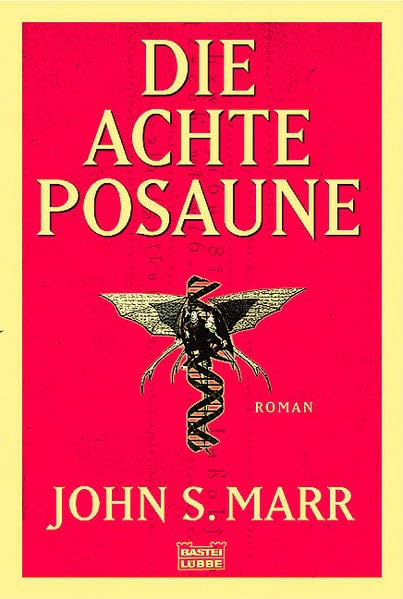Archiv der Kategorie: Thriller & Krimis
Hans Hellmut Kirst – Die Nacht der Generale
Ein hochrangiger Offizier lebt im II. Weltkrieg seinen Drang als Serienkiller aus; dem für das Nazi-Regime peinlichen Treiben soll ein Ermittler unauffällig ein Ende bereiten, doch der Mörder ist geschickt, nutzt seine Privilegien und setzt seine grausigen Taten fort … – Dieser (deutsche!) Quasi-Vorläufer der seit Hannibal Lecter bestsellerabonnierten Killer-Thriller bedient sich bereits der bekannten Spannungselemente und hat seinen Unterhaltungswert nicht eingebüßt: lesenswert! Hans Hellmut Kirst – Die Nacht der Generale weiterlesen
Hohlbein, Wolfgang – Feuer
Wieland Lokkens, kurz „Will“ genannt, hat mal wieder eine respektable Packung Ärger am Hals: Der kleinkriminelle Enddreißiger mit einem Händchen für den gezielten Griff ins Klo und dem Knast-Dauerabo ist auf Bewährung auf freiem Fuße und hat natürlich nichts Besseres zu tun, als mit einem – sagen wir einmal – nicht ganz rechtmäßig ausgeliehenen Amischlitten der Extravaganzklasse durch ein Wohlstandsviertel zu cruisen und dabei – hoppla! – ein Kind anzufahren. Dieses flüchtet in Panik in eine frisch abgebrannte Villa, einen schuld- und pflichtbewussten Will auf den Fersen, der sich eigentlich nur um das Opfer seiner Tagträumerei am Steuer kümmern möchte. Bei der Hetzjagd durch die in abendlicher Dämmerung dräuende Brandruine und deren Kellerräume verliert dieser aber allmählich die Geduld mit dem widerborstigen Flüchtling, trägt selbst noch einige Blessuren davon und wird in dieser Stresslage letztlich ziemlich knatschig.
Erschöpft einigen sich Jäger wider Willen und seine Beute bald auf ein Unentschieden, verlassen die Hetzarena – und prompt bekommt Will eins übergezogen und macht unerwartete Bekanntschaft mit kampferprobten Fäusten. Offenbar gibt es noch andere Interessenten an seiner minderjährigen Jagdbeute. Diese verstehen nicht viel Spaß und bedeuten Will unmissverständlich, sich um seine eigenen Probleme zu kümmern, die sich gerade selbstverschuldet vermehrt haben. Will zieht arg gebeutelt Leine, sieht noch, wie das Kind samt Schlägertypen in einer Limousine verschwindet und versucht, wenigstens noch seinen Auftrag auszuführen und die geklaute Karre bei seinem Unterweltchef abzuliefern, der ohnehin nicht viel von dem geborenen Loser hält und mindestens ebenso wenig Spaß versteht wie Wills soeben knapp überlebte unheimliche Begegnung der schmerzhaften Art.
Auf der Weiterfahrt kreuzt unser Katastrophenmagnet eine großräumig gesperrte Unfallstelle. Überraschung: Die Kindesentführer hatten wohl ebenfalls keinen ihrer glücklichen Tage, denn ihre Limousine brennt fröhlich auf der Straße vor sich hin – vom Kind keine Spur. Dass Will das hartnäckige Gör immer noch nicht los ist, stellt er kurz darauf fest, und auch, dass Villen und Limousinen lange nicht das Einzige sind, was im weiteren Verlauf dieser für ihn unerfreulichen und strapaziösen Geschichte abfackeln wird. Was hat das Kind mit dieser Aneinanderreihung von Malheuren zu tun, wie gestaltet sich Wills eigene Rolle dabei, wer waren die Eisenfresser aus der Limousine, warum wird Will selbst zur Jagdbeute und inwiefern scheint seine eigene Vergangenheit davon betroffen zu sein?
_Apocalypse now?_
Gleich vorweg: Der Klappentext ist zum Teil mal wieder aus der PR-Kiste gewürfelt. Die ganze Menschheit werde von verborgenen Mächten aus der Erde bedroht, heißt es da. Es zündelt auffällig kräftig in Köln, das wohl, aber mehr auch nicht. Und die Titulierung als „zweiter Apokalypse-Thriller nach dem Bestseller FLUT“ haut damit ebenso daneben, zumal sie nebenher einen Fortsetzungseffekt suggeriert.
„Feuer“ ist in weiten Teilen ein waschechter Thriller, ganz ohne Apokalypse oder verborgene Mächte, nur mit einem Hauch mysteriös-mystischer Andeutungen verfeinert. Ein unbedarfter Verlierertyp stolpert in eine Reihe gefahrvoller Ereignisse und wird mit Machenschaften konfrontiert, die über seinen Horizont und seine Erfahrungswelt hinausgehen. Will purzelt durch das Unterweltmilieu, prallt auf exzentrische Geldbonzen, die vielleicht gar Kinderhandel betreiben, und kreuzt unweigerlich die Wege ermittelnder Staatsbeamter, die ihm aufgrund seiner nichtsnutzigen Vergangenheit die Unschuldsrolle nicht ganz abnehmen wollen. Und stets begleitet die archaische Macht des Feuers das Geschehen.
Hohlbein bietet damit für den Start einige bewährte Thriller-Zutaten auf, die er geschickt und spannend in Szene zu setzen und mit der zynischen Weltsicht seines Antihelden zu ergänzen weiß. Unterstützt wird er dabei durch bereits im Prolog und in Wachträumen angedeutete mystische Verbindungen zu Wills eigener Vergangenheit, die neugierig machen. In der Tat gelingt es unserer fleischgewordenen deutschen Lieblings-Buchveröffentlichungsmaschine – immerhin über acht Werke im Jahresschnitt, die zudem ständig neu aufgelegt und (auch unter abweichenden Titeln) in diversen Verlagen publiziert werden –, die Spannung über weite Teile aufrecht zu erhalten, die Action nicht abreißen zu lassen, unerwartete Wendungen zu präsentieren und den Leser mit häppchenweisen Informationen bei der Stange zu halten.
Auch die Charaktere sind thrillertauglich und bis kurz vor dem Ende in ihren Motivationen und ihrer Parteinahme nicht recht einzuordnen, was sich ganz klar positiv im Spannungsbogen bemerkbar macht. Also unterm Strich alles bestens und gelungen? Leider nein. Mal wieder.
_Vielschreiberei: Risiken und Nebenwirkungen_
Mit mittlerweile perfektionierter Zielstrebigkeit gelingt es Hohlbein auch diesmal wieder, einen viel versprechenden Ansatz stilecht zu zerlegen und die aufgebaute Erwartungshaltung des Lesers in der Zielgeraden zerbröseln zu lassen. Dabei spielen die sprachlich-stilistischen Patzer kaum eine Rolle; von Hohlbein ist man da inzwischen einiges gewohnt und insgesamt kann der Arzt einen Genesungsprozess attestieren. Derlei ist beim Griff zum jeweils aktuellen Hohlbein so nebensächlich wie intensive Charakterformung, angemessene Recherchearbeit oder literarische Finesse. Wir wollen spannend unterhalten werden und am Ende das Buch zufrieden gesättigt beiseite legen können.
Das erste Erwartungsmoment wird größtenteils zufrieden gestellt; lediglich im letzten Buchdrittel fallen größere Längen unangenehm auf, die den Handlungsverlauf ausbremsen und sich zu sehr in Befindlichkeiten des Protagonisten ergehen. Mehr Handlungs- und Dialoglastigkeit wäre hier wünschenswert gewesen, ebenso wie die straffende und streichende Hand eines erfahrenen Lektors, der bei der Gelegenheit gleich einige allzu offensichtliche Ausdrucksschwächen hätte retuschieren können. Insgesamt geht das Ergebnis aber als immer noch spannende, unterhaltsame und die Fantasie anregende Lektüre durch; das Zuviel an Text zum Ende hin führte lediglich zu einer erhöhten Querleserate meinerseits, damit es endlich mal vorangeht.
Das Finale allerdings torpediert Herr Hohlbein dann vollends. Durch allerlei Geschwafel hier und Wiederholungen dort hat der Autor zu viel Raum und Arbeitszeit verloren, die er nun mit geballter Informationsflut ausgleichen möchte. Und hier begeht er nun den tödlichsten aller Fehler: Er lässt seine Bösewichte auf den ungelogen zweihundert Seiten der Schlusssequenz über Gott und die Welt schwadronieren. In der Tat gibt es so viele Erklärungsmonologe, die mit der obligatorischen Bösewichtwaffe im Anschlag auf den Leser einprasseln, dass Hohlbein sogar den Protagonisten mehrfach über so viel dummes und wirres Geschwafel die Augen verdrehen und gehörtechnisch abschalten lässt. Eine absurde Form von Realsatire oder etwa schriftstellerischer Galgenhumor kurz vor dem kreativen Exitus?
Als Bonus ist man dann trotz der Informationsflut im Umfang eines VHS-Kurses über Familienbande, die Edda, Urgewalten, Schmiedefeuer, Kölle und den Rest der Welt immer noch nur um weniges klüger als zuvor, denn dem Autor gelingt es nicht wirklich, eine zeitlich wie kausal logische Abfolge von Erklärungen zu präsentieren, die all die mittlerweile geöffneten Überraschungspäckchen in eine erhellende Lichterkette zu reihen verstünde. Alles bleibt irgendwie vage bis absurd, der Leser tappt weiterhin verwirrt im Dunkeln und stellt fest, dass die Spannung erzeugende Verunsicherung bis zum Schluss weniger Hohlbeins fachlicher Meisterschaft als viel mehr der tatsächlichen Verwirrung von Handlungsansätzen zu verdanken ist. Zudem bricht jetzt das phantastische Element des Romans vollends hervor, doch leider derart abrupt, schwer nachvollziehbar und geradezu halluziniert, dass wir als verdatterte Beobachter des Geschehens überfordert werden. Die bis zum Letzten erhoffte Auflösung all der Verwirrung bleibt dabei leider aus.
Es ist wahrlich ein Jammer. Die Ansätze sind gelungen, Spannung ist vorhanden und dann verpufft alles in einem Mangel an Lektoratsarbeit und konzentrierter Schriftstellerei, die sich vielleicht mit einem guten Werk pro Jahr begnügen sollte, anstatt in einem Dutzend Veröffentlichungen jährlich ebenso viele sich immer ähnlichere Ideenansätze in Variationen eines Themas halbgar zu vergeigen. Schade drum. Bis auf den verkorksten Abschluss wurde ich dennoch gut unterhalten; lediglich die Anschaffung einer nicht unbedingt kostengünstigen Hardcover-Ausgabe für den kleinen Hohlbein zwischendurch sollte man sich zweimal überlegen, auch wenn man mit siebenhundert Seiten einiges an Lesefutter dafür bekommt.
S. S. Van Dine – Der Mordfall Drachen
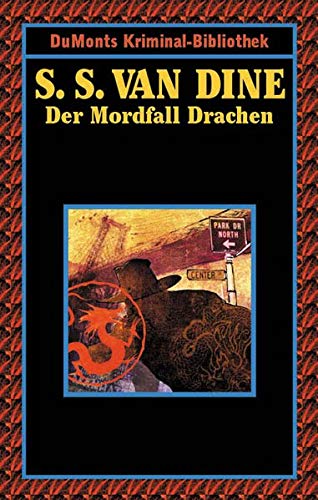
Mark T. Sullivan – 66095
Während einer der letzten Mondlandungen wurde 1972 gefunden der Steinbrocken mit der Probennummer „66095“ geborgen. Er sendet mysteriöse Strahlen aus, wenn man ihn mit Energie ‚füttert‘. Für Menschenhirne sind sie nicht bekömmlich, da sie Depression und Mordlust fördern. Dies bleibt lange unbemerkt, denn 66095 versauert viele Jahrzehnte in einem Laborarchiv. Dann experimentiert der Forschungsassistent Robert Gregor damit herum, bis er gollumartig dem fatalen Zauber des Steins erliegt und zum mondsüchtig verrückten Mörder mutiert.
Szenenwechsel: Die USA planen ihre Rückkehr auf den Mond. Dort werden supraleitende Erze vermutet, aus denen sich Energie gewinnen lässt. Als ideales Training für angehende Luna-Bergleute empfiehlt die NASA aus logisch recht unerfindlichen, für die Dramaturgie dieses Buch jedoch unverzichtbaren Gründen einen unterirdischen Marsch durch die Labyrinth-Höhlen im US-Staat Kentucky. Mark T. Sullivan – 66095 weiterlesen
Fielding, Helen – Geheimnisse der Olivia Joules, Die
|Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist …
… Osama Bin Laden!|
Helen Fielding ist spätestens seit der grandiosen Verfilmung von „Schokolade zum Frühstück“ mit Renee Zellweger in der Hauptrolle sicherlich jedem als die göttliche Autorin der beiden Romane um Bridget Jones ein Begriff. Insider kennen darüber hinaus auch ihr eher gewöhnungsbedürftiges Werk „Hummer zum Dinner“, das den typischen Bridget-Jones-Charme ein wenig vermissen lässt. So schlug ich gespannt ihr neues Werk auf, um mir eine Meinung zu bilden, denn ich war von vornherein etwas skeptisch, da ich mir bereits recht sicher war, dass ihre neue Heldin Olivia gar nicht so sympathisch sein kann wie die liebe Bridget mit ihren eingebildeten Gewichtsproblemen.
Olivia Joules arbeitet freiberuflich als Journalistin und wird zur Präsentation einer neuen Gesichtscreme in Miami eingeladen. Auf der Party bemerkt sie einen erstaunlich gut aussehenden Mann, der sie offensichtlich anzuflirten scheint, es handelt sich um den Filmproduzenten Pierre Ferramo, also um die Werbefigur für die neue Creme. Olivia ist entzückt angesichts dieses fantastischen Mannes, doch schnell packen sie Zweifel: Handelt es sich bei Ferramo womöglich um Osama Bin Laden? Plötzlich ist sie sich sicher, den vielleicht meistgesuchten Mann der Welt gefunden zu haben. Schnell googlet sie Ferramo und findet keinen einzigen Treffer, während sie unter ihrem eigenen Namen fast 200 Suchergebnisse angezeigt bekommt. Ihr natürliches Misstrauen ist sofort geweckt, was wird hier gespielt? Nichts kann Olivia Joules in diesem Glauben erschüttern; Bin Laden hat sich sein Gesicht operieren lassen und sogar seine Körpergröße verändert. Als Ferramo dann auch noch ein arabisches Wort fallen lässt, ist Olivia schockiert, sie hat einen al-Qaida-Mann vor sich!
Olivia beschließt, Ferramo auf den Zahn zu fühlen und ihren Aufenthalt in Miami zu verlängern. Dort liegt das berühmte Schiff „OceansApart“ vor Anker, das Olivia unbedingt besichtigen möchte, doch bevor es dazu kommen kann, explodiert das Schiff und sinkt vor Olivias geschockten Augen. Weitaus erschütternder findet sie allerdings die Tatsache, dass Ferramo sie kürzlich noch davor gewarnt hat, das Schiff zu betreten. Ist Ferramo Schuld an dem Schiffsunglück? Kurz darauf flüchtet er nach Los Angeles und Olivia reist ihm hinterher. Die Verfolgungsjagd geht schließlich weiter und führt Olivia zunächst nach Honduras, später in den Sudan, sie erlebt aufregende Dinge und entdeckt schließlich auch das Geheimnis hinter Pierre Ferramo.
So weit zum Inhalt des Buches, der schon mal sehr abgefahren klingt, nicht wahr? Die Geschichte beginnt zunächst recht vielversprechend und lustig. Der Leser wird mit Olivia vertraut gemacht und lernt sie als etwas chaotische Journalistin mit blühender Fantasie kennen. Sie reist gerne und lebt am liebsten in Hotels, wo sie pedantisch darauf achtet, ob das Toilettenpapier am Ende auch ordentlich gefaltet ist und spitz zusammenläuft. Ihre fantastische Einbildung führt sie schnell zu dem Schluss, dass der gut aussehende Ferramo nicht wirklich Franzose ist, sondern ein al-Qaida- Mitglied sein muss und zwar nicht irgendeines, nein, Osama Bin Laden persönlich. An dieser Stelle musste ich etwas schlucken, denn diese Wendung fand ich dann doch ein wenig zu weit hergeholt. Eine blühende Fantasie kann ich noch gut nachvollziehen (wer hat die nicht?), aber musste es gleich Bin Laden sein? Damit hat das Buch zwar aktuellen Bezug, aber wird dadurch noch weitaus unrealistischer als die meisten Frauenromane ohnehin sind. Sympathisch wird Olivia dennoch, man erfährt mehr über ihre tragische Vergangenheit und leidet irgendwo mit ihr mit, denn ihr Chefredakteur besteht auf einer fertigen Story bis 18 Uhr, vergisst allerdings dazu zu sagen, dass er damit englische Zeit meint. So tippt Olivia in Amerika seelenruhig ihrer Zeit hinterher und bringt kein anständiges Wort zu Papier, während ihr Redakteur in London schon graue Haare bekommt.
Das Buch ist durchaus witzig geschrieben, doch hat es nicht die persönliche Nähe wie „Bridget Jones“, was zum einen daran liegen kann, dass das Buch nicht in der Ich-Form geschrieben ist. Ein neutraler Erzähler aus der dritten Person schildert Olivias Geschichte und ihre Erlebnisse, er stellt sie auch vor, so dass man sie doch irgendwo lieb gewinnt, doch herrscht immer eine gewisse Distanz, die durch die persönlichen Tagebucheinträge in „Bridget Jones“ von der ersten Seite an aus dem Weg geräumt waren. Durch die Erzählerform ist der Schreibstil auch nicht so locker-flockig geraten, Frauenbücher gewinnen meist an Charme durch die persönlichen Gedanken der weiblichen Hauptperson, die den Leser an allen noch so verrückten und peinlichen Gedanken teilhaben lässt, das ist bei Olivia leider nicht möglich.
Die Charakterzeichnung Olivias finde ich auch nur teilweise gelungen, denn man lernt sie nicht so gut kennen, wie man es sich wünschen würde. Das Buch ist nur kurz und will ja auch noch die hanebüchene Spionagegeschichte erzählen, daher rückt die Personenbeschreibung schnell in den Hintergrund. Neben Olivia lernt man eigentlich fast keine handelnde Person näher kennen, selbst Ferramo bleibt recht blass, wobei das vielleicht auch besser ist, da man sich dann als Leser noch eine Ähnlichkeit mit Bin Laden einbilden kann, die wohl offensichtlich gar nicht vorhanden ist. Anfangs fand ich Olivia Joules noch sehr interessant und sympathisch durch ihre leicht chaotische Art, doch schnell fängt sie mit ihrer Einbildungein ein wenig an zu nerven. In jede Situation deutet sie etwas hinein, das doch recht weit hergeholt scheint. Schade, eine Hauptperson, mit der man auf jeder Seite und in jeder Zeile mitleiden kann, weil sie einer verlorenen Liebe oder Kleidergröße 36 hinterher trauert, wäre mir doch lieber gewesen als diese neue Romanfigur. Hier hat sich Helen Fielding deutlich verschlechtert, meiner Meinung nach sollte sie sich lieber ein neues Kapitel in Bridgets Leben ausdenken.
Mein größter Kritikpunkt ist allerdings die Geschichte an sich. Ich weiß das Buch nicht recht einzuordnen, da es als Mischung aus trashigem Frauenroman und Spionage“thriller“ daherkommt, schnell schwenkt das Buch von der typischen Frauengeschichte um auf die Agentenschiene, auf der Olivia der al-Qaida hinterherspioniert. Es mag durchaus innovativ und interessant sein, einen Brückenschlag zwischen verschiedenen Genres zu wagen, doch finde ich, dass Fielding dies nicht überzeugend gelungen ist. Das Buch ist nicht witzig und weiblich genug für das Genre „Frauenroman“, aber auch nicht spannend genug für einen echten Spionageroman. Somit wirkt die Story ziemlich lächerlich und überzeugt eigentlich auf keiner Seite. Wahrscheinlich kann man sogar James Bond einen größeren Bezug zur Realität nachsagen als Olivia Joules. Mir ist nicht ganz klar, was Helen Fielding dazu bewogen hat, ihre neue Romanheldin in eine solche Spionagegeschichte hineinzuschreiben, denn ihre alten Bridgetfans mag sie damit vergrault haben.
Etwas erschrocken war ich außerdem, als ich das Buch nichts ahnend umgeblättert habe (im Zug zwischen zwei Geschäftsmännern, die ihre |Financial Times| lasen …) und mir ein billiges schwarz-weiß Bild entgegensprang. Im Buch finden sich nämlich ein paar wenige Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die wirken, wie aus einem Supergirlcomic geklaut. Die Bilder sind unterlegt von einem Satz aus dem Roman, der die Szene beschreiben soll. Leider tragen die Bilder nicht sonderlich gut dazu bei, sich die Situationen besser vorzustellen, da sie doch recht grob und künstlerisch unbegabt wirken, aber irgendwie mögen sie auch in den Rahmen dieses Buches passen …
Insgesamt war ich doch enttäuscht von dem Buch, da ich mir ein spritziges Frauenbuch gewünscht hatte, das in Art von Bridget Jones eine sympathische Frauenfigur mit üblichen Problemen vorstellt. Allerdings wird man als Leser dann mit einer Olivia Joules konfrontiert, die sich Osama Bin Laden gegenübergestellt glaubt. Die Geschichte nimmt dadurch sogleich eine unangenehme und unrealistische Wende, die dem Buch nicht gut tut. Ganz so furchtbar wie die Besprechung klingen mag, ist das Buch dann allerdings nicht. Es war schon unterhaltsam und sicherlich keine Zeitverschwendung, aber über das Mittelmaß kommt es leider nicht hinaus. So reicht es dann auch nur zu einer knappen Empfehlung.
Armitage Trail – Scarface
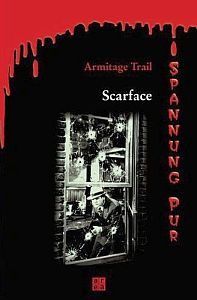
Armitage Trail – Scarface weiterlesen
Allingham, Margery – Hüter des Kelchs, Der
_Das geschieht:_
Albert Campion ist das schwarze Schaf seiner hochadligen Familie, die ihn deshalb verstoßen hat. Nun verdingt er sich als privater Ermittler, der auch dort seiner kriminalistischen Arbeit nachgehen kann, wo die Polizei versagt. Campion hat dank seines bodenständigen ‚Partners‘, des ehemaligen Einbrechers Lugg, einen guten Draht zur Unterwelt. So hat er von der „Firma“ erfahren. Diese Verbrecherbande arbeitet für hoch angesehene, schwer reiche, absolut skrupellose Kunstsammler, die ihrer Sammlung Stücke einverleiben wollen, die sich in Privatbesitz befinden oder in Museen hängen: Sie werden schlicht gestohlen.
Nun erging ein neuer ‚Auftrag‘ an die „Firma“: Der berühmte Kelch von Gyrth soll geraubt werden. Seit Jahrhunderten befindet er sich im Besitz der gleichnamigen Familie, die ihn in „The Tower“, dem Stammsitz nahe der Gemeinde Sanctuary in der Grafschaft Suffolk, aufbewahrt. Ein uralter Geheimvertrag verpflichtet die Gyrthes, den Kelch für die Krone zu hüten. Verschwindet er, verlieren sie Rang und Besitz.
Kein Wunder, dass Campions Warnung für Aufregung sorgt. Doch wer ist Freund, wer Feind? Campion findet einen Verbündeten in Valentine Gyrth, Sohn und Erbe des derzeitigen Baronets. Dieser hat sich zwar mit dem Vater zerstritten, kehrt jetzt aber zurück, als nicht nur die Familienehre in Gefahr gerät: Lady Diana, Valentines törichte Tante, die sich selbst zur „Kelchjungfrau“ ernannt hatte, wurde ermordet auf einer Waldlichtung gefunden. Die „Firma“ ist schon aktiv, und sie will den Kelch offenbar um jeden Preis: schlecht für Campion & Co., die weiterhin absolut keine Ahnung haben, wer ihre Gegner sind!
|Kleine, mörderisch gemütliche Welt|
Glückliches Großbritannien: Hier ist zumindest im klassischen Kriminalroman die Welt noch in Ordnung. Ein Verbrechen kann das nur kurzfristig stören. In so einer Welt möchten wir globalisierungsgestressten, outgesourcten Gegenwartsmenschen insgeheim auch gern leben. Deshalb lesen wir so gern Romane wie diesen. Alle von den Fans so heiß geliebten Elemente eines zünftigen „Whodunit“-Thrillers werden von der Verfasserin kundig beschworen. Da haben das kleine, idyllische, von der Zeit offenbar vergessene Dorf auf dem Land, über dem ein feudaler, von einem verwunschenen Wald umgebender Landsitz thront, der über einen Turm mit Geheimkammer verfügt.
Der Plot ist dieser Umgebung angemessen. Vor Urzeiten hat ein frühmittelalterlicher Eroberer in „The Tower“ einen Schatz verborgen, von dessen Existenz die englische Monarchie abhängt. Ein kompliziertes, höchst archaisches Ritual ist damit für jene verbunden, die ihn hüten. Die Vergangenheit ist und bleibt präsent, als sich nun gierige Diebesfinger nach dem wertvollen Kelch ausstrecken.
Hüten können diesen natürlich nur Adlige reinsten Geblüts, die dann ruhig reichlich verschroben sein dürfen. Es ist unter diesen Umständen überhaupt kein Stilbruch, dass sich ein leibhaftiges Gespenst ins Geschehen einmischt. Auch eine Hexe, ein Dorftrottel, ein zerstreuter Professor, romantisch-verwegene Zigeuner, pittoreske Schurken und andere absolut unrealistische, aber allerliebst agierende Gestalten haben ihre großen Auftritte.
Eine riskante Geschichte, stets haarscharf am Rande der Lächerlichkeit balancierend: Das Talent der Autorin führt dazu, dass wir uns stattdessen durchweg gut amüsieren. Allingham leugnet nie die Märchenhaftigkeit ihres Kelch-Krimis – sie ignoriert diese einfach bzw. präsentiert noch die haarsträubendsten Ereignisse mit dem berühmt-berüchtigten britischen Ernst, hinter dem sich knochentrockener Humor verbergen kann. Solche Meisterschaft und Dreistigkeit zugleich im Spinnen absurder Garne kennt man sonst nur von John Dickson Carr (1906-1977), der gruselige Burgen und Ruinen liebte und doch immer wieder streng rational denkende Detektive ihre Geheimnisse lüften ließ. In dieser Beziehung geht Allingham noch einen Schritt weiter: Die Präsenz des Übernatürlichen fügt sie geschickt ins Geschehen ein. Das hätte Carrs Dr. Fell niemals gestattet!
|Den Anstand wenigstens vorgeben|
Verfolgungsjagden, Massenprügeleien, nächtliche Hexenhatz, Entführungen, Todesfallen: Auch sonst lässt Allingham ihre Leser nie zur Ruhe kommen. Albert Campion kommt kaum zum Kombinieren. Für einen angeblich vergeistigten, weichlich wirkenden Ermittler ist er ziemlich rege, reist inkognito mit Zigeunern im Land umher, verfügt über bemerkenswerte Verbindungen zur Prominenz seines Heimatlandes in Politik und Gesellschaft. Kein Wunder, ist er doch selbst so etwas wie ein Königskind, das sich zwar von seiner Familie losgesagt hat, aber dennoch seine Adelspflichten erfüllt. Um seine ehrwürdige Verwandtschaft nicht vor der Öffentlichkeit zu düpieren, hat er sich ein bürgerliches Leben und einen neuen Namen zugelegt. Die ihm in die Wiege gelegten Kontakte kombiniert er mit seinen kriminalistischen Talenten. Das ist für den echten Blaublütler praktisch: Selbst das Königshaus bemüht Albert Campion, wenn es heikle Verbrechen zu klären und Skandale zu verhindern gilt, denn er ist offiziell zwar persona non grata, aber trotzdem „einer der Jungs“ & ein Gentleman, mit dem man sich abgeben kann.
Campion ist wie so viele Detektive der klassischen Ära ein Abkömmling von Sherlock Holmes. Allingham bemüht sich zwar ihn menschlicher wirken zu lassen, aber da ist einerseits doch eine Grenzlinie, hinter der sich der wahre Albert Campion verborgen hält. Andererseits finden wir halt doch viele Holmes-Elemente wieder, wenn wir nach ihnen Ausschau halten.
|Freunde & Frauen|
Einen Watson besitzt Campion auch. Den hat Allingham allerdings völlig neu gestaltet. Lugg zeichnet ganz sicher nicht die Taten seines Herrn für die Nachwelt auf. Er schreibt (oder denkt) nicht, er handelt. Als waschechter Angehöriger der Unterschicht und geläuterter Krimineller verfügt er über Mutterwitz, Schlauheit und Mut. Allingham hat ihn bemerkenswert freigeistig und ohne Spur des typischen Herr-Diener-Verhältnisses gestaltet, wie es z. B. Dorothy Sayers’ Lord Peter Wimsey und Bunter verbindet. Campion und Lugg haben viel miteinander erlebt; sie sind Freunde geworden, soweit dies das starre britische Kastensystem möglich macht.
Frauen sind im klassischen Thriller üblicherweise schmückendes Beiwerk. Auch Allingham hütete sich ihre zeitgenössischen Leser zu vergrämen. Emanzipation im eigentlichen Sinn wird man daher nicht finden. Allerdings deutet der Originaltitel unseres Abenteuers bereits an: Die Verfasserin ist sich durchaus der Tatsache bewusst, dass ihre Geschlechtsgenossinnen nicht nur deshalb auf dieser Welt wandeln, um von guten Männern vor bösen Kerls gerettet zu werden ,..
_Autorin_
Margery Louise Allingham wurde 1904 geboren. Die Schriftstellerei wurde ihr quasi in die Wiege gelegt; in ihrer Familie ersetzte sie die Hausmusik. So war es kaum verwunderlich, dass Margery beschloss, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Sie veröffentlichte 1923 als Romanerstling „Blackkerchief Dick“, eine Romanze. In diesem Genre verfasste sie auch eine Reihe von Kurzgeschichten für Magazine
In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre entdeckte Allingham den Kriminalroman. 1928 erschien „The White Cottage Mystery“ (dt. „Ein böser Nachbar“). Die Leserschaft reagiert positiv. Allingham blieb dem Genre treu. Sie erfasste rasch, dass sie ihr Publikum noch fester an sich binden konnte, wenn sie ihm eine Identifikationsfigur in Gestalt eines Serienhelden lieferte. 1929 erschien Albert Campion auf der Bildfläche. Allingham schuf ihn (übrigens in enger, lebenslanger Zusammenarbeit mit ihrem Ehegatten Philip Youngman Carter) als freundlichen, intelligenten, jungen Mann mit adligem Hintergrund. Sie stattete ihn mit einer Biografie aus, wies ihm als Geburtsdatum den 15. Mai 1900 zu und ließ ihn altern. Mit den Jahren wurde Albert Campion klüger (und ein wenig zynisch). Auch seine Fälle wurden moderner; zwar blieben sie „Whodunits“, aber sie orientierten sich sacht an der Zeitgeschichte und taten nicht so, als sei das viktorianische England nie verstrichen.
Allinghams Thriller wurden von der Kritik und den Lesern gleichermaßen wegen der sauber gedrechselten, verwickelten Plots, der einprägsamen Figurenzeichnung und des Stils geschätzt. Zusammen mit Agatha Christie oder Dorothy L. Sayers gehörte sie zur Prominenz der britischen Kriminalschriftstellerinnen. (In Deutschland genoss sie seltsamerweise nie den Ruhm, der ihr zukommt; erst relativ spät nahm sich in den 1980er Jahren der Diogenes-Verlag des Allinghamschen Œvres an, aber dann immerhin gut übersetzt und ungekürzt.)
In den 1960er Jahren erkrankte Margery Allingham an Krebs. Sie erlag ihrer Krankheit am 30. Juni 1966. Dies war allerdings nicht das Ende von Albert Campion. Youngman Carter setzte die Reihe fort, er starb allerdings selbst bereits dreieinhalb Jahre später. Trotzdem blieb Albert Campion präsent; Allinghams Bücher werden ständig neu aufgelegt. Ende der 1980er Jahre gelang Campion der Sprung ins Fernsehen. In acht spielfilmlangen Episoden verkörperte ihn Peter Davison mit großem Erfolg.
_Die Albert-Campion Serie:_
(1929) Mord in Black Dudley/Der italienische Dolch |(The Black Dudley Murder)|
(1930) Gefährliches Landleben |(Mystery Mile)|
(1931) Polizei am Grab |(Police at the Funeral)|
(1931) Der Hüter des Kelchs |(Look to the Lady)|
(1933) Süße Gefahr |(Sweet Danger)|
(1934) Ein Gespenst stirbt/Wenn Geister sterben |(Death of a Ghost)|
(1936) Für Jugendliche nicht geeignet/Blumen für den Richter |(Flowers for the Judge)|
(1937) Der Fall Pig |(The Case of the Late Pig)|
(1937) Tänzer in Trauer |(Dancers in the Morning)|
(1938) Mode und Morde |(The Fashion in Shrouds)|
(1941) Judaslohn |(Traitor’s Purse)|
(1945) Zur Hochzeit eine Leiche |(Coroner’s Pidgin)|
(1948) Überstunden für den Totengräber |(More Work for the Undertaker)|
(1952) Die Spur des Tigers |(The Tiger in the Smoke)|
(1955) Die lockende Dame/Trau keiner Lady |(The Beckoning Lady)|
(1958) Schlag mich mit Blindheit |(Hide My Eyes)|
(1963) Der Geist der Gouvernante |(The China Governess)|
(1965) Gedankenschnüffler |(The Mind Readers)|
(1968) |Cargo of Eagles| (vollendet von Philip Youngman Carter; keine dt. Ausgabe)
(1968) Der zweite Anruf |(Mr. Campion’s Farthing)|*
(1971) Trick 17 |(Mr. Campion’s Falcon)|*
* von Philip Youngman Carter
_Die Campion-Kurzgeschichten-Sammlungen_
(1937) |Mr. Campion, Criminologist| (keine dt. Ausgabe)
(1939) Die Handschuhe des Franzosen |(Mr. Campion and Others)|
(1947) |The Casebook of Mr. Campion| (keine dt. Ausgabe)
(1969) Mädchen, Nerz und Detektive/Der Dank des Einbrechers |(The Allingham Case Book)|
(1973) Der vollkommene Butler |(The Allingham Minibus – More Short Stories)|
(1989) |The Return of Mr. Campion| (keine dt. Ausgabe)
|Taschenbuch: 282 Seiten
Originaltitel: Look to the Lady (London : Jarrolds 1931)
Übersetzung: Alexandra u. Gerhard Baumrucker
ISBN-13: 978-3-442-03079-8|
[Autorenhomepage]http://www.margeryallingham.org.uk
[Verlagshomepage]http://www.randomhouse.de/goldmann
(Michael Drewniok)
Westlake, Donald E. – Fünf gegen eine Bank
John Dortmunder ist clever, von ehrlicher Arbeit hält er wenig: Also schlägt er sich mit kleinen Gaunereien durch, wobei er der Polizei meist nur einen Schritt voraus ist. Ein großer Fischzug soll ihn endlich sanieren. Mit seinen Kumpanen Kelp, einem Autodieb, Hermann X, einem Safeknacker, March, einem Amateurrennfahrer, und Viktor, einem Ex-FBI-Agenten, will er die |Capitalists’ & Immigrants’ Bank| überfallen.
Besagte Bank ist wegen des Umbaus ihrer Filiale in einen riesigen Trailer umgezogen. Diese unsichere Schatzkammer zieht unser Gaunerquintett wie ein Magnet an. Man entschließt sich zu einer ungewöhnlichen Vorgehensweise und will zunächst die Bank abschleppen, um sie anschließend in einem stillen Winkel in aller Ruhe auszurauben.
Mit Hilfe eines ausgetüftelten Plans und eines starken Sattelschleppers gelingt das waghalsige Unternehmen tatsächlich. Dortmunder und Co. schrecken nicht einmal die sieben wütenden Wachmänner, die schwer bewaffnet in dem Banktrailer hocken.
Mit der Tücke des Objekts hat die Bande freilich nicht gerechnet. Es ist weitaus schwieriger als gedacht, den Safe im Inneren des Wagens zu knacken. Der Trailer verwandelt sich in eine belagerte Festung, vor deren Tor Dortmunder und seine nervösen Spießgesellen lauern. Die Zeit drängt, denn die Polizei schläft nicht. So muss Dortmunder einmal mehr seine grauen Zellen strapazieren. Anschließend ist das Chaos komplett …
Das „Rififi“-Thema ist nach dem französischen Kinoklassiker von 1954 („Du Rififi chez les hommes“) benannt: Minuziös werden die Vorbereitungen eines höchst komplizierten, eigentlich unmöglichen Raubes und seine anschließende Durchführung geschildert. Enorm ist die Spannung, die eifrigen Gauner wachsen den Zuschauern ans Herz, aber selbstverständlich geht während des Coups etwas gewaltig schief. An seinem Ende stehen Scheitern, Verhaftung, sogar Tod – ein fast tragischer Ausgang, der praktisch alle zufrieden stellt: das Gesetz und die intellektuellen Freunde des anarchistischen Gangstertums. (Im Angelsächsischen nennt man diese Filme übrigens „Caper-Movies“.)
„Fünf gegen eine Bank“ verkneift sich Gefühle und Gefühlsduseligkeit. Zwar werden Planung und Raub detailliert in Szene gesetzt. Schon von Anfang an ist freilich klar, dass die Geschichte, welche sich darum rankt, nur insofern ernst genommen werden darf, als sie sorgfältig geplottet und mit liebenswerter Verrücktheit inszeniert ist.
Der Raub der Trailer-Bank wird wohl kaum gelingen. Wir wissen es, sobald wir jene kennen lernen, die ihn durchführen möchten. Der kriminelle Akt ist an sich ohnehin Nebensache: Im Vordergrund steht vor allem sein Umkippen in puren Slapstick. Murphys Gesetz gilt auch für Verbrecher: Es wird schief gehen, was schief gehen kann.
Wie das aussieht, schildert Donald E. Westlake mit der ihm üblichen Meisterschaft. Lange narrt oder irritiert er sein Publikum. Bitterernst sitzen fünf Gauner beisammen und tüfteln ein Kapitalverbrechen aus. Doch obwohl Westlake dies fast sachlich beschreibt, wissen wir bald, dass hier etwas faul ist. Die Bande, die ihren Plan umsetzen will, zeichnet sich vor allem durch chronische Erfolglosigkeit aus.
So kommt es, wie es kommen muss: Dominosteinen gleich geraten die Elemente des Plans ins Stürzen. Eine Katastrophe führt zur nächsten, die Ereignisse überstürzen sich, immer absurder wird das Geschehen, während unsere Gauner zunehmend verzweifelt bemüht sind, einen klaren Kopf und das ersehnte Geld im Auge zu behalten. Ihr einziger Erfolg: Das Chaos wird immer turbulenter.
Der Heiterkeitsfaktor steigt ständig, weil Westlake die Regeln der Komik versteht. Nie forciert er das Vergnügen. Scheinbar ungerührt, aber mit knochentrockenem Humor beschränkt er sich darauf zu schildern, was geschieht. Platziert ist das Geschehen jedoch in einer Art Parallelwelt, die nur realistisch wirkt und von überaus irrationalen Zeitgenossen bevölkert ist. Vor dem inneren Auge des Lesers kann sich der Untergang der Dortmunder-Gang deshalb in immer neue groteske Höhen schaukeln.
Wichtig sind dabei auch die Details. So wird Dortmunder beispielsweise in einen Auffahrunfall verwickelt. Sein Gegenüber will die Polizei rufen. Da entdeckt der Gauner auf dem Rücksitz des anderen Autos einen Karton mit (zum Zeitpunkt des Romans verbotenen) Sexromanen: Die Titel dieser Schmuddelbücher sind real, und geschrieben hat sie ein noch sehr junger Autor namens Donald E. Westlake. Dortmunder möchte seiner Freundin mit gestohlenen Zigaretten eine Freude machen, bis ihm einfällt, dass sie ihre Glimmstängel selbst im Laden zu klauen pflegt. Kelp stiehlt ausgerechnet den Laster einer Schmugglerbande.
Er hat in seinem Leben noch keinen Dollar auf ehrliche Weise verdient und ist stolz darauf: John Archibald Dortmunder ist ein Krimineller mit Leib und Seele. Er liebt seinen Job, obwohl der ihm im Grunde mehr Hirnschmalz und Schweiß abfordert als jede „ehrliche“ Arbeit. Außerdem ist Dortmunder wie jeder Hollywood-Gauner ein unbelehrbarer Idealist und Träumer: Obwohl seine genial-verrückten Streiche regelmäßig scheitern, setzt er auf den nächsten, den endlich erfolgreichen Coup.
Fragt sich allerdings, wie das gelingen soll, wenn sich Dortmunder stets mit ausgesprochen farbenfrohen Komplizen umgibt. Sein alter Kumpel Kelp ist nicht der Hellste. March hat seine kaum vorbildhafte Mutter im Schlepptau, mit der er nebenbei einen windigen Versicherungsbetrug durchzieht. Herman X ist ein Möchtegern-Revoluzzer, der für seine schwarzen „Brüder“ aus der „Bewegung”“wie am Fließband Überfälle begehen muss. Viktor schreibt simultan zum Überfall auf die Bank an einem Roman darüber. Dortmunder wird von seiner abenteuerlustigen Freundin May zum Raub begleitet.
Die Bande profitiert von der Tatsache, dass ihnen seitens des Gesetzes nur bedingt Gefahr droht. Captain Deemer und seine Leute stellen sich wahrlich dümmer an als die Polizei erlaubt. Mehr als einmal laufen ihnen die gesuchten Bankräuber in die Arme – erkannt werden diese nie und von den Beamten stattdessen fürsorglich mit Kaffee und Kuchen versorgt …
Donald Edwin Westlake wird am 12. Juli 1933 in Brooklyn, New York, als Sohn irischstämmiger Eltern geboren. Bereits als Student denkt er an eine berufliche Laufbahn als Schriftsteller und verkauft erste Kurzgeschichten an Science-Fiction- und Mystery-Magazine. 1958 zieht Westlake nach New York City. Als überaus fleißiger Schreiber fasst im Verlagsgeschäft Fuß. 1960 erscheint sein erster Roman. „The Mercenaries“ (dt. „Das Gangstersyndikat“) lässt Westlakes Talent für harte, schnelle Thriller deutlich erkennen.
Bereits 1962 betritt Parker, ein eisenharter Berufskrimineller, die Bildfläche. „The Hunter“ (dt. „Jetzt sind wir quitt“/“Payback“) verfasst Westlake als Richard Stark. „Richard“ borgte sich der Autor vom Schauspieler Richard Widmark, „Stark“ suggerierte – völlig zu Recht – die schnörkellose, gewaltreiche Machart dieses Romans. Bis in die 1970er Jahre veröffentlicht „Richard Stark“ immer neue Parker-Romane. Westlake ist ein guter und schneller Unterhaltungs-Schriftsteller. Jährlich wirft er mehrere Romane auf den Buchmarkt. Unter diversen Pseudonymen versucht er sich in allen Genres, schreibt Science-Fiction, Western, ein Kinderbuch und sogar eine Biografie der Schauspielerin Elizabeth Taylor.
Mühelos meistert Westlake den Spagat zwischen knallharter Action und witzigem Slapstick. Ab 1970 lässt er John Dortmunder sein Unwesen treiben. Wie sein bärbeißiger „Kollege“ Parker hat dieser den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft. Andere Serien hat Westlake dagegen abgeschlossen. Neben dem Schriftsteller Westlake gibt es auch den Drehbuchautor Westlake. Nicht nur eine ganze Reihe seiner eigenen Werke wurden inzwischen verfilmt. Westlake selbst adaptiert für Hollywood Geschichten anderer Autoren. Für sein Drehbuch zu „The Grifters“ (nach Jim Thompson) wurde er für den „Oscar“ nominiert. „Bank Shot“ wurde 1974 unter der Regie von Gower Champion verfilmt (dt. „Klauen wir gleich die ganze Bank!“). Den John Dortmunder spielte – seltsamerweise unter dem neuen Rollennamen „Walter Upjohn Ballentine“ gewohnt fabelhaft George C. Scott.
Nach einer mehr als vier Jahrzehnte währenden, höchst produktiven und erfolgreichen Schriftsteller-Karriere denkt Westlake offensichtlich nicht an den Ruhestand. Er ist aktiv wie eh’ und je und bereichert als höchst lebendige Legende das Krimigenre mit immer neuen, immer noch lesenswerten Beiträgen. Donald E. Westlake hat eine eigene [Website,]http://www.donaldwestlake.com die in Form und Inhalt an seine Romane erinnert: ohne Schnickschnack, lakonisch und witzig, dazu informativ und insgesamt unterhaltsam.
Die Dortmunder-Romane von Donald E. Westlake wurden in Deutschland vom |Ullstein|-Verlag veröffentlicht (freilich nur die ersten vier Bände).
1970: Finger weg von heißem Eis (The Hot Rock)
1972: Fünf gegen eine Bank (Bank Shot)
1974: Jimmy the Kid (Jimmy the Kid)
1977: Jeder hat so seine Fehler (Nobody’s Perfect)
1983: Why Me?
1986: Good Behavior
1990: Drowned Hopes
1993: Don’t Ask
1996: What’s the Worst That Could Happen?
2001: Bad News
2004: The Road to Ruin
Ebenfalls 2004 erschien „Thieves’ Dozen“, eine Sammlung mit Dortmunder-Kurzgeschichten.
Brown, Dan – Illuminati
Der sagenumwobene Orden der Erleuchteten ist zurück, jedenfalls in Romanform. Als Liebhaber von Verschwörungstheorien ist so etwas natürlich genau meine Kragenweite. Geschichte, Mythen und Geheimgesellschaften finde ich extrem faszinierend, vor allem, weil man davon ausgehen kann, dass in allem immer ein Körnchen Wahrheit steckt. Gerade die Illuminaten haben in der Riege der mystischen Kulte einen hohen Stellenwert in der Historie, manche meinen sogar, dass sie selbst heute noch hinter den Kulissen die wahren Weltherrscher sind, die auch das tagesaktuelle politische Geschehen über unsichtbare Kanäle diktieren.
Man mag das glauben oder nicht, es steht jedoch mit Sicherheit fest, dass die Bruderschaft seit jeher ein ausgesprochen konspirativer Haufen gewesen ist, der jede Menge Anlass zu Spekulation bietet. So auch im vorliegenden Roman von Dan Brown, der die Erleuchteten zum finalen Kampf gegen den Vatikan fiktiv auferstehen lässt – mit sehr hohen Erwartungen ging ich das Werk auch an.
_Allgemeines zum Thema_
Wer oder was sind die „Erleuchteten“ denn eigentlich und gab/gibt es sie wirklich? Für die präzisere Beantwortung der Frage muss man schon weiter ausholen: Die Illuminaten (oder korrekter: |Illuminati|) sind/waren ein dem Klerus feindlich gesonnener Geheimbund aus meist hochintelligenten Persönlichkeiten und gehen laut einigen Autoren sogar zurück bis auf den berühmten italienischen Wissenschaftler Galileo Galilei, andere verdächtigen auch den Templer-Orden schon zur Zeit der Kreuzzüge als Wurzel. Belegen lässt sich das nicht exakt, nach offizieller Lesart war der Bayer Adam Weishaupt der erste offizielle Illuminatus und Begründer des Ordens. Den Beweis, dass sie immer noch bis in die Moderne existieren, leiten Konspirologen immer wieder gern von der 1-US$-Note ab. Die Pyramide mitsamt des seltsamen Textes |“Ordo Novus Seclorum – Annuit Coeptis“| und das |Allsehende Auge| sind blitzsaubere Illuminati/Freimaurer-Symbolik und -Rhetorik.
Doch zurück zu den Urvätern der Loge. Im Laufe der Zeit wurden die Mitglieder von der Kirche zu Ketzern und Satanisten abgestempelt, das war insofern leicht, als sie „Luzifer“ (sinngemäß: „Lichtbringer“, von ital.: Luce = Licht) quasi im Namen tragen. Schon damals wirkte plumpe Propaganda Wunder. Waren die Illuminaten ursprünglich aufklärerische Freidenker, mutierte die Organisation von Generation zu Generation in einen regelrechten Kirchenhasser-Verein, dessen Methoden, die christliche Gotteslehre zu untergraben, immer diffiziler und auch drastischer wurden. Weishaupt selbst galt als Fürsprecher eines elitären Denkens und Handelns, was unter anderem die Ausrottung der Schwachen und Dummen beinhaltete. Diese Doktrin haftet dem Geheimbund auch heute noch an. Sofern man daran glaubt.
Etliche Gräueltaten wurden auf beiden Seiten verübt und es entstand eine Jahrhunderte dauernde Fehde zwischen beiden Lagern, bei der es Illuminati immer wieder unerkannt bis in höchste weltliche Ämter schafften oder gar klerikiale Zirkel infiltrierten und dort von innen heraus gegen die Kirche wirkten – auch vor Gewaltakten gegeneinander schreckte man beiderseits nicht zurück. Die direkte Reaktion Roms auf die vermeintliche Gefahr lag in der Inquisition. Was die wenigsten wissen: Die Hexenverbrennungen in dieser Periode waren nur Nebeneffekt (und Deckmäntelchen), primär ging es dem Papsttum wohl eher darum, die Illuminaten und wesensverwandte Gruppierungen auszurotten. Der Orden der „Templer“ soll das berühmteste Beispiel für die vatikanischen Säuberungsaktionen gewesen sein.
Doch die umtriebige Bruderschaft hat es mit List und Verschwiegenheit trotz aller Versuche bis in unsere Zeit geschafft zu überleben. Angeblich. In einem Zug mit den Erleuchteten wird auch häufig das Freimaurertum genannt; wenngleich das nicht dasselbe ist, fanden sich gerade unter diesen Freimaurern häufig Mitglieder des mystischen Ordens. Ob der Geheimbund auch heute noch existiert, ist umstritten. Verschwörungstheoretiker werden das sicher mit einem beherzten |Ja| beantworten. Die offizielle Geschichtsschreibung will davon nichts wissen. Es gibt eine ganze Menge sehr guter Literatur über dieses Thema, sodass ich es bei diesem – zugegeben – recht groben Überblick bewenden lassen will …
Mehr unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Illuminatenorden.
_Zur Story_
Eigentlich ist der Mittvierziger Professor Robert Langdon kein wirklicher Abenteurer, sondern ein biederer Dozent und Experte für religiöse Symbolik an der |University of Harvard|, doch der ominös-nächtliche Anruf des Teilchenphysikers Maximilian Kohler vom Genfer CERN-Institut (Conseil Européen pour la Recherche Nuclaire) soll ihm mehr als nur den Schlaf dieser Nacht vergällen. Was Direktor Kohler ihm per Fax schickt, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: Der berühmte Professor Vetra ist im [CERN]http://de.wikipedia.org/wiki/CERN auf grausame Art umgebracht und gebrandmarkt worden.
Das Ambigramm „Illuminati“ ziert den Brustkorb der Leiche auf dem Fax und Langdon wird |stante pede| nach Genf zitiert – sofort und ohne zu packen steigt er in das ultra-moderne Überschallflugzeug des CERN, welches ihn bereits erwartet. Auf seiner nur gut eine Stunde dauernden Reise in die Schweiz hat Langdon schon mal ein wenig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob die berühmte Bruderschaft nach über 50 Jahren Stillschweigen der Erleuchteten tatsächlich wiederauferstanden sein kann und warum dieser grausame Mord überhaupt begangen wurde. In Genf angekommen, lüftet sich der Schleier nur wenig.
Der undurchsichtige, an den Rollstuhl gefesselte Vollblutwissenschaftler Kohler zeigt dem entsetzten Experten aus den USA die Leiche von Vetra, der mit seiner Adoptiv-Tochter Vittoria an einem hochgeheimen Projekt zugange war: Der Erschaffung von [Antimaterie.]http://de.wikipedia.org/wiki/Antimaterie Nach Eintreffen besagter Tochter wird sehr schnell klar, dass es dem Attentäter und seinem Auftraggeber um genau diese hochbrisante Substanz mit der vielfachen Zerstörungskraft konventioneller Nuklear-Sprengköpfe ging. Das Ziel für die („saubere“) Massenvernichtungswaffe steht kurz darauf auch bereits fest – der Illuminatus will sich am Klerus für all die jahrhundertelange Schmach rächen, welche die Kirche der Wissenschaft angetan hat.
In Rom findet gerade das große Konklave statt (die Papst-Wahl) und daher sind alle ranghohen Kardinäle und Aspiraten auf den Job des Pontifex natürlich anwesend. Dank seines [Hashishin]http://de.wikipedia.org/wiki/Assassinen (Assassinen) hat der Illuminatus den Behälter mit der Antimaterie direkt vor den Augen der päpstlichen Schweizergarde in die Vatikanstadt geschmuggelt, doch er will seinen Triumph noch weiter auskosten: Er entführt die vier meistversprechenden Kandidaten auf den Papst-Titel (die sog. |Preferiti|) und plant sie, einen nach dem anderen medienwirksam abtreten zu lassen. Die einzige Chance, die Kardinäle und den Vatikan zu retten, ist, dem alten, rituellen Initiierungs-Pfad der Bruderschaft zu folgen – ein Pfad, der vor Jahrhunderten von niemand Geringerem als Galileo Galilei und den ersten Illuminaten gelegt wurde …
_Meinung_
Vom Start weg weiß „Illuminati“ zu gefallen, der kurze Prolog lässt bereits erahnen, was da alles kommen mag und spätestens, wenn Dan Brown respektlos den ersten hochangesehenen kirchlichen Würdenträger brutal über die Klinge springen lässt, ist man sich nicht mehr sicher, ob die verbliebenen drei Kardinäle die Sache heil überstehen. Ganz zu schweigen von der enormen Antimaterieladung unter dem Vatikan, welche im Umkreis von knapp einem Kilometer alles in einem grellen Lichtblitz pulverisiert, sollte der Behälter nicht innerhalb von insgesamt sechs Stunden aufgespürt werden. So entwickelt sich der anfängliche, rätselhafte Mordfall zu einem teils überaus dogmatisch geführten Überlebenskampf zwischen Kirche, Wissenschaft und Medien.
Bei der Hetzjagd durch Rom und der Spurensuche in alten Archiven sitzt den Protagonisten die Uhr zudem ständig im Nacken. Außer bei den beiden Hauptcharakteren (Robert Langdon und Vittoria Vetra) vermag man zwischendrin nie zu sagen, auf welcher Seite so mancher Handelnde eigentlich steht. Alle Figuren sind gut und lebendig ausgearbeitet, der Schreibstil ist locker, somit ist der Roman trotz der 640 Seiten keine allzu schwere aber dafür umso unterhaltsamere Kost – auch für Gelegenheitsleser.
Die archaischen Puzzles, die es zu lösen gilt, sind intelligent gemacht und verraten seitens des Autorsviel Kenntnis über die Thematik der Bruderschaft und die Strukturen des Vatikans. Er verflechtet hier gekonnt geschichtliche und wissenschaftliche Tatsachen mit Zukunftsmusik, natürlich ist die Geschichte frei erfunden und dürfte sich in dieser Form wohl kaum abspielen, logische Fehler konnte ich jedoch nicht ausmachen und das will bei mir notorischem Nörgler schon etwas heißen.
Ich bin der Thematik ja ohnehin nicht abgeneigt und wie der Autor auch schon im Vorwort erwähnt, stimmen die Örtlichkeiten, die physikalischen Grundlagen und die Historie des Vatikans und auch der Illuminati an sich, das hat er gut recherchiert und gekonnt zusammengefügt. Ein paar Begriffe aus der Mythologie und einige Brocken Italienisch und Latein sind vorteilhaft, diese Dinge werden teilweise unkommentiert stehen gelassen, was, wie ich finde, der Atmosphäre sehr dienlich ist. Der deutsche Übersetzter hat es sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, einige Fußnoten einzufügen, wenn er der Auffassung war, dass einige Begriffe dennoch einer Erklärung bedürfen. Netter Service.
Die aufkeimende und beinahe unvermeidliche Romanze zwischen Robert und Vittoria stört die Geschichte nicht und schwelt dankenswerterweise nur latent im Hintergrund und gleitet nicht in Schnulz & Kitsch ab, das hätte ich Dan Brown auch nicht verziehen. So mutet der Roman ein wenig wie Indiana Jones (speziell: „The Last Crusade“) und einige der guten alten „Drei ???“-Storys an, bei denen es knackige Text-, Logik- und Bilder-Rätsel zu lösen gibt und durch Kombinationsgabe erst am Ende ein Täter feststeht. Gestorben wird auch, und das recht gemein und blutig à la „Sieben“ oder „Resurrection“.
Langdon ist jedoch weit von den Allüren eines Actionhelden entfernt (dem Assassinen ist er körperlich zu hundert Prozent unterlegen und kriegt von dem auch mächtig die Hucke voll) und irrt auch gern mal mit seinen Vermutungen, das macht die Figur menschlich und sympathisch. Vittoria ist ein sehr starker Charakter und bestimmt nicht die berühmte Quotenfrau bzw. der Hauptpreis für den Helden am Ende (mit Sonnenuntergang und all dem Trallala). Sie steuert dank ihrer Orts- und Sprachkenntnis eine Menge bei, außerdem ist sie als Teilchenphysikerin als Einzige mit dem Antimateriekanister vertraut, den sie auch zusammen mit ihrem Daddy entworfen hat.
_Fazit_
Ein äußerst kurzweiliger und rasanter Roman, der auf beeindruckende Art Realität und Fiktion zusammenfügt und am Ende ziemlich unvorhergesehen ausgeht, da Dan Brown es versteht, Nebelkerzen zu werfen und den wahren Hauptschuldigen effektiv bis fast vor Schluss zu verschleiern. Nur wer auf den Punkt genau liest und richtig kombiniert, dem fallen inmitten der Story schon einige Sachen ins Auge, die auf den wahren Initiator dieser von Morden durchzogenen wilden Hatz durch Rom hinweisen. Nebenbei lernt man sogar eine ganze Menge Wissenswertes über (Kunst-)Geschichte.
Dank der flüssigen Erzählweise des Autors fällt es leicht das – zugegeben – etwas dickere Buch komplett durchzuziehen. Das Teil und auch sein Nachfolger „Sakrileg“ gehören endlich verfilmt – es ist eine Schande, dass sich dafür noch kein Filmemacher ereifert hat, denn die beiden um Dr. Robert Langdon gesponnenen Geschichten haben das Potenzial zu richtigen Blockbustern. Wobei ich „Illuminati“ noch als einen Tick besser und origineller empfinde. Klare Lesempfehlung für (noch nicht-)Freunde des intelligenten Thrillers.
http://www.danbrown.com
Jonathan Latimer – Der enthauptete Großonkel
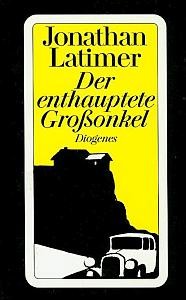
Jonathan Latimer – Der enthauptete Großonkel weiterlesen
Gardner, Erle Stanley – Furien im Finstern
Bertha Cool, schwergewichtige Chefin einer kleinen Detektei, ist noch missgestimmter als üblich. Ihr Partner Donald Lam hat sie versetzt – so sieht Berta das – und sich der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika angeschlossen: Die Welt befindet sich in diesem Jahr 1942 im Krieg, und Lam will seine Bürgerpflicht erfüllen.
Für solchen Idealismus hat Berta Cool kein Verständnis. Sie muss feststellen, wie sehr ihr der gewitzte Lam im Geschäft fehlt. Ihrer Geldgier tut dies keinen Abbruch, aber sie sieht sich gezwungen, jetzt wieder selbst auf der Straße Detektivarbeit zu leisten. Schlimmer noch: Der aktuelle Auftrag, der zunächst nach leicht verdientem Lohn aussah, übersteigt womöglich Bertas kriminalistische Fähigkeiten!
Der blinde Straßenhändler Rodney Kosling hat sie engagiert. Ihm ist ein merkwürdiger Unfall aufgefallen: Josephine Dell, eine junge Frau, mit der er regelmäßig an seinem Stand zu plaudern pflegte, wurde von einem Wagen angefahren und vom Unfallfahrer mitgenommen. Seitdem ist sie verschwunden. Kosling macht sich Sorgen und möchte die Frau suchen lassen.
Menschenfreunde sind Berta stets verdächtig. Trotzdem übernimmt sie den Fall, der sich rasch als heikel entpuppt. Zwar findet sie Josephine Dell, aber viel interessanter findet sie den plötzlichen Tod des alten Harlow Milbers. Der war Josephines Arbeitgeber und außerdem schwer reich. Er hinterlässt ein seltsames Testament, das seine Haushälterin und deren Familie begünstigt. Milbers einziger Verwandter, sein Neffe Christopher, ist darüber wenig erfreut. Ist das Testament gefälscht? Wenn Berta dies nachweisen kann, winkt ihr ein hohe „Gewinnbeteiligung“!
Aber es ist wie verhext: Was Berta auch einfädelt, es geht schief. Ständig stolpert sie über den undurchsichtigen Versicherungsbetrüger Jerry Bollman – und schließlich über dessen Leiche. Für den misstrauischen Polizisten Sellers ist Berta die Hauptverdächtige. Ihre Bemühungen, sich zu rehabilitieren und trotzdem ihren finanziellen Schnitt zu machen, setzen eine verhängnisvolle Kette kriminalistischer Verwicklungen in Gang, die Wahrheit und Lüge immer fester verstricken, bis Berta sich in diesem Netz unrettbar zu verstricken droht …
Privatdetektive sind üblicherweise taffe Burschen, die vielleicht hier und da irren (oder übers Ohr gehauen werden), aber spätestens im Romanfinale vom Holzweg auf die Straße der Wahrheit einbiegen. Sie verstehen ihren Job, lassen sich nicht schrecken oder bestechen, folgen unbeirrbar ihrer Spur.
Genau das geschieht hier eben nicht. „Furien im Finstern“ (den dümmlichen deutschen Titel verdankt das vorliegende Werk dem zeitgenössischen Ullstein-Drang zur „Originalität“) ist im Grunde eine 160-seitige Umkehr der meisten Detektivkrimi-Klischees. Hier beobachten wir eine Schnüfflerfrau, der es an Energie und Furchtlosigkeit nicht mangelt. Leider kann ihre kriminalistische Fachkenntnis da nur bedingt mithalten. Außerdem vernebelt ausgeprägte Geldgier das Gespür und übertüncht Anzeichen, die einen Philip Marlowe längst gewarnt hätten, dass da etwas faul ist.
Aber Bertha Cool will nicht Gerechtigkeit, sondern Bares. Mit dem Eifer und dem diplomatischen Geschick einer Abrissbirne fällt sie über ihre Klienten her. Sie ist sich keineswegs zu schade, mit windigen Betrügern um Prämien zu rangeln. Was ihr dabei entgeht: Sie reiht sich nahtlos in einen Reigen mehr oder weniger geschickter Betrüger und Erbschleicher ein.
Mit faszinierender Sicherheit spinnt Autor Gardner sein Netz. Gauner gegen Gauner, die Fronten ändern sich ständig. Finstere Pakte werden geschlossen und sofort gebrochen. Wer gestern noch gegeneinander kämpfte, tut sich heute womöglich zusammen – und umgekehrt. Berta Cool mischt da skrupellos tüchtig mit.
Der Witz an der Sache ist ihre Blindheit dafür, wie sie, die mächtig ihre Klienten, Zeugen und die Polizei manipuliert, selbst in diverse Intrigen verwickelt wird, ohne es zu bemerken. Da ist es nur gut, dass Donald Lam während eines kurzen Heimaturlaubs den kunstvoll verwickelten Fall aufzudröseln vermag.
Bis es so weit ist, hat der Leser einen Riesenspaß gehabt, denn er (und sie) ist zusammen mit Berta Cool tüchtig an der Nase herumgeführt worden. Die Mosaiksteinchen purzeln an ihre Plätze und enthüllen wider Erwarten ein logisches Gesamtbild. Wieder einmal bestätigt sich, dass die Cool/Lam-Romane so sauber geplottet sind wie Gardners Perry-Mason-Krimis. Trotzdem können sie womöglich noch besser gefallen, denn sie verfügen über eine angenehme Zusatzeigenschaft: Sie sind humorvoll. Damit ist nicht einmal der Slapstick-Witz der dampfwalzenartig auftretenden Bertha Cool gemeint. Vor allem weiß die ausgetüftelte Story zu gefallen, die den Namen „Krimikomödie“ verdient. Der Autor arbeitet zudem mit trockenem Wortwitz, der sogar die Übersetzung überlebt hat.
Mit Berta Cool ist Erle Stanley Gardner ein echter Klassiker gelungen, der sich ins Gedächtnis der Leser eingräbt. Selbstverständlich könnten politisch korrekte Spielverderber allerlei Einwände gegen diese Figur erheben: Berta ist ein wandelndes Klischee, zwar tüchtig, aber dick (= geschlechtslos), grob, laut und gierig. Grandios setzt sie ihren Fall in den Sand und muss von ihrem (männlichen) Partner gerettet werden, der selbst aus weiter Ferne zum Kern des Lügengespinstes durchdringt.
Wir sparen uns an dieser Stelle hochphilosophische Überlegungen darüber, ob Gardner sich eine selbstständige und erfolgreiche Frau etwa nur als Karikatur vorstellen kann. Nehmen wir stattdessen an, dass er einfach eine schräge Type entwarf, um seine Romane um die Detektei Cool & Lam möglichst interessant zu gestalten. Schließlich sind die anderen Figuren auch nicht gerade aus dem Leben gegriffen.
Außerdem kann Gardner einen dicken Pluspunkt kassieren: Seine Bertha Cool ist kein Engel mit goldenem Herzen, das sich unter der rauen Schale verbirgt. Bertha ist tatsächlich ein lupenreines Miststück, das zu Mitgefühl und Hilfsbereitschaft regelmäßig überlistet werden muss. Wenn sich ihr Geiz dann gegen sie wendet, stellt Gardner das nie als „gerechte Strafe“ eines moralinsauren Schicksals dar. Berta fällt der (blinden) Tücke des Objekts anheim, was sehr viel überzeugender wirkt.
Der eigentliche Kriminalist des Teams ist ohnehin Donald Lam. Berta Cool weiß trotz ihrer ewigen Verbalattacken sehr gut, was sie an ihm hat, ohne dass sie sich dadurch nachgiebiger zeigen würde. Lam nimmt Bertha wie sie ist, was wohl die einzige Möglichkeit für eine fruchtbare Zusammenarbeit bietet.
Normalerweise ist Lam wie gesagt für die eigentliche Detektivarbeit zuständig. Er ermittelt vor Ort, während Bertha Cool in der Regel im Hintergrund wirkt, um von dort regelmäßig nach vorn zu drängen, wenn die Handlung der humorvollen Auflockerung bedarf. „Furien im Finstern“ stellt insofern eine Abweichung von der goldenen Regel dar, nach der die Leser einer Serie Veränderungen des gewohnten Schemas hassen. Gardners Rechnung geht indes auf: Bertha Cool trägt „ihren“ Roman spielend. Man wünscht sich sogar mehr Geschichten mit ihr im Mittelpunkt.
Erle Stanley Gardner wurde am 17. Juli 1889 in Malden, Massachusetts geboren. 1909 begann er Jura zu studieren. Dass er kein Bücherwurm war, belegt u. a. die Tatsache, dass ihn die Valparaiso University im US-Staat Indiana wegen einer Schlägerei hinauswarf. Gardner liebte den sportlichen Kampf; er boxte und arrangierte sogar illegale Ringkämpfe.
1910 eröffnete er seine erste eigene Kanzlei in Kalifornien. Aber das Geschäft ging schlecht, so dass Gardner auch als Handlungsreisender arbeiten musste. Außerdem entdeckte er die „Pulps“, billige Magazine, die in den 1920er aufkamen und einen unstillbaren Hunger auf Science-Fiction-, Horror-, Western- und Kriminalkurzgeschichten entwickelten. Gardner verfasste unter Pseudonymen wie A. A. Fair, Carleton Kendrake oder Charles J. Kenny eine Flut von Storys, u. a. für das berühmte „Black Mask Magazine“. Jeden dritten Tag trug er eine neue Geschichte zur Post, zwischen 1921 und 1933 verfasste er durchschnittlich eine Million Wörter pro Jahr – kein Wunder, dass er sich 1932 ein Diktaphon zulegte und seine Geschichten nunmehr diktierte und abtippen ließ.
1933 verfasste Gardner seinen ersten Roman, der gleichzeitig das Debüt Perry Masons wurde. Dieser war erfolgreich und bildete den Auftakt einer insgesamt 82-teiligen Serie, die bis 1973 lief. Trotzdem war Gardner ständig in Geldnöten. Deshalb reaktivierte er 1939 das Pseudonym A. A. Fair und erfand das ungleiche Detektivpaar Bertha Cool und Donald Lam, die bis 1970 29 ebenfalls sehr beliebte Abenteuer erlebten. Außerdem verfasste er neun Folgen einer weiteren Serie
Als Jurist blieb Gardner weiterhin aktiv. 1948 gründete er den „Court of Last Resort“, der Personen unterstützte, die womöglich einem Justizirrtum zum Opfer gefallen waren. Tatsächlich verhalf diese Einrichtung einer ganze Reihe von Unglücklichen zu Freisprüchen.
Hoch geehrt und von seinen Fans weiterhin treu gelesen, verstarb Erle Stanley Gardner – bis zuletzt fleißig diktierend – am 11. März 1970 auf seiner Farm in Temecula in Kalifornien.
Peter Millar – Schwarzer Winter
Theresa „Therry“ Moon, pflichtbewusste Nachwuchs-Reporterin der „Oxford Post“, kennt die inoffiziellen Absprachen und Mauscheleien, mit denen die örtliche Prominenz in Politik und Wirtschaft dafür sorgt, dass gutes Geld nicht an schafgleiche Bürger oder gar an das Pack der Armen und Chancenlosen verschwendet wird. Besonderes Augenmerk richtet Therry auf den windigen Bauunternehmer Geoffrey Martindale. Der lässt gerade ein ganzes Stadtviertel neu aus dem Boden stampfen. „Nether Ditchford“ soll die Siedlung heißen, eine Erinnerung an das verschwundene Dorf, das hier im Mittelalter stand. Dieser Auftrag ist lukrativ, Martindale skrupellos und aus seiner Sicht über das kleinliche Gesetz erhaben. Außerdem hat er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt; scheitert das Projekt, ist Martindale erledigt.
Doch Seltsames geht vor in Nether Ditchford. Obdachlose und Landstreicher werden aufgegriffen, die Symptome einer mysteriösen Krankheit zeigen, die sie grässlich verenden lässt. Man könnte meinen, sie seien der Pest zum Opfer gefallen, aber die ist in Europa schon lange ausgerottet. Der junge Assistenzarzt Rajiv Mahendra kennt die Pest aus seiner indischen Heimat, und der US-amerikanische Student Daniel Warren ist bei seinen Archivstudien auf eine Pfarrchronik aus Nether Ditchford gestoßen, in der geschildert wird, wie Anno 1349 praktisch die gesamte Bevölkerung an der Pest starb und in Massengräbern beigesetzt wurde.
Offenbar gibt es eine unheilvolle Verkettung zwischen den Todesfällen von einst und jetzt. Rajiv und Daniel, zu denen rasch Therry stößt, gehen der Frage nach, ob Martindale buchstäblich die Büchse der Pandora geöffnet hat, dies aber nun unterdrückt, um sein Bauprojekt nicht zu gefährden. Angesichts der Intensität, mit der plötzlich Mietmörder unser Trio verfolgen, spricht viel für diese Annahme …
Wir basteln uns einen Bestseller
Im herangereiften 21. Jahrhundert hat auch der Laie begriffen, dass unterhaltende Filme und Literatur wie Presspappe oder Gartenmöbel produziert werden. Die Spaßfabrikanten definieren „Kreativität“ als Versuch, aus dem nur unter Risiken zu befahrenden Meer der populären Unterhaltung die bewährten Elemente erfolgreichen Profitstrebens abzufischen, um diese Beute dann zu einem hoffentlich garantierten Blockbuster zu verleimen.
Was im Kino klappt, ist auch in der Literatur nicht unbekannt. Peter Millar führt es uns geradezu lehrbuchhaft vor. Er bedient sich einerseits aus dem Genre Historien-Roman, dessen Popularität ungebrochen ist. Ebenfalls gut im Trend (und nicht allzu lange in den Buchläden) liegen Wissenschaftsthriller, unter denen diejenigen besonders zahlreich sind, die tapfere Mediziner und neugierige Journalisten im Kampf gegen machtgeil-gierige Großkonzerne, irre Attentäter und scheußlich-gefährliche Weltuntergangs-Epidemien zeigen. Folgerichtig rührt Millar einen Arzt und einen Historiker in sein Romangebräu – vor allem der einst im Archivstaub wühlende Buchwurm hat in den letzten Jahren seine Thriller-Tauglichkeit bei der Aufdeckung zahlloser Vatikan-Verschwörungen unter Beweis gestellt. Hinzu kommt eine hübsche Frau, hier Journalistin, was berufsmäßige Neugier impliziert, die mordlüsterne Dunkelmänner garantiert und spannungsförderlich anzieht.
Was kann jetzt noch schief gehen? Zunächst einmal nichts, wenn man sich mit der Lektüre eines Abenteuers aus zweiter Hand begnügen möchte. Die Ausgangssituation verspricht durchaus einiges. Auch heute erzeugt allein der Klang des Wortes „Pest“ eine Gänsehaut; es scheint da so etwas wie eine kollektive Erinnerung zu geben. Dass es dafür Gründe gibt, lässt Millar erklärend einfließen: Allein zwischen 1347 und 1351 hat die Seuche in Europa schätzungsweise 25 Millionen Menschen getötet. Das war ein Drittel der damaligen Gesamtbevölkerung!
Der Autor als Thriller-Killer
Somit hat Millar eine wirkungsvolle Bedrohung aus der Vergangenheit als Aufhänger entdeckt. Jetzt geht er daran, den Pestschrecken in die Gegenwart zu tragen. Das ist gar nicht so einfach, denn das einstige Verderben ist heute heilbar. Kontinentweite Seuchenwellen können verhindert werden. Nur die Pestgruben von Nether Ditchford aufreißen zu lassen, genügt folglich nicht.
Deshalb konstruiert Millar ein Szenario, in dem die Pest erst einmal unbemerkt bleibt, damit sie sich ausbreiten kann. Dafür ist ihm nichts Besseres eingefallen als der Auftritt des weidlich bekannten Schlipsschurken, der Geld & Macht um jeden Preis ergattern will. Um sich schart er die üblichen Verdächtigen, d. h. eiskalte Killer & tumbe Totschläger.
Ihnen in den Weg stellen sich die ‚Guten‘. Sie sind idealistisch, jung, ansehnlich und tragen diese Eigenschaften quasi auf die Stirn tätowiert. Das ist auch wichtig, damit sie wenigstens ein bisschen Profil gewinnen. Denn Daniel, Therry & Rajiv haben als Figuren etwa so viel Substanz wie die Zappelmänner und -frauen deutscher TV-Thrillerserien. Sie denken und reden ausschließlich in Klischees, weil Verfasser Millar offensichtlich fürchtet, dass Originalität das möglichst breite Publikum verschrecken könnte.
Jede Figur ist auf ihre Art eine Zumutung. Daniel, der ‚Historiker‘, muss den schlauen aber versponnenen Träumer mimen, der in der Welt der Vergangenheit aufgeht. Das ist praktisch, da er mit traumwandlerischer Sicherheit jedes für die Handlung bedeutsame Dokument finden, jede Inschrift entziffern & jede mittelalterliche Analogie deuten kann. Der reale Wissenschaftler kann da nur neidisch werden.
Therry ist eine dieser politisch korrekten Überfrauen, die das Kino oder die Unterhaltungsliteratur minderer Güte terrorisieren. Selbstbewusst, ganz im Hier & Jetzt beheimatet, gesellschaftskritisch, selbstverständlich hübsch, aber deshalb erst recht tüchtig, nebenbei auf der Suche nach Mr. Right (Preisfrage: Wem wird in unserer Geschichte diese zweifelhafte Ehre zufallen?) und auch sonst eine schreckliche Nervensäge.
Unfug mit Botschaft
Darüber hinaus zwingt MillarTherry zu nicht endenden Tiraden über die Zersiedlung urbritischer Landschaftsidyllen. Wie besessen lässt er sie über skrupellose Bauunternehmer und Immobilienhaie wettern, die gute englische Wälder und Wiesen mit hässlichen, eigentlich unnötigen Neubausiedlungen überziehen. Mit Zahlen und ‚Beweisen‘ wird der Leser traktiert, den das herzlich wenig interessiert – wozu auch, da es mit der eigentlichen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat?
Rajiv tritt auf, weil „Schwarzer Winter“ aus einleuchtenden Gründen einen Mediziner im Team benötigt. Assistent muss er sein, weil er so zwar viel wissen aber wenig ausrichten kann. Außerdem ist Rajiv Inder und taugt deshalb als Proporz-Ausländer, was eine mögliche Verfilmung realistischer werden lässt. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt Millar damit, dass Rajiv ‚zufällig‘ daheim Erfahrungen mit der Pest sammeln konnte.
Bleiben die Schurken in diesem Spiel. Ach, sind Mr. Millars Bösewichte böse! Man zittert vor Angst – oder vor Lachen (Reaktionsvariante 3: Verdruss). Es ist zu putzig, wie uns der Verfasser Geoffrey Martindale als kultivierten Teufel weismachen möchte. Die Welt des Weißkragen-Verbrechens ist nach Millar höchst simpel strukturiert; er bezieht seine Kenntnisse offenbar aus dem Studium diverser John-Grisham-Verfilmungen. Weil das Böse à la Hollywood stets irgendwie übermenschlich daherkommt, reden, handeln und killen Martindale und seine Schergen in einem quasi rechtsfreien Raum. Die Polizei hält sich freundlicherweise zurück, damit Martindales Finsterlinge und unsere drei Musketiere ungestört ihre Klingen kreuzen können, bis endlich das vor allem durch seine papierraschelnden Nicht-Dramatik eindrucksvolle Finale kommt und dem unterhaltungsarmen Spuk endlich ein Ende bereitet.
Autor
Peter Millar gehört zur Gruppe jener Journalisten, die eines Tages beschließen, die Früchte ihres aufregenden Berufsalltags zu ernten bzw. in blanke Münze zu verwandeln. Wer zu den Brennpunkten der Weltgeschichte reist und darüber schreibt, hält sich ebenso oft wie fälschlich dazu prädestiniert, ein spannendes und glaubhaftes Garn zu spinnen.
Millar ist im Auftrag der „Sunday Times“ oder des „Evening Standard“ in der Tat weit herumgekommen: Berlin, Moskau, Paris, Brüssel listet die Kurzvita des Bastei-Verlags als Wirkungsstätten auf. Auch in Osteuropa ist er journalistisch aktiv gewesen. 1992 fasste er seine Erlebnisse während des Mauerfalls in einem Buch mit dem verheißungsvollen Titel „Tomorrow Belongs to Me: Life in Germany Revealed as Soap Opera“ zusammen. Diesen Erfahrungen verdanken wir außerdem den Histo-Thriller „London Wall“ (2005; dt. „Eiserne Mauer“).
Im Spionagemilieu ließ Millar 2000 seinen ersten Thriller spielen. „Stealing Thunder“ (dt. „Gottes Feuer“) bietet die übliche Holterdipolter-Hetzjagd zu Wasser, zu Lande und in der Luft, während ein historisch brisantes Rätsel – hier im Umfeld der ersten Atombombe – gelöst werden muss.
Mit seiner Familie lebt Millar in London sowie in Oxfordshire. Dort ist er – übrigens ein geborener Nordire – auch aufgewachsen, was das (Zuviel an) Lokalkolorit in „Schwarzer Winter“ erklärt.
Über seine Arbeit informiert (eher nicht) Millars (offenbar irgendwo im Rohbau steckengebliebene) Website.
Taschenbuch: 445 Seiten
Originaltitel: Bleak Midwinter (London : Bloomsbury 2001)
Übersetzung: Ulrike Werner-Richter
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: 


Palliser, Charles – schwarze Kathedrale, Die
In letzter Zeit habe ich es offensichtlich mit Romanen, die im kirchlichen Umfeld stattfinden, schon wieder fand ein solcher den Weg in meine Hände. Dank des anstachelnden Klappentexts machte „Die schwarze Kathedrale“ einen überaus interessanten Eindruck. Im Original heißt der Roman übrigens wesentlich treffender |“The Unburied“| nämlich: „Der (oder Die) Unbegrabene(n)“, was der Handlung auch eher gerecht wird. Über misslungene deutsche Titelverballhornungen rege ich mich aber schon lange nicht mehr auf. Solange der Inhalt mich zu fesseln vermag, ist das eher zweitrangig, doch frage ich mich schon gelegentlich, welch Geistes Kinder sich die teils beknackten Eindeutschungen einfallen lassen.
_Zur Story_
Dr. Edward „Ned“ Courtine, seines Zeichens Referent und Lehrer für anglikanische Historie in Cambridge schlägt in der Vorweihnachtszeit 1881 gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Er hat schon lange seinem Ex-Studienkollegen und altem Freund Austin Fickling versprochen, ihn in dessen Wahlheimat Thurchester zu besuchen. In der englischen Kleinstadt befindet sich zudem eine berühmte Kathedrale, in deren Bibliothek er ein bestimmtes Manuskript zu finden hofft, das seine Theorie über den mittelalterlichen König Alfred stützt. Wenn er das Manuskript tatsächlich findet, kann er das von einigen seiner Kollegen gehegte Bild der anglikanischen Geschichte ändern und ihm sogar einen Lehrstuhl einbringen.
Außerdem will Courtine sowieso über Weihnachten zu seiner Nichte und Thurchester liegt genau auf dem Weg, was liegt also näher, als all das miteinander zu verquicken und einen einwöchigen Zwischenstopp dort einzulegen? Er und Fickling haben sich nach einem Streit vor 20 Jahren nicht mehr gesehen und das Wiedersehen verläuft sehr seltsam, Courtine wirft seinem ehemaligen Kumpel (wenngleich er das nicht zeigt) insgeheim immer noch vor, ihn und seine Frau damals auseinander gebracht zu haben.
Das Warum und Wieso bleibt zunächst im Dunkeln, Courtines Wunden reißen schon allein wegen Ficklings sehr komischem und widersprüchlichem Verhalten alsbald wieder auf. Jeder in dieser provinziellen und kleinbürgerlichen Stadt scheint irgendwas zu verbergen zu haben, des Weiteren sind sich die Bewohner untereinander alle nicht wirklich grün. Gerüchte, Getuschel und teils offene Anfeindungen sind quasi an der Tagesordnung – da gönnt der eine dem anderen nicht die Wurst auf dem Brot.
Courtine hat als Außenstehender einen erhabenen Blick auf diese Leute, doch muss er sich mit allen gut stehen, schließlich möchte er ja freien Zugang zur Bibliothek haben. Gleichzeitig will er herausfinden, welches Geheimnis seinen alten Freund Austin umgibt, der sich mal aufgekratzt, mal wortkarg schroff gibt und öfters des Nächtens wer-weiß-wohin verschwindet. Bald geht es rund um die geschichtsträchtige Kathedrale aber nicht mehr um persönliche Animositäten, nicht um alte historische Folianten, nicht um rätselhafte Schauergeschichten aus der Geschichte des Bauwerks, sondern um handfesten Mord an einem Banker und das Auftauchen des Leichnams eines verschwunden geglaubten Mörders direkt aus der Vergangenheit in der Kathedrale selbst …
_Meinung_
Was sich schön düster und mysteriös-spannend anhört, ist in Wahrheit sehr dröge präsentiert, dabei fängt der eigentliche Roman mit einem guten Flair an. Ein verwunschenes Kleinstädtchen auf dem Land mit schrulligen Bewohnern und einer gespenstischen Kirche, die von Nebel umwabert ein schreckliches Geheimnis trägt, sogar eine ominöse Kapuzengestalt (angeblich ein ruheloser Geist) lustwandelt über den Kathedralenvorplatz. Das klingt ganz verlockend nach Altmeister Edgar Wallace.
Leider verliert sich Palliser alsbald in seitenlangem Geschwafel von Courtines Theorie über König Alfred, sein Verhältnis zu Austin Fickling und den Begebenheiten, die sich rund um das alte Gemäuer ranken – immer wenn ich dachte, jetzt käme der Clou oder es würde endlich der entscheidene Hinweis geliefert, wurde ich enttäuscht. Denn kaum etwas von dem überflüssigen Geschreibsel ist später von Bedeutung. Der Lesespass wird dadurch ganz erheblich gebremst und ich konnte mir ein zähneknirschendes: „Komm endlich zur Sache, Kerl!“ kaum verkneifen.
Schlicht gesagt, es passiert nichts Weltbewegendes, bis fast gegen Ende und dann muss sich der Autor Mühe geben, die unnötig verworrenen Stränge zu einem Abschluss zu bringen. Selbst der Mord an dem sonderlichen Bankier und das Auffinden einer eingemauerten Leiche in der Kathedrale finden erst im letzten Drittel statt und können diese Provinz-Posse auch nicht mehr retten. Das Bild der Stadt und seiner Bewohner porträtiert Palliser sehr genau – |zu| genau, um ehrlich zu sein, denn im Endeffekt ist es für den Mordfall ziemlich irrelevant, der (ich bin mal so frei und spoiler hier ein wenig) nach dem Hauptteil der Geschichte ungesühnt und (fast) ungeklärt bleibt. Stattdessen werden Courtines persönliche Probleme mit Austin breit getreten und die viktorianische Gesellschaft um diese Zeit aufs Korn genommen (das allerdings sehr trefflich) … Gesellschaftliche Zwänge, wer mit wem und wer nicht und immer wieder Verweise auf die ollen Kamellen der Vergangenheit.
Zum besseren Verständnis muss ich aber die Gliederung heranziehen: Der Anfang des Buches findet um 1920 herum statt (nach dem virtuellen Tod von Dr. Courtine), es ist ein kurzer Vorgriff auf die eigentliche Handlung, die erst nach dieser Einlage kommen wird. Der „Bericht“ über die Vorfälle ist in der Ich-Form geschrieben und stellt die Geschehnisse aus der Sicht von Courtine dar, wie er sie fiktiv „erlebt“ hat. Nach dem Augenzeugenbericht folgt dann der Epilog, in welchem dann die letzten Puzzle-Teile an ihren Platz kommen, gefolgt von einem ausführlich geschilderten (visionären) Traum, den die Hauptfigur hatte (wie überaus ergreifend) und einem bitter nötigen Namensregister aller beteiligten Figuren.
Ich mag solche Geschichten ohnehin nicht sonderlich, bei denen schon von vornherein feststeht, dass mittendrin alles nur Geplänkel ist und der Kracher erst im Epilog aus dem Hut gezogen wird. Leider gibt es – oops! – aber gar keinen wirklichen Kracher und die endgültige Auflösung des lieblos inszenierten Rätsels (Welches Rätsel, die Auflösung war so was von offensichtlich!?) ist reine Makulatur. Was habe ich aus dem Roman gelernt? Briten sind spießbürgerlich von einer geradezu perfiden Höflichkeit beseelt, leben bevorzugt im Nebel (auch und gerade dem der Vergangenheit), lieben Gespenster und ungenießbares Essen. Na toll, auch |das| wusste man schon vorher.
_Fazit_
Mal Butter bei die Fische: Streckenweise ist des Buch ganz interessant und hat einige gute Ansätze, die Palliser – als regelrechte Spaßbremse – aber gleich wieder ruiniert, da hätte man wesentlich mehr draus machen können, um den anfänglichen Spannungsbogen auch konstant aufrecht zu erhalten. Die wirklich guten und akribischen Charakterisierungen der viktorianischen Kleinstadt-Gesellschaft und ihres (Un-)Rechtssystems können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem Plot massig an |pace| fehlt.
Zudem ist die Sache ziemlich leicht zu durchschauen, ich hatte mir nach nicht mal der Hälfte schon meine Theorie zurechtgelegt, die bedauerlicherweise erwartungsgemäß in beinahe allen Punkten zutraf – kein Ruhmesblatt für einen ausgewiesenen Thriller. Erschwerend kommt die akademisch-schwülstige „Von-Oben-Herab“-Schreibweise hinzu, die wohl Absicht ist, doch einem mit der Zeit ordentlich auf den Senkel geht, da sie die ohnehin schon langatmige Geschichte weiter unnötig verkompliziert und in die Länge zieht. Das dürfte vor allem Gelegenheitsleser sicher abschrecken. Eine (bedingte) Empfehlung spreche ich trotzdem aus, der Unterhaltungswert war mir trotz einiger guter Ansätze im Gesamtbild aber doch zu lau.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Original-Titel: „The Unburied“
Genre: Viktorianischer Krimi
Ersterscheinungsjahr: 1999 (Phoenix House / London)
Deutsche Übersetzung: Sigrid Langhaeuser
Erschienen: 2000 (Droemer / München)
Format: Hardcover / 480 Seiten
oder Taschenbuch (Neuauflage 2002)
ISBN: 3-426-19496-1 (HC)
ISBN: 3-426-61995-4 (TB)
Buttler, Monika – Herzraub
In „Herzraub“ befasst Monika Buttler sich mit der Thematik der Organspende. Durch sorgfältige Recherche und einer gehörigen Portion Sachverstand versteht es die Medizinredakteurin, die Problematik der Explantation (Organspende) beängstigend und eindrücklich zu schildern, ohne dabei in einen reißerischen Erzählstil zu verfallen. Dabei wäre ihr fast ein erstklassiger Wissenschaftsthriller gelungen, hätte sie nicht versucht, das Ganze in einem altmodischem Krimi zu verpacken. Der Versuch, knallharte medizinische Fakten und Schicksale mit den üblichen Zutaten eines Krimis zu vermischen, verursacht in „Herzraub“ am Ende des Romans ein eher schales als befriedigendes Gefühl im Leser.
Zunächst geht es um den Mord an der bekannten Schauspielerin Celia Oswald, die vor zwei Jahren ein Spenderherz und damit ein zweites Leben erhielt. Nun wurde ihr dieses Herz gestohlen. Ein Spaziergänger findet ihre Leiche im Klövensteener Forst, dem Hamburger Stadtwald. Hauptkommissar Werner Danzig und sein Partner Torsten Tügel fangen an, in diesem bizarren Mordfall zu ermitteln. Verdächtig sind natürlich zunächst die engsten Angehörigen: ihr Lebensgefährte Marco Steinmann, ihr Exmann Claus Saalbach und ihr Sohn Alexander. Vorstellbar wäre aber auch, das der Täter aus dem Umfeld der Organspende zu finden ist: ein enger Angehöriger eines Organspenders oder ein Herzkranker, der zu Gunsten von Celia Oswald bei der Organspende übergangen wurde. Motive gibt es viele, doch zunächst tappen die Ermittler trotz der Hilfe der Wissenschaftsjournalistin Laura Fleming, die an einem Buch über Organspende arbeitet, im Dunkeln, auch ein anonymer Tipp führt ins Leere.
In einem zweiten Handlungsstrang geht es um den Regisseur Alexander Oswald, Celia Oswalds Sohn. Kurz nach dem Tod seiner Mutter verliert er bei einer rasanten Fahrt die Kontrolle über sein Motorrad und erleidet ein schweres Schädelhirntrauma. Von den Ärzten wird er als potenzieller Organspender trotz Hirntodes künstlich am Leben gehalten, nun muss sein Vater Claus Saalbach die schwere Entscheidung treffen, ob er die Organe seines Sohnes anderen Menschen spenden will. Dabei versuchen die Mitarbeiter des Organspendedienstes alles, um ihn zu einer Zusage zu bewegen. Schweren Herzens entschließt er sich letztlich, das Herz, und nur das Herz, seines Sohnes zu spenden. Das Transplantationsteam nimmt jedoch gegen seinen ausdrücklichen Wunsch eine Vollspende vor, d. h. dass sämtliche spendbaren Organe entnommen werden, Lunge, Leber, Herz, Bauchspeicheldrüse, Darm, Niere, Augenhornhaut und Knorpel.
Als Claus Saalbach seinen Sohn schließlich beim Bestattungsunternehmer ein letztes Mal sieht, ist er entsetzt, dass Alexander im wahrsten Sinne des Wortes ausgeweidet wurde. Als er beim verantwortlichen Arzt eine Rechtfertigung dafür verlangt, wird er von diesem nur lakonisch abgefertigt: „… Wer ein Organ aus Liebe gibt, der gibt doch auch alles, meinen Sie nicht?“ … „Sind Sie sicher, dass Sie noch zurechnungsfähig sind?“ In seiner Hilflosigkeit wendet sich Claus Saalbach schließlich an eine Selbsthilfe-Gruppe, die NZO (Nein zur Organspende), deren Mitglieder ähnliche Erfahrungen wie er gemacht haben. Dabei trifft er Brigitte Lasbeck, deren Sohn ebenfalls bei einem Motorrad-Unfall ums Leben kam und aufgrund ihrer Einwilligung explantiert wurde. Hier schließt Monika Buttler nun wieder den Bogen zum Mord an Celia Oswald. Denn ausgerechnet die Schauspielerin hat das Herz des fünfundzwanzigjährigen Holger Lasbecks bekommen.
So weit äußerst packend und authentisch geschrieben, doch plötzlich rückt die ganze Thematik der Organspende völlig in den Hintergrund, als die Ermittler beginnen, den Fall zu lösen. Der Herzraub wird zur Nebensache, denn Celia Oswald ist mit Rattengift getötet worden und zwar von dem wahrscheinlichsten Verdächtigen. Im letzten Drittel von „Herzraub“ schafft es Monika Buttler durch das klassische und langweilige Krimifinale, die im ersten Teil aufgebaute Dramatik auf den absoluten Nullpunkt fallen zu lassen.
Ein weiterer Minuspunkt sind eingeführte Handlungstränge, die komplett im Nichts verschwinden. Keine Auflösung, keine Erklärung, nicht einmal Hinweise auf eine Weiterführung der Geschichte in einer Fortsetzung. Wer bedroht die Wissenschaftsjournalistin Laura Flemming? Werden die verantwortlichen Ärzte zur Rechenschaft gezogen und gibt es eine größere Organisation hinter den Organspendediensten, denn die Ärzte und das Krankenhauspersonal bekommen ja offensichtlich ein Kopfgeld für jeden gemeldeten Organspender?
„Herzraub“ ist trotz der Mängel lesenswert, gerade wegen der schonungslosen Ehrlichkeit, mit der die Problematik der Organspende behandelt wird. Ein Thema, das immer noch in der Gesellschaft totgeschwiegen wird, obwohl seit fast 40 Jahren Transplantationen aus der Medizin nicht mehr wegzudenken sind. Wenn über Organspenden berichtet wird, dann immer nur einseitig aus der Sicht des glücklichen Empfängers, nur allzu oft wird vergessen, dass für das neue Leben ein Mensch erst sterben musste.
Bass, Bill / Jefferson, Jon – Knochenleser, Der
Knoxville im US-Staat Tennessee gehört zu jenen unglücklichen Städten, die nur über eine echte Sehenswürdigkeit verfügen, mit der indessen rein gar kein touristischer Staat zu machen ist: Hier hat die University of Tennessee in den 1970er Jahren die „Body Farm“ eingerichtet. Dr. Bill Bass, ein forensischer Pathologe, der von kriminalistischen Einrichtungen aller Art immer wieder als Berater bei rätselhaften Leichenfunden zu Rate gezogen wurde, war lange Zeit mit der ärgerlichen Tatsache konfrontiert, dass bei der Bestimmung der Zeit, die so ein „Kunde“ in einem Wald, einem Fluss oder unter dem Fundament eines Hauses gelegen hatte, der Zeitpunkt des Todes einfach nicht präzise festgestellt werden konnte: Niemand wusste wirklich, wie der Prozess der Verwesung ablief.
Aus Gründen, die auf der Hand liegen, waren selbst Wissenschaftler vor grundsätzlichen Forschungen auf diesem Gebiet zurückgeschreckt. Es bedarf einer besonderen Sorte Mensch, um sich planmäßig dem Grauen zu stellen, das Zeit, Feuchtigkeit und vor allem Insekten aus einer Leiche modellieren. Bill Bass ist ein solcher Mensch; zwar nicht immun gegen die unerfreulichen Seiten seiner Wissenschaft, aber mit Leidenschaft dabei, das Notwendige anzugehen. Den letzten Anstoß gab ihm die in ihrer grausigen Komik äußerst unterhaltsame Episode mit einer kopflosen Leiche, die er in einer bizarren Verkettung unglücklicher Zufälle um mehr als ein Jahrhundert falsch datierte.
Anschließend richtete Bass jene Institution ein, die von den dankbaren Medien später „Body Farm“ getauft wurde: Auf einem Stück Land wurden (und werden) Leichen auf den Waldboden oder in Pkw-Kofferräume gelegt, in Wasserbecken getaucht, flach oder tief eingegraben – und dann in Ruhe gelassen; in Ruhe der Fäulnis überlassen, um es beim Wort zu nennen, wobei dieser Vorgang detailliert in Wort und Bild festgehalten wird. Damit gewinnt man Vergleichsdaten, die es möglich machen, Leichen zu „entschlüsseln“, um so Todesursachen und –zeitpunkte zu fixieren.
Dass dies nicht nur Voyeure be- und Igittisten entgeistert, sondern von Wert für die kriminalistische Alltagsarbeit ist, weiß Bass an vielen Beispielen anschaulich zu belegen. So manchem Mörder konnte er ins Handwerk pfuschen, bevor dieser allzu sehr in Serie ging. Auch in der Archäologie sowie in allen Wissenschaften, die an den Überresten von Menschen über Menschen forschen, weiß man die Erkenntnisse zu schätzen, die Bass und seine magenstarken Kolleginnen und Kollegen ihren stinkenden Versuchspersonen entlocken.
Mit den Schilderungen berühmter oder „nur“ interessanter Fälle, an denen er forensisch beteiligt war, verknüpft Bass seine Lebensgeschichte. Beide Bereiche erklären einander, so dass Bass es nie nötig hat, in regelmäßigen Abständen einen neuen Gruselkadaver ins Geschehen zu bringen, um den gelangweilten Leser zu fesseln: „Der Knochenleser“ ist eine Biografie mit rotem Faden, keine kunterbunte Sammlung aberwitziger Anekdoten. An denen spart der Verfasser nicht, aber er stellt sie in den Dienst seiner Geschichte. Diese wird dadurch auch zur Historie der (US-)Forensik in den vergangenen fünfzig Jahren.
Weil Bass dabei das Persönliche nicht scheut, stellt er sich auch der verständlichen Frage, wie ein Mensch nur solche Arbeit tun kann. Unausgesprochen steht sie während der Lektüre immer im Raum. Die Labor- und Feldgeschichten sind spannend, sogar faszinierend, dazu witzig, aber dennoch … Wie schafft der Mann es, Tag für Tag mit faulenden, grässlich anzusehenden Leichen umzugehen, ohne darüber verrückt zu werden?
Die Antwort ist einfach – oder typisch amerikanisch, wenn man so möchte: Es liegt halt ein höheres Ziel und damit ein Sinn in dieser Tätigkeit. Bass sieht sich einerseits als Wissenschaftler, d. h. als Kopf-Mensch, der den Verstand an- und den Bauch (und die Nase) abschaltet, sobald ein „Job“ – die Identifizierung und Untersuchung eines Kadavers – ansteht. Andererseits gibt dies besagter Leiche, die einst ein Mensch war, der unter ungeklärten Umständen das Leben verlor, seine Identität, seine „Stimme“ zurück: Wenn er, Bill Bass, nicht klärt, was zum Zeitpunkt des Todes geschah, kommt ein Mörder davon und kann seine Tat womöglich wiederholen.
Starke Argumente, keine Frage, aber Mr. Bass gehört dennoch eindeutig einem ganz besonderen Menschenschlag an! Möglicherweise ist es ja auch sein Sinn für Humor bzw. die Absurditäten des Lebens & des Todes, die ihn zu seiner Arbeit befähigen. Negativ-Kritiker werden es ihm ankreiden, dass er es manchmal am gebotenen „heiligen“ Ernst mangeln lässt. Sie werden freilich überhaupt wie viele Bürger von Knoxville urteilen: Macht es, wenn es denn sein muss, aber schweigt darüber! Doch Bass ist stolz darauf, was er mit seinem Team geschafft hat. Außerdem will er der Mythenbildung vorbeugen.
Denn die „Body Farm“ ist spätestens seit Anfang der 1990er Jahre in aller Munde, als sie ganz besonderen Besuch bekam: Die ehemalige Forensikerin und spätere Schriftstellerin Patricia Cornwell besuchte Knoxville und ließ sich von Bass in die Geheimnisse der „Farm“ einweihen, die sie anschließend reichlich in einen ihrer enorm erfolgreichen Kay-Scarpetta-Romane („The Body Farm“; dt. „Das geheime ABC der Toten“) einfließen ließ. Seitdem genießt der seltsame Ort fast schon zu viel Publicity; sogar Pfadfindergruppen fragten schon Führungen nach … Faszination und Abscheu liegen beim Thema Tod sehr nahe beieinander!
„Der Knochenleser“ beinhaltet zwei Fotostrecken, die sich glücklicherweise nur in Andeutungen dessen ergehen, was der Verfasser im Text überaus drastisch beim Namen nennt. Der optische Eindruck davon, was den Alltag des Dr. Bass ausmacht, steigert allerdings die Bewunderung für das, was dieser Mann leistet. Seien wir ehrlich: Möchten wir wirklich die Fotos vom Hinterhof jenes pflichtvergessenen Bestatters sehen, der „seine“ Leichen nicht urnengerecht verbrannte, sondern sie zwischen Waldbäumen stapelte, in Schrottautos stopfte oder sonstwie „entsorgte“ – 339 Stück? Da kam es bei der anschließenden Identifizierung zu unerfreulichen Wiedersehensszenen zwischen Familienangehörigen, von denen die Lebenden die Toten längst in der Urne auf dem Kaminsims wähnten … Nein, wir sind Dr. Bass dankbar, dass er uns in klaren Worten, aber nicht gar zu krass über seine Arbeit informiert; darüber hinaus müssen und wollen wir nicht alles wissen! Das überlassen wir den Spezialisten, die es wissen müssen, um es anwenden zu können. Dank Bill Bass (wohltuend unterstützt vom wortgewandten Journalisten Jon Jefferson) ist uns nun klar, dass dieser Job keine Horde ghulischer Frankensteine erfordert, sondern Menschen mit Köpfchen, Herz & stählernen Nasen!
Margolin, Phillip M. – Hand des Dr. Cardoni, Die
Er ist ein echter Widerling, dieser Dr. Vincent Cardoni. Als Chirurg am St. Francis Medical Center in Portland, Oregon, schurigelt er seine Untergebenen. Die Kunstfehlerchen häufen sich, denn der Chirurg hat ein Kokainproblem. Seine schöne Frau, die Assistenzärztin Justine Castle, hat die Scheidung eingereicht, die schmutzig und teuer zu werden verspricht. Außerdem gibt es da womöglich Kontakte zum Drogengangster Martin Breach, dessen Gegner spurlos zu verschwinden pflegen.
Besagter Breach steigt gerade in den illegalen Organhandel ein. Er kauft und verkauft Herzen, Nieren und andere Innereien, deren ursprüngliche Besitzer sich womöglich nicht freiwillig davon trennen wollten. Gerade ist so ein Geschäft geplatzt, wofür Breach Cardoni verantwortlich macht. Der Arzt ahnt nichts von der Gefahr, die ihm durch den rachsüchtigen Gangster entsteht, denn ihn plagen ganz andere Sorgen: Auf dem Grundstück einer abgelegenen Waldhütte, die angeblich ihm gehört, wurden neun verstümmelte Leichen gefunden – offenbar mit Hilfe chirurgischer Instrumente teils zu Tode gefoltert, teils ausgeweidet.
Cardoni beteuert seine Unschuld und heuert als Anwalt den berühmten Frank Jaffe an. Diesem wird seit kurzem von seiner jungen, schönen (etc.) und ehrgeizigen Tochter Amanda assistiert. Mit der schleimigen Trickfertigkeit vorzüglich entlohnter US-Rechtsverdreher gelingt es dem Vater-Tochter-Team tatsächlich, der Polizei gravierende Verfahrensfehler nachzuweisen. Cardoni kommt frei – und vom Regen in die Traufe.
Ist er tatsächlich der Mörder, der jetzt womöglich weitermacht? Besonders Amanda macht dies zu schaffen. Ihre Ermittlungen deuten eine mögliche Schuld der gar nicht so redlichen Ex-Gattin Cardonis an. Amanda und ihr neuer Freund, der junge Arzt Tony Fiori – ein Kollege Dr. Castles – beschatten die Verdächtige und behalten auch Cardoni im Auge. Doch dieser verschwindet – nicht ganz spurlos, denn Amanda findet seine abgetrennte Hand …
Die Zusammenfassung macht es bereits deutlich: Originalität ist nicht gerade das Pfund, mit dem diese Story wuchern könnte. Stattdessen haben wir es mit einem durchschnittlichen Thriller zu tun, der seine grundsätzlich solide Geschichte ziemlich ungeschickt verkauft (und mit einem abstoßenden, die Selbstjustiz feiernden, zudem bei Quentin Tarantino „entliehenen“ Schlussgag ausklingt).
Denn Margolin ist durchaus in der Lage, Spannung und Atmosphäre zu erzeugen. Auch ein zu langsames Tempo kann man ihm nicht vorwerfen. Deshalb verzeihen wir ihm, dass er uns eigentlich nur alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen möchte. Sadist killt in Serie, dieses Mal als Arzt, was stets funktioniert, weil uns alle kalte Schauder erfassen, wenn wir uns OP-Tisch und Skalpell vorstellen. Um auf Nummer Sicher zu gehen, konstruiert Margolin einen zweiten Handlungsstrang um einen brutalen Gangster, der zwar „nur“ geschäftsmäßig, aber mindestens genauso eklig mordet.
Vordergründigkeiten à la Kopf im Kühlschrank verfehlen auch nie ihre Wirkung, das laute Gekreisch soll verbergen, dass die Story mächtig über tief ausgefahrene Geleise rattert. Manchmal wird sie allerdings unvermittelt umgeleitet – und dann ist man unwillkürlich gefesselt. Margolin rüttelt gern an den Grundfesten des Plots. Verdächtige werden zu Opfern, Opfer zu Mördern, Mörder zu Marsmenschen … Es ist alles möglich, und manchmal schafft es Margolin sogar, auf dem schmalen Grat zwischen Überraschung und Übertreibung zu balancieren. Bemerkenswert ist es beispielsweise, dass es nach US-Gesetz offenbar möglich ist, als Serienmörder vor Gericht freizukommen, wenn die Beweise für das blutige Tun nicht vorschriftsmäßig erbracht wurden; sie werden dann höchstrichterlich für nichtig erklärt. Kann (oder will) man das glauben? Immerhin fällt uns dies leichter als sich vorgaukeln zu lassen, der untergetauchte Verbrecher könne sich chirurgisch so „umbauen“ lassen, dass sich seine schändlichen Spiele am Schauplatz früherer Übeltaten und unter den Augen ehemaliger Kollegen und Freunde ungestört fortsetzen lassen … (Dies wird nicht der letzte Sturz ins logisch Leere bleiben.)
Eindeutig der Schwachpunkt dieses Romans – die Figurenzeichnung. Was heißt Schwachpunkt: Margolin versetzt seiner gar nicht unflotten Geschichte fast den Todesstoß, indem er sie ausschließlich mit oberflächlichen Pappkameraden besetzt. Man fasst sich bei der Lektüre an den Kopf, weil man es gar nicht glauben kann, dass sich der Autor eine Dreistigkeit dieses Ausmaßes tatsächlich traut. Da treten also alle Hoffungsträger des modernen Thrillers in einem Buch versammelt auf: der taffe Anwalt, der rettungswütige Arzt, die schöne Unschuld, die verdächtige Schöne, der hartnäckige Cop, der degenerierte Gangster, der psychopathische Serienmetzler … Es gibt für sie kein Entrinnen, sie sind an ihre Rollen gebunden, die sie bis zum allerletzten Klischee durchspielen müssen.
Für den europäischen Leser kommt erschwerend hinzu, dass er (und sie) sich nicht recht am Bild des US-Anwalts als Helden erfreuen kann. Viele Seiten füllt Margolin (der selbst Anwalt war) mit salbungsvollen Vorträgen Frank Jaffes, dass es schließlich der Job eines Strafverteidigers sei, seine Klientin freizubekommen. Die Frage der Unschuld ist für ihn sekundär; er hofft aber immerhin, nicht den einen oder anderen Serienmörder oder Kinderschänder wieder auf die Welt losgelassen zu haben …
Töchterchen Amanda, die weibliche Hauptrolle, agiert so naiv, dass man schreien möchte. Sie schlägt sich mit diversen Reiches-Mädchen-will-selbstständig-werden-Problemchen herum, will ein noch schärferer Justiz-Hund als Papi werden und sucht natürlich nebenbei nach Mr. Right. Dass sich genau der scheinbar gefundene Prinz als der wahre Täter erweist, vermag nur Amanda zu verblüffen; selbst der nicht besonders aufmerksame Leser hat das schon circa auf Seite 100 herausgefunden, so auffällig bemüht sich Margolin, ihn unverdächtig wirken zu lassen.
Es wird besser nach dem Zeitsprung über vier Jahre, der den zweiten Teil des Romans einleitet. Möglicherweise wollte Margolin seine Amanda einem Reifeprozess unterziehen. Weil sein schriftstellerisches Talent nun einmal beschränkt ist, muss er dabei halt mit dem Quast und nicht mit der Feder arbeiten. Das betrifft, wie weiter oben skizziert, ebenso das übrige Personal. Der Mörder ist übrigens fast nur Gaststar in seiner Geschichte. Von seinen grausigen Taten hören wir nur indirekt. Ein kluger Schachzug, der die Vorstellungskraft unheilvoll stimuliert – wäre da nicht der Verdacht, dass Margolin auch hier kühl kalkuliert: Offene Folter- und Metzelszenen könnten nämlich die Mainstream-Leserschaft verstören und vom Kauf abhalten. Das gilt auch für Hollywood, das sich womöglich für „Die Hand des Dr. Cardoni“ interessieren könnte, denn Margolin hat sein Bestes getan, alle Elemente eines Drehbuchs für einen potenziellen Blockbuster zusammenzutragen …
Phillip M. Margolin wurde 1944 in New York geboren. Nach dem College studierte er Jura in Washington und New York. Zwischenzeitlich ging er für zwei Jahre mit dem Friedenscorps der Vereinigten Staaten nach Monrovia. Der studentischen Puppenhülle entschlüpft, zog Margolin nach Oregon und eröffnete eine Anwaltskanzlei. Hier spezialisierte er sich als Strafverteidiger auf Mordfälle und war damit (nach US-Maßstäben) anscheinend recht erfolgreich.
Seit den späten 1970er Jahren verfolgte Margolin seine schriftstellerischen Ambitionen. Nach einigen Jahren zeichneten sich solche Erfolge ab, dass er sich ab 1996 ganz dem Schreiben widmete. Margolins Romane haben Stammplätze auf den US-Bestsellerlisten. Sein unbedingter Wille, es allen Recht zu machen, wird dabei keine geringe Rolle spielen.
Phillip M. Margolin lebt mit Frau und zwei Kindern in Portland, Oregon.
Homepage des Autors: http://www.phillipmargolin.com/
Mankell, Henning – Brandmauer, Die
Kriminalromane sind in Deutschland so populär wie nie zuvor, und besonders schwedische Krimis stehen auf der Beliebtheitsskala dank Henning Mankell ganz weit oben. Der größtenteils in Afrika lebende Autor hat mit Kurt Wallander einen Kommissar geschaffen, der an Authentizität möglicherweise unübertroffen ist. Bei der „Brandmauer“ („Brandvägg“, 1998) handelt es sich leider um den letzten Fall, den Kurt Wallander in Ystad zu lösen hat.
_Wallander wird alt_
Inzwischen hat Kurt Wallander das stolze Alter von 50 Jahren erreicht, sodass ihm nur noch etwa zehn Jahre bis zur lang ersehnten Pensionierung bleiben. Einst war er mit Mona verheiratet, doch bereits vor „Mörder ohne Gesicht“ hatten die beiden sich getrennt. Aus der Ehe geblieben ist Wallander seine Tochter Linda, zu der er ein sehr wechselhaftes Verhältnis hat; mal verstehen die beiden sich blendend, mal scheint Linda ihrem Vater völlig entrückt zu sein. Wallander ist kein großer Held, er wird eher von vielen Zweifeln geplagt, ob sein Beruf wirklich noch das Richtige für ihn und er den immer schwierigeren Belastungen noch gewachsen ist. Bei Wallander wurde unlängst Diabetes diagnostiziert, sodass er inzwischen seinen Lebenswandel umstellen musste. Mittlerweile hat er etwas abgenommen und sich tägliche Spaziergänge zur Gewohnheit gemacht, aber auch das macht ihn nicht viel glücklicher, Wallander fühlt sich einsam, denn auch seine Beziehung zu Baiba Liepa, die in Riga lebt, ist in die Brüche gegangen, sein ehemals bester Freund Sten Widen will auswandern und auch sein exzentrischer Vater ist inzwischen gestorben. Was bleibt ihm noch?
_Mord oder Selbstmord – das ist hier die Frage_
Zu Beginn lernt der Leser kurz Tynnes Falk kennen, der sorgfältig seinen Tagesablauf notiert und eines Abends noch einmal spazieren gehen will. Er holt am Bankautomaten einen Kontoauszug und denkt, dass alles in Ordnung ist. Doch danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Kurz darauf wird seine Leiche vor dem Bankautomaten aufgefunden.
Fast zur gleichen Zeit wird ein Anschlag auf den Taxifahrer Lundberg verübt. Zwei junge Mädchen, nämlich die neunzehnjährige Sonja Hökberg und die erst vierzehnjährige Eva Persson, überfallen den Taxifahrer, schlagen ihm mehrmals mit einem Hammer auf den Kopf und stechen ihm ein Messer in die Brust. Kurze Zeit später erliegt Lundberg seinen schweren Verletzungen und Wallander ist entsetzt angesichts der brutalen Gewalt, mit der die beiden jungen Mädchen vorgegangen sind. Schnell gestehen die beiden ihre Tat, zeigen allerdings keine Reue. Warum bloß haben sie den unschuldigen Taxifahrer angegriffen?
Wallander versteht die Welt nicht mehr, was ist passiert, dass junge Frauen so eiskalt sein können? Bald darauf kann Sonja Hökberg aus ihrer Haft fliehen, gleichzeitig zieht Eva Persson ihr Geständnis zurück. Dann fällt in Ystad der Strom aus und eine verkohlte Leiche wird in der Transformatorstation gefunden. War es Selbstmord oder Mord? Wie konnte die Tür zum Häuschen aufgeschlossen werden, obwohl die Schlüssel nur wenigen Menschen zugänglich sind? Wie hängen all diese mysteriösen Todesfälle zusammen? Wallander und seine Kollegen tappen im Dunkeln. Gleichzeitig gibt Wallander eine Kontaktanzeige auf, um vielleicht eine Frau kennen zu lernen. Zunächst ist er skeptisch, aber vielleicht wird ihm doch eine Frau antworten …
_Mankell-Wallandersche Betrachtungen_
Für mich ist und bleibt Henning Mankell ein echtes Phänomen. Seine Krimis sind absolute Weltspitze und reißen den Leser von Beginn an mit, selten habe ich spannendere Bücher gelesen. Auch hier steigen wir mitten in die Geschichte ein und schon im ersten Kapitel kommt Tynnes Falk ums Leben. Die Polizei steht vor einem Rätsel, denn Falks Todesursache bleibt lange Zeit im Dunkeln. Gleich am Anfang überschlagen sich die Ereignisse, denn sowohl zum Thema Tynnes Falk gibt es schnell neue Erkenntnisse, wie auch im Fall um Sonja Hökberg. Um den Leser und seine Aufmerksamkeit an keiner Stelle zu verlieren, baut Mankell regelmäßig Cliffhanger ein. Oftmals hängt Wallander seinen Gedanken nach:
|“Er konnte seinen Gedankengang nicht klar zu Ende denken. Aber er wusste, dass er wichtig war.“|
Als Leser könnte man Wallander dann nur zu gern am Kragen packen und schütteln, um seinen Denkprozess voranzutreiben, denn diese Ungewissheit ist kaum auszuhalten.
Einmal streut Mankell die Information ein, dass Wallander einen so schwerwiegenden Fehler begeht, dass er später immer wieder daran zurückdenken muss. Wallander befürchtet, an einem weiteren Todesfall schuldig zu sein und man fiebert der Auflösung dieses Fehlers entgegen, auf die man allerdings fast bis zum Schluss des Buches warten muss.
|“Später sollte Wallander stets denken, dass er an jenem Nachmittag, als er in seinem Büro saß und Ann-Britt zuhörte, einen der größten Fehler seines Lebens begangen hatte. Als sie von ihrer Entdeckung berichtete, dass Sonja Hökberg sehr wohl einen Freund gehabt hatte, hätte er sogleich begreifen müssen, dass an der Geschichte etwas faul war. Ann-Britt hatte nicht die ganze Wahrheit ausgegraben, sondern nur die halbe. Und halbe Wahrheiten haben, wie er wusste, die Tendenz, sich in ganze Lügen zu verwandeln. Er sah nicht, was er hätte sehen müssen. Sein Fehler musste teuer bezahlt werden. In finsteren Stunden dachte Wallander, dass sein Versagen zum Tod eines Menschen beigetragen hatte. Und es hätte dazu führen können, dass eine andere Katastrophe tatsächlich eingetreten wäre.“|
Der Spannungsbogen ist wieder nahezu perfekt gelungen, die letzten 350 Seiten habe ich praktisch an einem Stück gelesen, weil ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen konnte. Mankell bräuchte meiner Meinung nach gar keine Cliffhanger, um seine Leser bei Laune zu halten, seine Geschichten wären auch ohne sie spannender als die meisten anderen Kriminalfälle. Interessant ist bei der „Brandmauer“ darüber hinaus, dass scheinbar gar nicht zusammenhängende Fälle doch miteinander verwoben sind. Mal gibt es neue Erkenntnisse zum einen Fall, dann wieder welche zum anderen Fall, doch erfährt man bis kurz vor Schluss nicht die wahren Zusammenhänge und ist dadurch ständig am Miträtseln. Sehr verwirrend war auch, dass Wallander zwischendurch ab und an Spuren verfolgt, die logisch klingen und Wallanders berühmter Intuition entspringen, die aber dennoch in eine falsche Richtung weisen. Als Leser kann man also nie sicher sein, ob man sich auf der richtigen Spur befindet. Mankell spielt gerne mit den Informationen über die Täter und ihre Motive, so ist der Leser oftmals der Kriminalpolizei einen Schritt voraus. An einer Stelle erfahren wir einige Kleinigkeiten über den Drahtzieher hinter den Morden und lernen einen Komplizen kennen. Wallander dagegen ist ahnungslos und weiß nicht, wem er trauen kann und wem nicht. Das führt dazu, dass man Wallander in sein Verderben rennen sieht und immer weiter hoffen muss, dass er noch rechtzeitig bemerken wird, wer die Komplizen des Drahtziehers sind.
_Faszination Wallander_
Wieder einmal steht Kurt Wallander im Mittelpunkt des Geschehens. Mankell legt stets viel Wert auf die Charakterzeichnung seines nicht-perfekten Krimihelden. In diesem Fall hadert Wallander mit sich und seiner Einsamkeit. Am liebsten würde er ausbrechen aus seinem Alltag und seine Arbeit hinschmeißen, wie es auch andere seiner Bekannten getan haben. Zudem fühlt er sich einsam, da ihm die Frau an seiner Seite fehlt. Als Linda ihm dann eine Kontaktanzeige vorschlägt, ist Wallander zunächst skeptisch, gibt dann aber schweren Herzens doch eine auf. Ein wenig Bergauf geht es mit seiner Gesundheit, denn Wallander hat etwas abgenommen und mit dem Rauchen aufgehört. Gewann man in anderen Fällen noch den Eindruck, dass Wallander auch ein kleines Problem mit dem Alkohol hat, scheint er dieses inzwischen in den Griff bekommen zu haben. In jedem Wallanderkrimi kommen neue Mosaiksteinchen hinzu, die das Bild unseres Krimihelden immer weiter vervollständigen, sodass dieses im Laufe der Reihe immer detaillierter wird. Dadurch wächst einem Wallander richtig ans Herz, man leidet mit ihm mit, wenn er sich einmal mehr einsam und verlassen fühlt oder er es wieder nicht schafft, seine Wäsche zu waschen (dieses Mal bringt er das allerdings einmal zustande!). Wallander wird einem zunehmend sympathischer, je mehr man über ihn liest, zumindest ging das mir so und auch allen, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe.
Mankell schafft es sogar im Laufe der gesamten Krimireihe, auch seine anderen Figuren immer weiter auszubauen, so werden darüber hinaus Wallanders Kollegen besser vorgestellt, besonders über Martinsson wird man in der „Brandmauer“ einige interessante Dinge erfahren. Ann-Britt Höglund erlebt in diesem Roman ähnlich wie Wallander zuvor persönliche Schicksalsschläge und wird immer mehr zu seiner Lieblingskollegin.
Neben der ausführlichen Charakterzeichnung der handelnden Personen ist eine weitere Besonderheit der Mankell-Krimis die meist enthaltene „Botschaft fürs Leben“; so wird auch hier wieder ein Problem behandelt, das die heutige Gesellschaft kritisieren soll. In seinem Nachwort schreibt Mankell dann auch, dass er sich vorstellen könne, dass dies durchaus so geschehen könnte, wie er es für seinen Krimi erfunden hat. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal nicht politische Missstände, sondern die Verwundbarkeit der heutigen Gesellschaft. Was man darunter genau zu verstehen hat, wird ausführlich im Buch beschrieben, würde hier aber zu viel verraten. Ich persönlich fand die Idee nicht schlecht, dieses Problem aufzugreifen, auch wenn „Die Brandmauer“ dadurch vielleicht nicht ganz das Gewicht erhält wie zum Beispiel „Die weiße Löwin“. Am Ende war ich dann doch ein ganz klein wenig enttäuscht, dass nicht mehr hinter den Ereignissen steckte, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Obwohl in jedem der Wallander-Krimis ein neuer Fall aufgeklärt werden muss, ist es doch wichtig, dass man die Bücher in chronologischer Reihenfolge liest, denn Mankell spielt in allen seinen Büchern auf bereits vergangene Ereignisse an. Dieses Mal geht er sogar ein Stück weiter und deutet diese nicht nur an, sondern beschreibt recht ausführlich den Täter aus „Die falsche Fährte“. Unfreiwillig werden dem Leser neben dem Mörder auch einige seiner Opfer und sein Motiv verraten, hier verrät Mankell so viel wie nie zuvor über einen vergangenen Krimi.
_Was am Ende übrig bleibt_
Insgesamt ist Henning Mankell mit der „Brandmauer“ ein mehr als solider Krimi gelungen, der spannender ist als die Romane seiner skandinavischen Kollegen, allerdings nicht ganz heranreichen kann an „Die weiße Löwin“ oder auch „Mittsommermord“, dennoch ist der Fall wieder hochspannend und brisant. Das Buch unterhält gut und man kann es praktisch kaum noch aus der Hand legen, wenn man erst einmal damit angefangen hat.
Deutsche Wallanderseite: http://www.wallander-web.de/
John S. Marr – Die achte Posaune
Zwei Jahre ist es her, dass die Welt (= die Vereinigten Staaten von Amerika) vom irren Reagenzglas-Psychopathen und Bio-Terroristen Theodore Graham Kameron heimgesucht wurde. Die zehn Plagen des Alten Testaments hatte der geniale, unter akutem religiösen Wahnsinn leidende Naturwissenschaftler in seinem Labor heraufbeschworen: dies sehr erfolgreich und mit für seine zahlreichen Opfer unerfreulichen Folgen.
Auf die Schliche gekommen war dem selbst ernannten Engel des Bösen damals Jack Bryce, Spezialist für Infektionskrankheiten. Noch heute leidet er unter den Folgen der Hetzjagd, die ihn das große Finale nur arg ramponiert überleben ließ. Schlimmer: Kameron konnte entkommen. Für die Behörden gilt er als tot, aber Bryce weiß es bald besser. Wie nahe ihm sein Feind ist, ahnt er nicht: Im US-Südstaat Virginia hat Bryce eine Stelle als Universitätsdozent angenommen. Der Zufall (bzw. die von Hollywood geprägte Dramaturgie des modernen Bestseller-Thrillers) hat ihn dorthin verschlagen, wo der Kameron-Clan – dessen Angehörige schon immer verhaltensauffällig waren – seit 150 Jahren Übles treibt.
Theodore wandelt auf den Spuren seiner Vorfahren. Wieder plant er die Welt für allerlei sündhaftes Tun zu strafen. Dieses Mal wählt er eine besonders widerliche Methode: Er malträtiert seine Opfer mit Würmern, Zecken oder Blutegeln, die er zusätzlich mit exotischen Krankheitskeimen auflädt. Im Inneren eines menschlichen Körpers entwickelt sich diese Höllenbrut prächtig, um dann am Tage X hungrig über die Organe ihres Wirtes herzufallen. Das garantiert ein eindrucksvolles Sterben, wie u. a. Shmuel Berger bestätigen kann (Kotztüten bereithalten!), dessen Studienfreund und Zimmergenosse just auf diese Weise zu Tode kam. Shmuel hatte damals geholfen, dem entfesselten Kameron das Handwerk zu legen. Mit im Bunde waren Vicky Wade, Fernsehreporterin, und FBI-Agent Scott Hubbard, die Kameron ebenfalls nicht vergessen hat.
Doch zunächst gilt es die übliche Alltagsarbeit eines gemeingefährlichen Irren zu verrichten. Kameron kontaminiert diverse Pechvögel mit seinen Parasiten, um jene Angst und jenen Schrecken zu säen, nach dem er süchtig ist. Lange dauert es nicht, bis Jack Bryce aufmerksam wird. Glücklicherweise hat er an seinem neuen Wirkungsort einige Verbündete gefunden, die mit den alten Mitstreitern dafür sorgen werden, dass die Posaune des achten Engels vorläufig noch im Schrank bleibt …
Mikro-Wesen säen Makro-Schrecken
Doch bis es soweit ist, gibt es wieder tüchtig Action und Krawall, in die sich dieses Mal mehr als ein ordentliches Quäntchen Splatter mischt. Recht unappetitlich fällt Kamerons zweite Attacke auf die sündige Menschheit aus. Was bleibt einem hart arbeitenden Unterhaltungs-Schriftsteller schon übrig, um auf dem umkämpften Markt des Medizin-Thrillers die leidige Konkurrenz auszustechen? Ekel mit der groben Kelle ist immer gut fürs Geschäft; die Leser lieben ihn, und die Tugendbolde schäumen, was für gern gesehene Gratis-Werbung sorgt.
Natürlich ist „Die achte Posaune“ ein Reißbrett-Roman von der ersten bis zur letzten Zeile. Hier wurde rein gar nichts dem Zufall überlassen. Nur bewährte Thriller-Elemente fanden Verwendung in einem mechanisch geplotteten Werk, das seinen Verfasser an die Spitze der Bestseller-Listen tragen sollte. Das hat recht gut geklappt. So schlecht klingt diese „Posaune“ außerdem nicht. Wenn man Überraschungen hasst und Remmidemmi liebt, kommt man auf seine Kosten.
Noch besser: Die Handlung entwickelt sich geradezu surreal, scheut nie vor dem völlig Absurden zurück und streift sogar den blanken Horror. Theodore Kameron entpuppt sich als letzter Vertreter einer wahrlich verdammten Sippe von Lumpen, Irren, Kannibalen und Serienkillern, die seit Jahrhunderten erst im alten Europa und dann in der Neuen Welt ihr Unwesen treiben. Das ist einfach hirnrissig, wird aber hinreißend erzählt.
Vollgas nach Stotter-Start
Dies sorgt für echte Verblüffung: John Marr gehört zu den seltenen Autoren, die denkbar ungeschickt starten, um sich dann zu echten Geschichtenerzählern zu mausern. „Die achte Posaune“ ist auch mit einer zweiten Eigenschaft etwas Seltenes: der zweite Teil einer Story, die den ersten deutlich übertrifft. Absurd ist dieses Garn zweifellos, aber eben auch vergnüglich und spannend, und wenn der erfahrene Thriller-Leser auch stets im Bilde ist, so geschieht doch ständig etwas, das die Aufmerksamkeit fesseln kann.
Liegt es daran, dass Marr das zweite Bryce/Kameron-Spektakel im Alleingang entfesselt? John Baldwin, Co-Autor von „The Eleventh Plague“ (1998; dt. „Die elfte Plage“) genoss derweil die Freuden der Vaterschaft, wie wir dem Nachwort entnehmen. Eine weitere Fortsetzung wäre möglich, denn der böse Hannibal Frankenstein entkommt schon wieder seinen Häschern!
Das lässt den Leser nicht leise aufstöhnen, sondern kann sogar Erwartungen wecken. Mit „Teddy“ Kameron ist Marr ein wirklich schaurig-schillernder Bösewicht gelungen. Heimlich, still und leise führt er seinen bizarren Ein-Mann-Krieg gegen den Rest der Welt und legt dabei einen ausgeprägten Sinn für schräge Einfälle an den Tag.
Medizinschrank als Gruselkabinett
Sind die beschriebenen Schrecken realistisch? Das bleibt Nebensache. Sie lesen sich jedenfalls spannend. Sein außerordentliches Hintergrundwissen bringt Marr, ein studierter Mediziner und Seuchenspezialist, der viele Jahre das Gesundheitsamt der Stadt New York leitete, dieses Mal deutlich souveräner als noch in „Die elfte Plage“ ins Spiel bzw. in den Dienst seiner Geschichte. Todesviren ziehen in Literatur und Film immer, und Marr weiß, wovon und wie man schreibt.
Leserherz (bzw. -hirn), was willst Du mehr? Manchmal wünscht man sich, Marr in seinem Enthusiasmus bremsen zu können, denn der Kampf gegen den biologischen Terror, der ganz real und auch ohne Dr. Kamerons Nachhilfe über die Menschheit kommen kann, ist dem Verfasser ein echtes Anliegen. Mehrfach unterbricht er seine Geschichte mit ausführlichen Referaten über Seuchen, die per Schiff oder Flugzeug in Windeseile um den Globus reisen, sich mit harmlosen einheimischen Krankheiten mischen und sich in das Unsägliche verwandeln könnten. Stört das den Fluss der Geschichte? Ganz erheblich, obwohl der Leser gern zugibt, dass solche Hintergrundinformationen das furchtsame Schütteln noch steigern!
Dass Marr seine Leser zwar ernst nimmt, um die ironischen Aspekte seiner Schauermär aber sehr wohl weiß, demonstriert er u. a. mit der Figur des Dwight Fry, den die Faszination in den Bann des dämonischen Dr. Kameron zwingt. Der Horrorfan erkennt die Anspielung: Dwight Frye (1899-1943) war der Schauspieler, der im Filmklassiker „Frankenstein“ (1931) die Rolle des „Fritz“ spielt, seinem Herrn hündisch ergeben ist und seinen Teil dazu beiträgt, Frankensteins Monster über die Welt zu bringen. Marrs Fry entspringt darüber hinaus dem legendären Schocker „Freaks“ (1931), den Regisseur Tod Browning mit tatsächlich körperbehinderten Männern und Frauen besetzte, die sich normalerweise ihren Lebensunterhalt als Jahrmarkts-Monstrositäten verdienten. Unter ihnen, die gequält und betrogen werden, bis sie sich gegen ihre Peiniger erheben: Johnny Eck, ein junger Mann ohne Unterleib!
Drama ohne Finale
Für den dümmlichen deutschen Titel, der wieder einmal platt das Alte Testament bemüht, um geradezu apokalyptische Dramatik zu suggerieren, dürfen wir den Verfasser nicht verantwortlich machen. Dem war „Wormwood“, also „Wermut“ eingefallen, aus dem u. a. der berüchtigte, halluzinogene und süchtig machende Absinth hergestellt wurde.
Teddy ist überaus einfallsreich, und der Wahnsinn liegt bei den Kamerons offensichtlich in den Genen. Hinter den Kulissen der Weltgeschichte waren sie schon immer für allerlei Schauerlichkeiten verantwortlich. Möglicherweise ist Theodore nur die Spitze des Eisbergs: Es gibt da einen finsteren, alten, komplexen Plan, der von Jack Bryce und seinen wackeren Gefährten bisher nur in Ansätzen enthüllt wurde. Die wiederum flüchtige Kameron selbst plant jedenfalls noch Großes für die Zukunft.
Wir sind durchaus gespannt. Auf eine Fortsetzung dürfen wir aber offenbar nicht mehr hoffen. John S. Marr, der so schwungvoll vom Arzt zum Unterhaltungsschriftsteller wurde, hat nach „Die achte Posaune“ keinen weiteren Roman geschrieben, sondern kehrte zur ‚reinen‘ Medizin zurück.
Taschenbuch: 477 Seiten
Originaltitel: Wormwood (New York : Frog City Ltd. 2000)
Übersetzung: Axel Merz
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: 




Lincoln Child – Das Patent
„Utopia“, der größte und modernste Freizeitpark der Welt, ist eine Schöpfung des unlängst verstorbenen Zauberkünstlers und Visionärs Eric Nightingale. In der Wüste des US-Staats Nevada erhebt sich die gigantische Kuppel, unter der vier virtuelle Welten perfekter Illusionen täglich bis zu 70.000 Besucher anlocken. Doch es gibt Ärger im bisher so einträglichen Paradies: Die Roboter, die vor und hinter den Kulissen aktiv sind, zeigen seit einiger Zeit Fehlfunktionen. Gerade hat eine fehlgeleitete Reparaturmaschine eine katastrophale Achterbahn-Entgleisung provoziert. Funktioniert etwa „Metanet“, das neurale Netz zur zentral Steuerung, nicht mehr richtig? Oder probt es womöglich den Aufstand? Dazu könnte es fähig sein, wurde es doch von seinem Schöpfer als lernfähige künstliche Intelligenz entworfen.
Sarah Boatwright, die ehrgeizige Geschäftsführerin von „Utopia“, ruft Dr. Andrew Warne nach Nevada. Der kommt gern, denn mit seiner Karriere steht es schlecht. Auch lockt ihn die Anwesenheit Boatwrights, mit der ihn einst ein Verhältnis verband. Der Wissenschaftler ahnt nicht, dass die Fehlfunktionen auf das Konto einer Bande entschlossener Industriespione gehen. Unter der Leitung des charismatischen aber völlig skrupellosen „John Doe“ haben sie das „Metanet“ infiltriert. Nun schlagen sie zu, postieren Heckenschützen, legen Zeitbomben, nehmen die gesamten Besucher als Geiseln, um die Herausgabe des revolutionären Patents zu erzwingen, auf dem die Attraktionen von „Utopia“ basieren. Die Technik ließe sich von findigen Schurkenstaaten in eine Waffe verwandeln, die der Weltpolizei USA schwer zu schaffen machen könnte. Lincoln Child – Das Patent weiterlesen