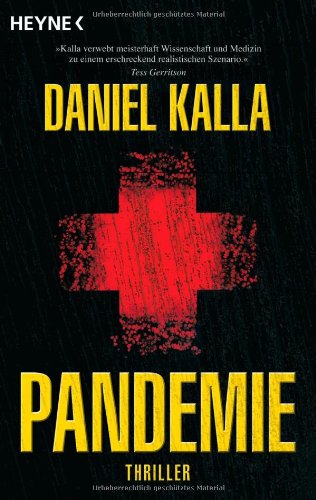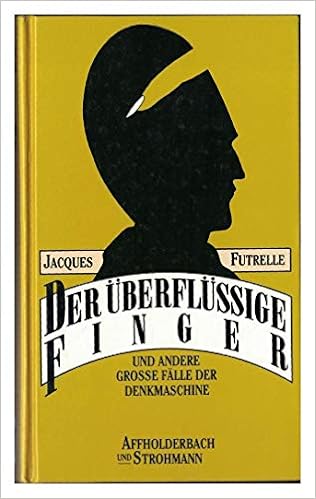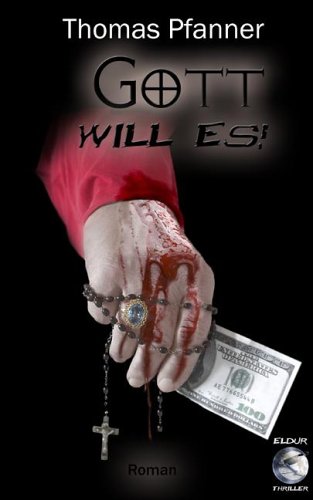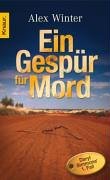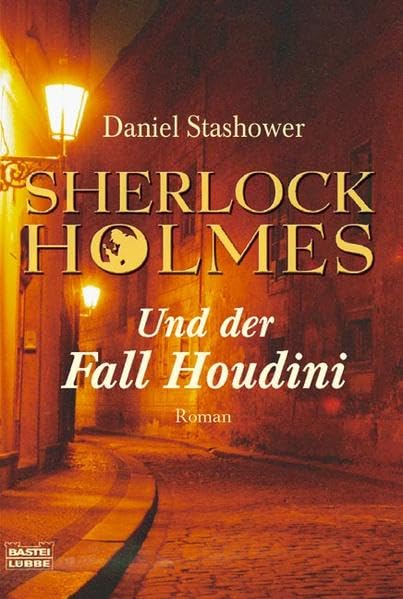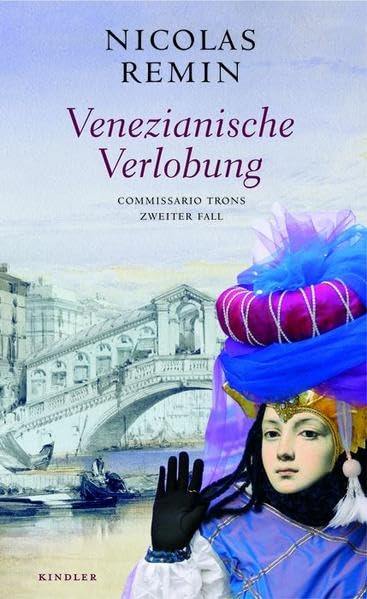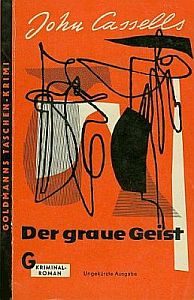Wenn man den Pressestimmen im Klappentext Glauben schenkt, dann dürfte „Verblendung“ von Stieg Larsson eine der vielversprechendsten Thriller-Veröffentlichungen des Jahres sein. Der kritische Leser mag da gleich entgegenhalten, dass ebendiese Pressestimmen allesamt von schwedischen Zeitungen mit unaussprechlichen und nach Ikea-Katalog klingenden Namen kommen, doch für den |Heyne|-Verlag war dies kein Hindernis, „Verblendung“ schon mal im Vorfeld als Thrillerveröffentlichung des Jahres zu lobpreisen. Ob das alles nur leere Versprechungen sind oder in dieser Lobhudelei wirklich ein Fünkchen Wahrheit steckt, soll der folgende Text klären.
Ganz beschaulich fängt der Roman an, als der Journalist Mikael Blomkvist den Auftrag erhält, eine Familienchronik im Auftrag des Patriarchen Henrik Vanger zu schreiben. Die Vangers stehen einem der größten schwedischen Konzerne vor, einem komplexen Familienimperium, das tief in der schwedischen Geschichte verwurzelt ist.
Für Mikael kommt dieser Auftrag gerade zur rechten Zeit, gibt er ihm doch die Möglichkeit, nach seiner Verurteilung wegen übler Nachrede aus dem Rampenlicht der Stockholmer Pressewelt abzutauchen. Mikael hatte in einem Artikel für sein Magazin „Millennium“ über zwielichtige Geschäfte des Großindustriellen Hans-Erik Wennerström berichtet, aber in der darauf folgenden Gerichtverhandlung den Kürzeren gezogen.
So richtet Mikael sich also auf der beschaulichen Insel Hedeby ein, um an Vangers Familienchronik zu schreiben. Was nur Henrik Vanger und er selbst wissen, ist, dass dies nur ein Scheinauftrag ist. In Wirklichkeit soll Mikael herausfinden, was aus Vangers vor vierzig Jahren verschwundenen Großnichte geworden ist. Harriet Vanger war in Henrik Vangers Augen eine wichtige Hoffnung für die Zukunft des Vangerschen Konzerns. Doch Harriet verschwand während einer Familienzusammenkunft auf der Insel unter mysteriösen Umständen. Seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Henrik Vanger vermutet einen Mord.
Als Mikael nach einigen Wochen der Ermittlungen wider Erwarten eine erste Spur entdeckt, wird ihm die junge Ermittlerin Lisbeth Salander zur Seite gestellt. Lisbeth, die mit sehr eigenwilligen Methoden arbeitet und sich nie in die Karten gucken lässt, stellt sich als überaus pfiffige und kompetente Assistentin heraus. Gemeinsam kommen die beiden auf die Spur eines alten Familiengeheimnisses und bringen sich durch ihr Wissen schließlich selbst in Gefahr. Wie schwer die Wahrheit wirklich wiegt, die die beiden zutage fördern werden, ahnen sie dabei selbst noch nicht, aber sie werden sich wünschen, dieses grausige Geheimnis niemals aufgestöbert zu haben …
Der Handlungsabriss von „Verblendung“ verspricht schon außerordentlich spannende Lektüre. Obwohl Larsson den Handlungsbogen ganz gemächlich spannt, zieht er den Leser gleich tief in die Geschichte hinein. Er erzählt auf eine schlichte und lockere Art, schafft es aber, den Leser von Anfang an mitzureißen. „Verblendung“ ist ein Buch, das den Anschein erweckt, als würde es sich quasi von selbst lesen. Leichtfüßig huscht man mit den Augen über die Seiten und zieht dabei unmerklich mit der Zeit das Lesetempo an – bis man irgendwann an den Punkt kommt, dass man „Verblendung“ nicht mehr gerne aus der Hand legen mag.
Dabei ist es nicht einmal die Spannung, die den Leser von der ersten Seite gefangen nimmt. Vielmehr sind es die Figuren, mit denen man mitfiebert. Larsson widmet sich erst einmal in aller Ruhe dem Leben seiner beiden Protagonisten Mikael und Lisbeth. In aller Ruhe erzählt er ihre Vorgeschichte (die in beiden Fällen durchaus interessant ist) und sorgt damit für eine vergleichsweise enge Bindung zwischen Leser und Figuren. Larsson geht es ganz offensichtlich nicht einfach nur darum, oberflächliche Spannung zu erzeugen und den Leser in einem atemlosen Plot mitzureißen, er legt seine Geschichte auf etwas mehr Tiefe an.
Mikael und Lisbeth sind zwei Figuren, die für sich genommen schon reichlich unterhaltsam sind. Beide haben ihre ganz ureigenen Macken. Bei Mikael ist es ein permanentes, offenes Dreiecksverhältnis, das er nun schon seit Jahren mit Freundin und Chefredakteurin Erika pflegt. Bei Lisbeth ist es ihre mangelnde soziale Kompetenz. Lisbeth ist aktenkundig und wird betreut, ist in ihrem Job als Ermittlerin für eine Security-Firma aber unübertroffen. Mikael und Lisbeth sind in ihrer ganzen Art und Weise ein interessanter Gegensatz, und auch dieser ist es, der auf den Leser einen Reiz ausübt und ihn bei der Stange hält.
Mit dem Thrillerplot lässt sich Larsson dagegen Zeit, aber das kann er sich durchaus leisten, denn auch so bleibt die Geschichte stets interessant. Mikaels Arbeit gleicht der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Immer wieder geht er Akten und Polizeiberichte durch, die vor ihm schon andere zigmal durchgekaut haben. Natürlich ist dem Leser klar, dass Mikael irgendwann etwas finden wird, aber dadurch, dass Larsson diesen Moment hinauszögert, steigert er die Spannung.
Als Mikael dann die erste Spur entdeckt, beginnt Larsson kontinuierlich an der Spannungsschraube zu drehen. Mit viel Liebe zum Detail schildert er Mikaels mühselige Vorgehensweise zur Rekonstruktion der Geschehnisse von vor vierzig Jahren. Als dann die ersten Drohungen gegen das Ermittlerduo von unbekannter Adresse kommen, steigt die Spannung zu ihrem Höhepunkt an. Larsson enthüllt eine grausige Familiengeschichte, und das Wissen darum ist für beide Protagonisten gleichermaßen belastend.
Der Spannungshöhepunkt ist dann schon weit vor Ende des Buches erreicht. Schon 150 Seiten vor dem Ende des Romans ist der Fall geklärt – größtenteils schlüssig aufgelöst und bis auf in kleineren Details durchaus glaubwürdig. Doch auch nach diesem vermeintlichen Ende gibt es noch einiges Spannendes zu lesen. Auch wenn der Fall abgeschlossen ist, so gibt es für die Protagonisten doch noch Vieles zu tun. Auch hier steigt die Spannung zum Ende hin dann noch einmal gewaltig an und endet mit einem Tusch, der die Romankomposition wunderbar abrundet.
Vom Aufbau her kann man „Verblendung“ durchaus als sehr gelungene Spannungslektüre sehen. Der Plot ist dicht und fein gewoben, der Leser fiebert mit den Figuren mit und der Erzählstil ist so eingängig und leichtfüßig, dass man bei der Lektüre gerne mal die Zeit vergisst. Man bekommt einen Einblick in den Journalistenalltag und blickt den Figuren bei all ihren Aktivitäten stets über die Schulter. Man ist nah am Geschehen, schmunzelt und leidet mit den Protagonisten, die sehr bildhaft und trotz ihrer merkwürdigen Eigenarten lebensnah erscheinen.
„Verblendung“ ist der Auftakt zu Larssons „Millennium-Trilogie“. In Schweden hat sich der Roman so ordentlich verkauft, dass die Verfilmung offenbar bereits in Arbeit ist. Die Filmrechte hat sich übrigens die gleiche Produktionsfirma gesichert, die auch schon Mankells Wallander-Krimis verfilmt hat. Larsson ist mit „Verblendung“ für den „Gläsernen Schlüssel“, den schwedischen Krimipreis, nominiert worden. Larsson selbst war seines Zeichens Journalist und Herausgeber des schwedischen Magazins „EXPO“ – also selbst ein kleiner Mikael Blomkvist. Vielleicht wirkt auch deswegen das Leben von Blomkvist so authentisch. Larsson starb leider schon 2004 fünfzigjährig an den Folgen eines Herzinfarkts.
Kurzum: Mit „Verblendung“ ist Stieg Larsson ein überaus spannend erzählter Roman geglückt. Ob das Ganze nun wirklich die Thriller-Veröffentlichung des Jahres ist, werden wir wohl erst am Jahresende wissen. Dennoch kann man „Verblendung“ getrost weiterempfehlen. Man fiebert mit den Figuren mit, schließt sie in sein Herz und mag sie am Ende des Romans gar nicht mehr verlassen. Der Spannungsbogen strebt kontinuierlich aufwärts und trotzdem besitzt Larsson die Professionalität, seinen Roman gewissermaßen ruhig angehen zu lassen. Freunden spannender Lektüre absolut zu empfehlen, denn mit diesem Buch vergisst man die Zeit.