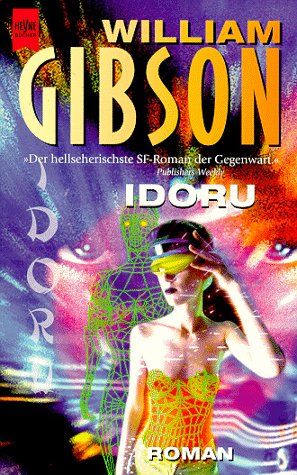
Die Idoru- bzw. Bridge-Trilogie handelt im Allgemeinen von den Anfängen der Cyberspace-Technologie und spielt einerseits an der amerikanischen Westküste, in einem Kalifornien, das sich nach einem Erdbeben in die zwei separaten Staaten NoCal und SoCal aufgeteilt hat, andererseits in einem Tokio, das durch Nanotechnologie wiedererrichtet wurde, nachdem es ebenfalls durch ein Erdbeben Schaden genommen hatte.
Die verschiedenen Teile der Brücken-Trilogie teilen sich ein Grundrepertoire an Figuren: Die wichtigsten sind der Fahrer „Berry“ Rydell und die Fahrradkurierin Chevette Washington. Der Computerhacker Colin Laney, der die mysteriöse Fähigkeit besitzt, Muster aus weiten Datenfeldern herauszulesen, kommt in All Tomorrow’s Parties und in Idoru vor. Ein anderer wiederkehrender Charakter ist die virtuelle „Idoru“ namens Rei Toei.
Das Wort Idoru (eigentlich aidoru) ist eine japanische Umformung von „Idol“. (Wikipedia.de)
Der Erfinder des Begriffs „Cyberspace“ wirft – nach „Neuromancer“ und „Virtuelles Licht“ – einen weiteren Blick in die nahe Zukunft: diesmal in die der Medien und Virtuellen Realität.
Der Autor
William Gibson lebt in Vancouver, British Columbia, jener Gegend, in der auch seine Kollege Douglas Coupland lebt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er fing als Englischlehrer an, floh vor dem Wehrdienst ins kanadische Toronto und schrieb ab Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre Erzählungen, die die Science-Fiction verändern sollten.
William Gibson, geboren 1948, emigrierte 1968 ins kanadische Toronto, nachdem ihn der US-Musterungsausschuss zurückgewiesen hatte. Er lebt seit 1972 in Vancouver, Kanada, wo der asiatische Einfluss sehr stark ist – einerseits durch viele chinesische Einwanderer, andererseits durch die starke japanische und Hongkong-chinesische Wirtschaft. Beides schlug sich in der „Neuromancer“-Trilogie nieder, die Gibson berühmt machte. Er begann aber schon 1977, als er noch Englischlehrer war, Storys zu veröffentlichen. 1983 hatte er bereits sein Kurzgeschichtenwerk mit der Titelstory dieser Sammlung (1986) komplett veröffentlicht.
Der Rest ist Geschichte: Als „Neuromancer“ 1984 erschien, war das wie eine Supernova in einem erschöpften dunklen Himmel, nämlich dem der damaligen Sciencefiction. Denn im Vergleich zu der traditionellen US-amerikanischen Sciencefiction bedeutete die Low-life-Straßengangbevölkerung mit der kriminellen Hightech-Nutzung pure Ketzerei: Amerikanische Straßen hatten sauber zu sein, die Jugendlichen hoffnungsfrohe Sportskameraden oder künftige Mütter (Reagan-Ära!) und die Computerzukunft leuchtete in den rosigsten Farben. Nichts davon findet sich in Gibsons Vision!
Es ist die typisch kanadische Vision der Welt als leere Wildnis, die sich nicht mit Vernunftmitteln begreifen lässt. Die Sehnsucht der Protagonisten gilt einer Selbstübersteigerung, der Transzendenz. In der Neuromancer-Trilogie besteht diese Sehnsucht in dem Entkommen dessen, was das Fleisch dem Geist an Grenzen und Fesseln auferlegt. Der Fluchtpunkt ist oftmals das, was inzwischen besser als „Matrix“ bekannt ist und in diesem Zusammenhang auch zuerst von Gibson verwendet wurde. Damals war es der „Cyberspace“, ein Begriff, den Gibson erfunden hat, um eine Wirklichkeit zu bezeichnen, die aus einer vernetzten Welt der Computer, dem heutigen Internet, besteht, in die man sich aber mit einem Gerät (Deck) „einstöpseln“ kann – etwa, um Daten zu stehlen.
Höhepunkt seiner Entwicklung war der Roman „Neuromancer“, in dem er den „Cyberspace“ postulierte, das, was wir heute als Internet kennen und nutzen. Allerdings stöpselt sich Gibsons Held Case direkt in den Computer ein. Auch an dieser direkten Gehirn-Maschine-Verbindung wird bereits gearbeitet, Geräte für Endverbraucher waren schon auf der CeBIT 2004 zu sehen.
Der Begriff „Cyberpunk“ stammt nicht von Gibson, sondern wurde erstmals 1980 vom Autor Bruce Bethke verwendet. Den übernahm dann der wichtigste Herausgeber von Sciencefiction in den USA, Gardner Dozois, und machte ihn populär. Das Konzept hatte schon 1964 Stanislaw Lem unter dem etwas sperrigen Begriff „Periphere Phantomatik“ aus der Taufe gehoben.
Heute sind Gibsons Visionen auf die sehr nahe Zukunft gerichtet, und seine Romane untersuchen deren Möglichkeiten, sowohl in kultureller, ästhetischer als auch krimineller und moralischer Hinsicht. Insofern ist Gibson heute der herausragende Moralist moderner Sciencefiction.
Sein Werk bestand bis zu „Pattern Recognition“ aus vielen Storys und zwei Roman-Trilogien, der „Neuromancer“- und der „Idoru“-Trilogie. Alle Bücher sind bei |Heyne| erschienen. Doch „Mustererkennung“ erscheint im Juli 2004 bei einem Verlag, der nicht gerade für Science-Fiction bekannt ist, sondern vielmehr für Tolkien und andere Fantasy: bei |Klett-Cotta|. 2019 wurde ihm der Damon Knight Memorial Grand Master Award für sein Lebenswerk verliehen.
Handlung
Während einer Konzerttour durch Japan verliebt sich der US-Rockstar Rez von der Band Lo/Rez („niedrige Bildauflösung“, von „low resolution“) in die schöne, aber virtuelle Kollegin Rei Toei. Sie ist eine Idoru, das ist Japanisch für „Idol“. Wie Kyoko Date und Lara Croft führt sie ein „Leben“ in den Schaltkreisen des Internets. Rez möchte sie unbedingt heiraten.
Dazu braucht er aber offenbar eine nanotechnologische Software – der klassische MacGuffin, hinter dem alle her sind, der selbst aber nie erklärt wird. Jedenfalls hat die russische Mafia, der unter dem Namen „Das Kombinat“ der russische Staat gehört, ein begehrliches Auge darauf geworfen. Sie heuert den „Informationsmusterfischer“ Laney an, der in den unwahrscheinlichsten Verbindungen zwischen Info-Bits, den Knoten, noch intuitive Hinweise entdeckt. Und er wird fündig.
Die süße kleine Chia kommt, den allerneuesten Laptop mit VR-Technik auf dem Schoß, von der Westküste über den Teich nach Tokio geflogen und macht die Bekanntschaft einer netten, aber zwielichtigen Lady, die sich mit ihrem Lover in der großen Stadt trifft. Als es zum Streit zwischen beiden kommt, verzieht sich Chia, findet aber bald darauf ein schwarzes Kästchen in ihrer Tasche – genau, das „Nano-Ding“. Ihre eigentliche Aufgabe, dem Idol ihres Fanclubs, Rez, nachzuspüren, verwandelt sich bald in eine Art Schnitzeljagd, als der Lover sein Nano-Spielzeug wiederhaben will und Laney und die Russen auf Chia ansetzt.
Mit der Hilfe zahlreicher Grenzgänger zwischen empirischer und virtueller Realität, zwischen den Straßen- und den Datennetzen gelingt es Chia, sich halbwegs lebend aus der Affäre zu ziehen. Ein schönes Bild: Tausende kleiner Mädchen winken ihrem Idol Rez zu, so dass Chia und Anhang den Russen entkommen können, weil die Fans den Verkehr blockieren. Natürlich heiraten Rez und Rei Toei – Happyend?
Mein Eindruck
Gibson lässt deutliches Unbehagen in den engen Straßen und winzigen Zimmern der großen Metropole aufkommen. Da kommt die virtuelle Realität daher wie weiland der große weite Westen im Amerika des 19. Jahrhunderts, allerdings mit wesentlich erweiterten Spielregeln. Der Sieger kennt immer das richtige Passwort und zieht sich rechtzeitig vor dem nächsten Virenangriff zurück.
Die seit dem großen Beben zusammengebrochene Skyline Tokios wird mit Hilfe der Nanotechnolgie von den großen Konzernen wiederaufgebaut: Es sieht aus wie eine schmelzende Kerze im Rückwärtsgang.
Unwillkürlich sucht Gibsons Blick die Bruch- und Nahtstellen – darf der Bürger solchen Ausformungen trauen oder liegen sie auf einer Ebene mit „Virtuellem Licht“? Dies ist der Anknüpfungspunkt an Gibsons vorherigen Roman, der ja auch ein Bestseller wurde.
Gibsons literarischer Erfolg beruht darauf, dass er dem Leser ein Gefühl der Welt in wenigen Jahren vermittelt, faszinierend, unheimlich, aber vor allem bilderreich. Die Bilder werden in der virtuellen Realität noch weit mehr und farbiger beschworen als in der sogenannten primären Realität. Hier lenken neue technische Gimmicks wie durchsichtige Laptops, VR-Brillen und -Handschuhe sowie „Nano-Dinger“ die Aufmerksamkeit auf sich.
In „Idoru“, dem „Blade Runner“ der Neunziger (John Williams in GQ), wird aber auch das Bild des Menschen gezeigt, wie er sich an den Bruchlinien der Realitäten entlanglaviert. So mancher bleibt dabei auf der Strecke, je nachdem, ob er sich der angemessenen Methoden bedient, um sich durchzuschlagen.
Viel hängt von den richtigen Kontakten ab, in der Szene, in der Wirtschaft, in der sekundären Welt: So etwa in der „Verborgenen Stadt“, einer multikulturellen VR-Enklave (manche Leute würden Chatroom dazu sagen), aus der Chia und ihr japanischer Hackerfreund Hilfe erhalten.
Als Thriller funktioniert „Idoru“ ganz ordentlich, das ist jedoch sicherlich nicht der Hauptzweck seiner Existenz. Dennoch: ein Muss für jeden SF-Leser, der mitreden will.
Taschenbuch: 332 Seiten.
Originaltitel: Idoru, 1996
Aus dem US-Englischen von Peter Robert.
ISBN-13: 9783453156364.
www.heyne.de
Der Autor vergibt: 




