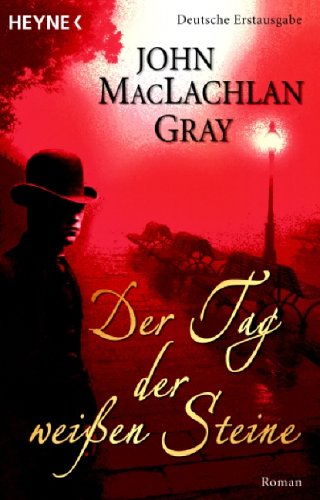London im Jahre 1858: Sechs Jahre sind vergangen, seit Edmund Whitty, Sonderberichterstatter der Zeitung „Falcon“, eine zentrale Rolle bei der Entlarvung des Frauenmörders „Chokee Bill“ spielte. Viele Schlagzeilen und gutes Geld hat ihm dies beschert, doch die Tage des Ruhmes sind lange vorbei. Whitty steckt in einer Pechsträhne. Seit einiger Zeit schnappt ihm ausgerechnet sein erbitterter Konkurrent, Alastair Fraser, die Schlagzeilen weg. Seit Wochen hat Whitty keinen Artikel mehr verkaufen können und steckt in Geldnöten, die umso ernster sind, als er beim „Captain“, einem gefürchteten Wucherer, in der Kreide steht.
In seiner Not übernimmt Whitty einen dubiosen Auftrag: Für einen Detektiv aus den USA soll er das betrügerische Medium Bill Williams entlarven. Die Séance endet im Fiasko, als Williams plötzlich vom Geist David Whittys beherrscht zu sein scheint Sorgfältig hat der Journalist bisher verborgen halten können, dass sein vor sechs Jahren ertrunkener älterer Bruder in der Tat womöglich nicht einem Bootsunfall zum Opfer fiel. Woher kennt Williams die Familientragödie der Whittys? Und wieso wird Edmund wenig später ein Foto zugespielt, das David beim verbotenen Liebesspiel mit einer Minderjährigen zeigt? Soll Edmund erpresst werden? Lebt sein Bruder etwa noch?
Whittys Nachforschungen enden abrupt über der Leiche des ermordeten Mediums. Man hat den Journalisten in eine Falle gelockt, denn er wird als Täter von seinem alten Feind, Inspector Salmon, verhaftet und verschwindet unter falschem Namen im gefürchteten Gefängnis Millbank. Ein unsichtbarer Feind mit schier unbegrenzten Machtmitteln hat ihn ins Visier genommen. Der verzweifelte Whitty hat keine Ahnung, dass sich sein Weg mit dem skrupellosen Herzog von Danbury gekreuzt hat, der einen Zirkel weltfremder Fotografen für ‚künstlerische‘ Aufnahmen mit Modellen versorgt, die ihren Auftritt nicht überleben …
Sittsam und triebhaft
Es ist nicht wirklich paradox, dass es ausgerechnet im England der Königin Victoria, deren moralinsaure und krankhaft sittenstrenge, von 1837 bis 1901 regierende Königin einer ganzen Ära den Namen gab, in Sachen Sexualität besonders krankhaft und gewalttätig zuging. Die strikte Ächtung eines elementaren menschlichen Bedürfnisses führte dazu, dass es unterschwellig befriedigt werden musste – und befriedigt wurde, denn selbstverständlich erweckt vor allem das besondere Interesse, was verboten und verpönt ist. Gleichzeitig macht sich dort, wo das Vergnügen in der Verborgenheit blüht, das Verbrechen breit.
Perfektioniert wird dieser Teufelskreis von einer Gesellschaft, in der ein Mensch vor allem aufgrund seiner gesellschaftlichen Herkunft und seines Rufes etwas gilt. Wenn wir Edmund Whitty zu Beginn der Handlung treffen, ist er ein schmutziger, zerlumpter Pechvogel, der pleite in einem verlausten Männerheim haust. Trotzdem begegnet man ihm mit Respekt; Whitty ist kein Ausgestoßener, sondern ein Gentleman, der gerade in einer gewissen finanziellen Verlegenheit steckt. Darüber sehen seine Standesgenossen höflich hinweg, denn es ändert nichts an seinem Status. Den verliert man erst, wenn man gegen den Ehrenkodex des Gentlemans verstößt.
Dies droht Whitty, als bösartige Feinde das Gerücht in die Welt setzen, Whitty sei homosexuell, was 1858 als Verbrechen geahndet wird. Erst jetzt gerät Whitty in Panik, denn verliert er seine Ehre, ist er endgültig erledigt in seiner Welt, die kein soziales Netz kennt: Wer verschuldet oder unverschuldet ins Elend gerät, wird wahrscheinlich dort enden. Was das bedeutet, weiß Gray in drastischen Zeitbildern deutlich zu machen: Es ist ein Schicksal, das den raschen Tod als Alternative durchaus verlockend wirken lässt.
Technischer Fortschritt im Dienst des Verbrechens
Das Fotografieren weiblicher Akte ist definitiv ein Delikt, das eines Ehrenmanns unwürdig ist. Erst seit kurzer Zeit ist es möglich, nackte Frauen und Männer in ‚gewagten Posen‘ auf Bildplatten zu bannen. Der Wunsch, dies zu tun, taucht weltweit fast zeitgleich mit der technischen Möglichkeit auf und ist auch in der viktorianischen Epoche präsent. Dieses Hobby grenzt gefährlich nahe an der Pornografie, es auszuüben ist riskant und kostspielig. Stand und Vermögen ermöglichen die Schaffung eines Reservats, in dem man ihm unbemerkt frönen kann. Der Herzog von Danbury ist bereit, einer Gruppe entsprechend motivierter Fotografen gegen die Zahlung einer ‚Schutzgebühr‘ unter seine Fittiche zu nehmen. Er kann sich dies leisten, weil er als Angehöriger des höchsten Adelsstandes praktisch unangreifbar ist. Man wird ihn irgendwelcher Schandtaten nicht einmal verdächtigen, weil er ein von Gottes Gnaden in sein Amt eingesetzter „edeling“ ist.
Hier zeigen sich Bigotterie und Heuchelei der viktorianischen Gesellschaft ungeschminkt. Zeitlos ist dagegen der Selbstbetrug der „Oxford Photographic Society“. Ihre Mitgliedern tun sich zusammen, verdrängen kollektiv das Wissen um eine mögliche Schuld und schaffen sich die Illusion einer höheren künstlerischen Vision, der sie angeblich folgen, ohne auch nur einen Gedanken darauf zu verwenden, wie ihre Modelle darüber denken. Sie alle balancieren gefährlich nahe am Abgrund der Päderastie; ein Gedanke, den sie weit von sich weisen würden. Schuldig sind sie allemal: schuldig des Verbrechens, sich den menschenverachtenden Seiten ihrer ‚Kunst‘ nicht stellen zu wollen.
Gray macht sich das heikle Thema mit Bedacht zu Eigen bzw. integriert es in einen Plot, den er zusätzlich mit Elementen einer Verschwörung, einer Rachestory sowie mit einem düsteren Familiengeheimnis anreichert. Der Handlungsbogen wird straff gespannt, die Handlung ist spannend, rabenschwarzer Humor und bissige Sarkasmen sorgen für notwendige Auflockerung. Mindestens ebenso wichtig ist die Hintergrundstimmung. Von der süßlichen Nostalgie, die allzu oft durch die Szenerie des Historienromans wabert, ist bei Gray nichts zu spüren. Der viktorianische Alltag verdammt die Menschen zu einem Leben, das dem eines Gefangenen gleicht: Immer muss man auf der Hut sein, um nicht gegen ein geschriebenes Gesetz oder eine ungeschriebene Regel zu verstoßen. Gesprächsäußerungen wollen genau bedacht sein, denn sie werden genau registriert, gewogen und auf die genannten Verstöße überprüft. Kein Wunder, dass die Gesellschaft erstarrt und verkrustet wirkt; man geht auf Nummer Sicher und verhält sich unauffällig. Allerdings kann nicht jeder emotionale Druck auf diese Weise unter Kontrolle gehalten werden; er sucht sich seine Ventile und entlädt sich auf schädliche Weise.
Anti-Held gegen Edel-Heuchler
Als positiver Held und Drachentöter in dieser schändlichen Geschichte taugt Edmund Whitty sicherlich nicht. Mit großer Sorgfalt hat ihm sein geistiger Vater John MacLachlan Gray beinahe jede mögliche Schwäche auferlegt, derer ein Mensch sich schuldig machen kann. Whitty säuft, konsumiert Rauschgift in abenteuerlichen Mischungen und Mengen, ist spielsüchtig, ein chronischer Lügner. In einem Punkt erfüllt er jedoch das Klischee des gebrochenen aber unbestechlichen Detektivs, der er eigentlich ist: Whitty ist mit Herz und Seele Journalist, er verbeißt sich in seine Storys, ohne mögliche Folgen zu bedenken. Schon mehrfach ist es mit ihm durchgegangen, hat er Berichte verfasst, die den Großen und Mächtigen sehr missfielen, weil sie ihre Verlogenheit, Gier und Gleichgültigkeit offen legten.
Ein ganz besonders ehrloses Mitglied seiner Oberschicht ist der Herzog von Danbury. Er ist eine interessante Figur, da Gray es gelingt zu verdeutlichen, dass Danbury sich nicht als Krimineller sieht, sondern es als sein Recht betrachtet, unter Einsatz aller möglichen Mittel jene gesellschaftliche Spitzenstellung zurückzugewinnen, die einzunehmen er für sein Recht hält. Mehrfach spricht Gray die aus heutiger Sicht unerhörten, dem Gesetz und den Menschenrechten Hohn sprechenden Privilegien des zeitgenössischen Adels an, der noch immer und quasi wie im Mittelalter über Leben und Tod seiner Untertanen bestimmen kann. Für Danbury sind die Mädchen, die er verschleppen und ermorden lässt, keine menschlichen Wesen, sondern Mittel zum Zweck. Er spürt keine Reue, sondern prahlt in der Gewissheit seiner Unantastbarkeit höhnisch mit seinen Untaten.Juristisch kann man Danbury nicht beikommen. Nur von Rache gelenkte Selbstjustiz wird ihn schließlich stoppen – kein Ende, das happy ist und aufmuntert, aber sehr realistisch wirkt.
Der schmale Grat
Die Figur des Vikars und Privatlehrers William Boltbeyn hat ihre reale Entsprechung in der Person des Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), der unter seinem Künstlernamen „Lewis Carroll“ Weltruhm als Verfasser der Romane „Alice im Wunderland“ (1865) und „Alice hinter den Spiegeln“ (1871) erwarb. Berühmt sind außerdem seine intelligenten mathematischen Rätsel und seine witzigen Nonsens-Reime.
Darüber hinaus war Dodgson ein Pionier der Fotografie. Sein künstlerischer Nachruhm wird indes seit Jahrzehnten durch einen bösen Verdacht getrübt. Dodgson besaß eine Vorliebe für sehr junge Mädchen, in deren Gesellschaft er, ansonsten ein betont viktorianischer Gentleman, auffallend locker wurde und die er auch nackt fotografierte. Es gibt keinen Beweis dafür, dass er die Grenzen des Schicklichen oder gar des Gesetzes überschritt, doch ein Schatten bleibt. 1880 hörte Dodgson spontan mit dem Fotografieren auf und vernichtete systematisch seine Aktaufnahmen. Nach seinem Tod tilgten die Erben Teile seiner Tagebücher; die Gründe bleiben unklar.
Gray macht Dodgson/Boltbeyn zur tragischen Gestalt: Ein unglücklicher, geistreicher, gefühlsstarker, aber in der geistigen Enge seiner Ära gefangener Mann projiziert den Wunsch nach einer besseren Welt mit liebenswerteren Bewohnern in ‚unschuldige‘ Kinder. Wie besessen baut er an seiner Traumwelt und wird darüber blind für die Realität. Dies lässt Boltbeyn zum idealen Komplizen für Danbury werden, der den naiven Geistlichen als Strohmann und sogar Köder für seine abscheulichen Verbrechen missbraucht.
Makabrer Hintergrund-Chor
Erneut gelingen dem Verfasser Gray einige bemerkenswerte Nebenfiguren, unter denen die Söldner Weeks und Robin besonders schaudern lassen. In den indischen Kolonien haben sie ihre körperliche und geistige Gesundheit geopfert. Wie andere invalide Soldaten hat man sie ausgemustert und ihrem Schicksal überlassen. Das Duo, das im Kampf schreckliche Gräuel erlebt und begangen hat, ist zurückgekehrt und hilflos im Mahlstrom der erbarmungslosen Megalopolis London versunken, bis der skrupellose Herzog von Danbury sie fand und als ideale Instrumente für den Fang seiner ‚Modelle‘ entdeckte. Sehr förmlich und höflich und mit mehr als dem Hauch eines schlechten Gewissens gehen Weeks und Robin miteinander um: ein bemerkenswerter Kontrast zur Brutalität ihrer Taten. Ihr Ende gehört zu den ironischen Meisterleistungen Grays, der mit fabelhaften Einfällen wahrlich nicht geizt!
Die Übersetzung von „Der Tag der weißen Steine“ (der Titel spielt übrigens auf Boltbeyns gruseliges Fähigkeit an, die Augen davor zu verschließen, was mit seinen ‚Modellen‘ geschieht – er weiß mehr, als er sich selbst zugeben mag) dürfte keine einfache Aufgabe gewesen sein. Gray arbeitet u. a. in Carrollscher Manier mit Gedichten, die verschlüsselte Botschaften darstellen. Mit einem simplen Eindeutschen war es in diesem Fall nicht getan. Die Herausforderung wurde angenommen und glänzend bestanden.
Autor
John MacLachlan Gray, geboren 1946, zählt zu den Menschen, die den Ehrentitel „Multitalent“ wahrlich verdienen. Begonnen hat er noch während des Studiums als Theaterautor, wobei er die Bühne – das Tamahnous – gleich selbst gründete. 1978 schuf Gray mit „Billy Bishop Goes to War“ einen modernen Theaterklassiker, für den er vielfach preisgekrönt und von der Kritik weltweit gefeiert wurde
1982 überraschte Gray mit dem erfolgreichen Musical „Rock and Roll“, aus dem der mit dem „Oscar“ ausgezeichnete Begleitfilm „The King of Saturday Night“ wurde. 1989 ging Gray zum Film und schrieb bis 1992 65 satirische Beiträge für „The Journal“, in denen er außerdem selbst auftrat. Gleichzeitig verfasste er Kolumnen für diverse Zeitungen.
Wiederum Neuland betrat Gray in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Er versuchte sich als Schriftsteller, was mit dem für ihn schon üblichen Erfolg gewürdigt wurde. Mehrere Romane hat Gray, der übrigens im kanadischen Vancouver lebt, inzwischen verfasst.
Taschenbuch: 399 Seiten
Originaltitel: White Stone Day (New York : St. Martin’s Minotaur 2005)
Übersetzung: Edith Walter
http://www.heyne-verlag.de
Der Autor vergibt: