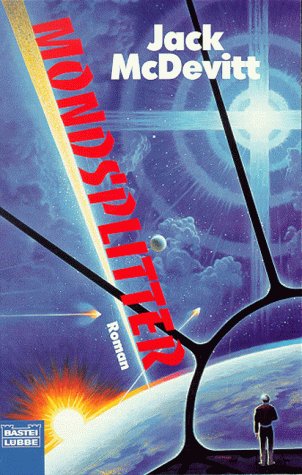
Das geschieht:
Die Welt (vom US-amerikanischen Blickwinkel aus betrachtet) im Jahre 2024: Auf der Erde hat sich im Vergleich zu heute wenig geändert. (Man fährt allerdings mit Elektro-Autos umher.) Dafür tut sich im Weltall allerhand. Die Menschen sind auf den Mond zurückgekehrt. Allen Widerständen und Kosten zum Trotz haben die USA dort eine feste und ständig besiedelte Station eingerichtet, auf der betuchte Zeitgenossen sogar einen luxuriösen Urlaub verbringen können. Der nächste logische Schritt ist geplant. Im Orbit der Erde bereiten sich die Teilnehmer der ersten bemannten Mars-Expedition auf ihre mehrjährige Reise vor.
Im Trubel um Mondbasis und Mars-Flug geht die Entdeckung einer Amateur-Astronomin zunächst völlig unter. Sie hat während einer Sonnenfinsternis zufällig einen bisher unbekannten Kometen entdeckt. Rasch stellt sich heraus, dass dieser mit unheilvoller Präzision auf den irdischen Mond zielt. Der Zusammenprall wird in nur drei Tagen erfolgen, und er wird den Erdtrabanten in Stücke reißen. Die Trümmer werden die Erde treffen und gewaltige Flutwellen, Erdbeben und andere Naturkatastrophen verursachen.
Die düsteren Prophezeiungen werden Wirklichkeit, die gesamte Welt wird schrecklich heimgesucht. Rasch geht die Zahl der Opfer in die Millionen, werden ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht. Als das Schlimmste überstanden scheint, entdeckt man ein kilometergroßes Trümmerstück des Mondes, das langsam auf die Erde zudriftet; sein Aufprall würde den endgültigen Untergang der menschlichen Zivilisation verursachen.
Ein verzweifelter Rettungsplan wird ersonnen. Alle Raumfahrzeuge der Welt starten mit dem Ziel, den „Possum“ genannten Felsbrocken mit der Kraft ihrer Triebwerke so weit aus seiner Bahn zu lenken, dass er die Erde verfehlt …
Das Ende ist (wieder einmal) nahe!
Man stelle sich folgenden Wettbewerb vor: Gesucht wird das Literatur-Genre, das den höchsten Anteil an Reißbrett-Dramaturgie, Handlungs-Klischees und Schablonen-Figuren aufweist. Mit ganz oben auf dem Siegertreppchen stünde mit ziemlicher Sicherheit der Katastrophen-Roman (und neben ihm sein Zwilling, der Katastrophen-Film).
Ob Roman oder Drehbuch – die Gesetze der Dramaturgie scheinen in Erz gegossen zu sein: Eine Gruppe von Personen, die insgesamt einen mehr oder weniger repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung darstellen, wird dem Leser oder Kinobesucher vorgestellt und gleichzeitig ans Herz gelegt. Während sich der Autor bemüht, seine Figuren möglichst ‚menschlich‘ wirken zu lassen, beginnt im Hintergrund das Verhängnis zu dräuen. Es kann ein brennendes Hochhaus sein, ein kenterndes Luxusschiff, ein brechender Damm, ein Erdbeben oder eben ein auf die Erde zurasender Komet/Asteroid/Meteorit; wichtig ist, dass mindestens eine menschliche Urangst angesprochen wird.
Es kommt – mit Verzögerungen
Jack McDevitt exerziert den Verlauf geradezu exemplarisch durch: Das Unheil nähert sich (im Kino eher langsam, um Geld für teure Spezialeffekte zu sparen), während im Buch die Zahl der Figuren kontinuierlich zunimmt, bis sich an allen Brennpunkten der zukünftigen Katastrophe wie zufällig mindestens ein Zeuge aufhält. Wie Ratten in einem Versuchslabor sehen wir unsere neu gewonnenen Freunde auf das nahende Verhängnis reagieren. Da gibt es Helden, die für Gott und Vaterland gegen das Verderben kämpfen (wackere Bürger der USA, wo selbst ein Tellerwäscher zum Weltenretter werden kann, wenn er nur an sich glaubt), Feiglinge, die nur die eigene Haut retten wollen oder (was noch viel schlimmer ist) sich gar in ihr Schicksal fügen, und ganz normales Volk, das als Kanonenfutter dient, wenn der Hammer schließlich fällt. Nie fehlt ein Kind (meistens auch ein Hund), das gerettet werden muss, wobei mindestens einer der Helden sein Leben lässt.
Dann endlich tritt die Katastrophe ein – dies sind die wenigen Minuten, auf die wir im Kino warten – und es gibt eine Menge Scherben und Unordnung. Es bleibt dem Autor überlassen, in welcher Breite er das weitere Schicksal der Überlebenden schildert, oder ob er es bei einem zuversichtlichen Blick auf die wider Erwarten doch wieder aufgehende Sonne belässt.
Wieso macht es trotzdem so viel Spaß, immer wieder diese Geschichte zu lesen oder zu sehen? Vermutlich steckt jener Drang dahinter, der die Menschen dazu veranlasst, bei einem Autounfall zu gaffen oder sich Casting-Shows im Privatfernsehen anzuschauen: Auch ein Unglück kann seine unterhaltsamen Seiten haben, wenn man nicht selbst betroffen ist.
In die Breite gehende Apokalypse
Seltsam, dass die Autoren von Katastrophen-Romanen offenbar glauben, ihr infernalisches Untergangs-Panorama gewinne an Glaubwürdigkeit, je höher die Zahl der auftretenden Figuren und Schauplätze ist. Erneut ist McDevitt keine Ausnahme: „Mondsplitter“ bringt es auf stolze 700 Seiten. Natürlich lässt sich argumentieren, dass es schon seinen Platz braucht, die ganze Welt zu zerstören.
Sei´s drum, denn wie so oft kommt es weniger darauf an, das Rad neu zu erfinden, als längst bekannte Versatzstücke auf möglichst geschickte Art zusammenzusetzen. In dieser Hinsicht leistet McDevitt ordentliche Arbeit. Ob er dabei die Bereitschaft seiner Leser, sich auf die Geschichte einzulassen, nicht ein wenig zu arg strapaziert, muss jede/r selbst entscheiden: McDevitts Asteroid trifft die Erde nicht direkt, sondern zuerst den Mond, der wie eine alte Bierflasche zerbirst und den Mutterplaneten mit seinen Splittern zu durchsieben beginnt – nun ja.
Im Rahmen seiner durch das Genre eingeschränkten dramaturgischen Möglichkeiten bemüht sich McDevitt, den ärgsten Klischees auszuweichen, was ihm allerdings nicht immer gelingt. Immerhin: Seinen Wissenschaftlern glaubt die Welt sofort, dass der Komet den Mond treffen wird. Sie müssen nicht als einsame Rufer in der Wüste ihre Zeit damit verbringen, ungläubige Politiker und Militärs davon zu überzeugen.
Verschont bleiben die Leser auch von Knallchargen wie den wahnsinnigen Weltuntergangspropheten, der im Angesicht des Untergangs ein Millionenheer plötzlich fromm gewordener Anhänger um sich scharen und einen Krieg gegen die ‚sündhafte‘ Zivilisation anzetteln kann. (Allerdings tauchen zwei abgedrehte rechtsradikale Milizionäre auf, denen es beinahe gelingt, im Alleingang die finale Rettungsaktion zu torpedieren: einer von McDevitts weniger gelungenen Einfällen.)
Patriotismus als Leserfang
Weil Jack McDevitt ein US-amerikanischer Autor ist, spart er nicht an Pathos und Patriotismus. Zufällig befindet sich der Präsident der Vereinigten Staaten auf der Mondbasis; er wird sich später an diversen Rettungsaktionen beteiligen und nimmt sich dennoch immer wieder die Zeit, seine Landsleute und – wenn schon, denn schon – den Rest der Welt mit markigen Durchhalteparolen zu beglücken. Immerhin verschweigt McDevitt nicht die andere Seite der Medaille; selbst am Rande der schlimmsten Katastrophe treten neben Gemeinschaftsgeist und Heldenmut wie selbstverständlich Eigennutz und politisches Kalkül.
Als McDevitt „Mondsplitter“ schrieb, spielte die Handlung ein Vierteljahrhundert in der Zukunft. Aus einem Katastrophen-Roman wurde ein Science-Fiction-Katastrophen-Roman. Allerdings sprengt das Ergebnis nie die weiter oben skizzierten Grenzen. Bewundernswert ist McDevitts Optimismus; er wagt die kühne Prognose, dass eine Rückkehr ins All nur eine Frage der Zeit sei. Tatsächlich sieht es eher so aus, als werden die einzigen Menschen 2024 dort richtig reiche Touristen sein, die sich von privaten Fliegern ins erdnahe All befördern lassen, um dort in der Schwerelosigkeit die Sektkorken knallen zu lassen.
Unterm Strich lässt sich trotz einiger Abstriche sagen, dass Jack McDevitt zwar das Pulver nicht neu erfunden, aber gutes Lesefutter produziert hat. Man muss dieses Buch nicht lesen, wenn man auch nur ein anderes Genre-Werk kennt, und ja – würde man den Text um die Hälfte kürzen, fiele dies überhaupt nicht auf. Trotzdem unterhält „Mondsplitter“ über die volle Distanz, und das ist eine stolze Leistung für ein Buch, das sich beim leicht mit einem bunten Ziegelstein verwechseln lässt.
Autor
John Charles „Jack“ McDevitt wurde 1935 in Philadelphia geboren. Nach dem College diente er in der US-Navy (1958-1962), anschließend arbeitete er als Englischlehrer. Ende der 1960er Jahre kehrte McDevitt an die Universität zurück und studierte Literatur. 1971 schloss er mit einem Master-Grad ab. Ab 1975 war McDevitt für das US-Zollamt tätig. 1995 ging er in den Ruhestand.
Nachdem er sich in seiner Collegezeit durchaus erfolgreich als Schriftsteller versucht hatte, gab McDevitt das Schreiben auf. Erst 1980 griff er wieder zur Feder; eine erste Kurzgeschichte („The Emerson Effect“) erschien 1981 im „Twilight Zone Magazine“. „The Hercules Text“ (dt. „Erstkontakt“), McDevitts Romandebüt, schilderte 1986 die Begegnung zwischen Menschen und Außerirdischen – ein Thema, dass der Autor immer wieder aufgreift.
Seit 1995 hat McDevitt sein Veröffentlichungstempo erheblich gesteigert. Neben Einzel-Romanen erscheinen regelmäßig neue Folgen seiner Serien um den kosmischen Antiquitätenjäger Alex Benedict und die Raumpilotin Priscilla Hutchins.
Taschenbuch: 700 Seiten
Originaltitel: Moonfall (New York : HarperCollins 1998)
Übersetzung: Thomas Schichtel
Titelbild: Oliviero Berni
www.luebbe.de
www.jackmcdevitt.com
Der Autor vergibt: 




