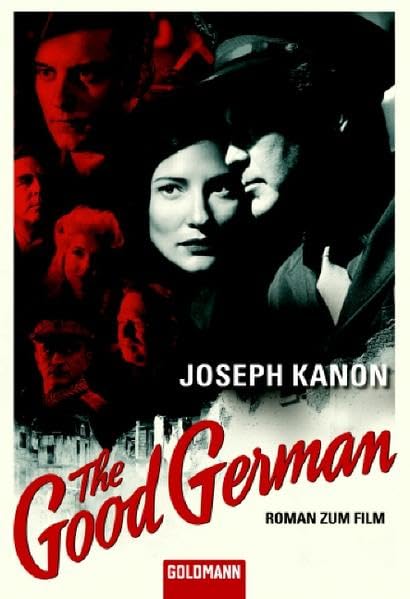Jacob „Jake“ Geismar hat als US Auslandskorrespondent ab 1936 erfolgreiche Jahre in Deutschland verbracht, bis Propagandaminister Josef Goebbels ihm wegen offen nazifeindlicher Äußerungen die Abreise dringend nahelegte. Zurück ließ Geismar Lena, die Liebe seines Lebens, deren Gatte, der Mathematiker Emil Brandt, ein guter Freund des Amerikaners war, ohne vom Ehebruch zu wissen. Lenas wegen kehrt Geismar im Juli 1945 zurück. Außerdem soll er über den Alltag in der von den vier Siegermächten besetzten Hauptstadt berichten.
Berlin ist eine gigantische Geister und Totenstadt. In der endlosen Ruinenwüste fristen die Überlebenden ein von Not geprägtes Leben. Die Amerikaner sehen die Besatzung pragmatisch. Geismar erlebt, wie hier Kriegsverbrecher gestellt und verurteilt werden, während dort andere heimlich aus dem Land geschmuggelt werden, weil sie über wissenschaftliches oder technisches Wissen verfügen, das den Siegern wichtiger ist als Gerechtigkeit. Zudem beteiligen sich Besatzungssoldaten an Schwarzmarktgeschäften, verschieben gestohlene Kunstschätze, handeln mit Entnazifizierungs Papieren eine Unterwelt, in die es Geismar durch den Mordfall Patrick Tully verschlägt. Der US- Lieutenant hatte Emil Brandt zur Flucht aus einem Internierungslager verholfen. Brandt wird es zu Lena ziehen, die Geismar inzwischen ausfindig machen konnte. Sie haben ihr Verhältnis wieder aufgenommen.
Dass Geismar unabsichtlich in ein Wespennest gestochen hat, weiß er, als ein brutaler Mordanschlag auf ihn verübt wird. Er gerät in ein schmutziges Gewimmel alter und neuer Nazis, korrupter Politiker, skrupelloser Geheimdienste und betrügerischer ‚Geschäftsleute‘. Die Grenzen zwischen Amerikanern, Russen und Deutschen beginnen zu verschwimmen: Sie alle kämpfen um Macht, Geld oder das nackte Überleben und lassen nicht zu, dass man ihnen in die Quere kommt …
Hoher Anspruch, matte Umsetzung
„In den Ruinen von Berlin“ ist kein Historienthriller, sondern eine Mischung aus historischem Panorama, Liebesgeschichte und Krimi. Mal steht das eine, dann das andere Element im Vordergrund. Insgesamt entstand ein Werk, wie es die Kritik liebt: keine reine und damit verdächtige Unterhaltung, sondern Literatur mit Anspruch. Das Ganze krönt ein provozierender (Original-) Titel: „The Good German“. Was mag die versteckte Bedeutung sein?
Man kann Joseph Kanon dabei keine Berührungsängste vorwerfen. Die Beschäftigung mit dem „Dritten Reich“ und seinen Folgen fordert besonders hierzulande umgehend Diskussionen heraus. Objektivität ist quasi unmöglich, jede Äußerung wird auf die Goldwaage gelegt und mehr als einmal nachgewogen; Gnade Gott dem armen Teufel, der da Fehler begeht und die sind unvermeidlich!
Kanon steht ein bisschen außerhalb der Schusslinie. Als US Amerikaner wird man ihn vorsichtiger bzw. eher wegen literarischer Vergehen kritisieren. Die finden sich in seinem ehrgeizigen Werk reichlich, aber davon später. Zunächst gilt es festzuhalten, dass „In den Ruinen von Berlin“ fesseln kann, weil Kanon sich mit der Rekonstruktion einer Welt im Ausnahmezustand der „Stunde Null“ große Mühe gegeben hat.
Immer wieder gelingen Kanon eindringliche Szenen der unmittelbaren Nachkriegs Gegenwart. Daneben bleibt die Handlung allerdings auf der Strecke. Nüchtern betrachtet ist dieses (zu) oft eine ausgedehnte Sightseeing Tour durch die „Ruinen von Berlin“. Der Thriller-Plot ist Aufhänger und Vehikel, soll eine eigentliche Handlung in Gang bringen und halten. Sie lässt in Sachen Spannung und Logik viel zu wünschen übrig. Sehr viel Aufwand, doch das Ergebnis, die Auflösung, wird dem nicht gerecht.
„Es gab auch gute Deutsche“
Stattdessen schlingert Kanon gefährlich dicht über Kriegsklischee Klippen. Direkt vergleichen möchte man „In den Ruinen von Berlin“ zum Beispiel mit dem Kinoklassiker „Judgement at Nuremberg“ (1961, dt. „Das Urteil von Nürnberg“), ein gutgemeinter und redlich in Szene gesetzter aber aus heutiger Sicht melodramatischer und bemühter Film über die Kriegsverbrecherprozesse von Nürnberg.
Dieselbe Kritik trifft die Liebesgeschichte zwischen Jake und Lena. Letztere muss im Alleingang das gesamte Kriegselend der deutschen Frau auf ihren Schultern tragen, bis man bei der Lektüre leise zu stöhnen beginnt: Bleibt ihr (und uns) wirklich gar kein Schicksalsschlag erspart? Abgesehen davon plagt die Frage, was Lena für Jake denn so begehrenswert werden lässt. Dem Leser erschließt sich das jedenfalls nicht.
„The Good German“ lautet der Originaltitel dieses Romans. Der „gute Deutsche“ ist Jake Geismar, der deutsche Wurzeln besitzt, nach dem Krieg unvoreingenommen nach Berlin zurückkehrt und sich dort nicht in den moralischen Sumpf ziehen lässt. Freilich kann man ihn auch als Toren bezeichnen, der nie oder zu spät die hiesigen Spielregeln begreift, an die er sich ohnehin nicht halten würde. Deshalb begeht er quasi die Todsünde, gegen den Strom zu segeln, wo er sein Fähnchen besser nach dem Wind drehen sollte.
Geismar will (in Vertretung des Lesers) wissen bzw. verstehen, auch wenn er praktisch jedes Mal scheitert: Seine ehemaligen deutschen Arbeitskollegen und Freunde haben die Menschenrechte nach Nazi-Art mit Füßen getreten. Oder haben sie sich verführen lassen? Wurden sie gezwungen? Wenn Geismar die Wahrheit erkannt zu haben glaubt, verkehrt sie sich wieder ins Gegenteil: Die Schuldfrage ist schwer oder gar nicht zu klären, wenn die Schuld gleichzeitig ungeheuerlich und alltäglich ist.
Gewonnen, zerronnen, neu verteilt
Desillusionierend ist der Blick auf die Siegermächte. Ganz offen rechnen die Russen ab. Sie fühlen sich dabei im Recht. So einfach machen es sich die Amerikaner nicht. Sie sind durchaus guten Willens, wollen nicht nur strafen, sondern helfen. Doch sie kamen unvorbereitet: Wo sie nicht mehr kämpfen müssen, sind sie überfordert von der Aufgabe, ein am Boden liegendes Land zu verwalten und seinen Bürgern einen Neuanfang zu ermöglichen.
Kriminelle Elemente machen viel von dem Wenigen zunichte, das trotzdem geschafft wird. Aber betrogen wird sogar in (halb) offiziellen Auftrag: Wer Nazi ist, bestimmen die alliierten Geheimdienste. Schon beginnt sich abzuzeichnen, dass es bald West gegen Ost heißen wird. Die USA wollen vorbereitet sein, schaffen heimlich Wissen und Wissenschaftler auf die Seite.
Idealisten sind daher fehl am Platze in Berlin. Es gibt sie, und sie sind ernsthaft bemüht, die Schuldigen für den organisierten Massenmord an Deutschlands Juden sühnen zu lassen. Eine Sisyphusarbeit, zumal die Vertreter sogar im eigenen Lager als Störenfried gelten, die manchen für die USA günstigen Kuhhandel zu vereiteln drohen.
Die realen Größen der Berliner Nachkriegsgeschichte lässt Kanon klugerweise nur am Rande auftreten. Churchill, Truman oder Stalin mischen sich nicht ins Geschehen ein; Geismar sieht sie hin und wieder in Berlin, wie sie angeblich wichtigen politischen Aufgaben nachgehen; was Kanon uns von ihnen zeigt, lässt uns das schwer glauben. Er übergießt sie nicht mit Spott, sondern verdeutlicht am Beispiel der Prominenz, dass diese wie stets in der großen Politik mit ihren Gedanken ganz woanders und sicher nicht bei den Menschen in Berlin ist.
„The Good German“ als Film
2006 inszenierte Stephen Soderbergh Kanons Roman als Hommage an das alte Hollywood-Kino – schwarzweiß und unter Einsatz technischer Geräte, wie sie in den 1940er Jahren eingesetzt wurden. „The Good German“ wurde prominent besetzt. Gutmensch George Clooney übernahm die männliche Hauptrolle (Jake Geismar), Cate Blanchard die weibliche (Lena Brandt). In Nebenrollen sah man Tobey Maguire (Patrick Tully) und Beau Bridges (Colonel Muller).
An der Kinokasse erwies sich „The Good German“ als veritabler Flop. Das Budget von 32 Mio. Dollar wurde nur bruchteilhaft eingespielt. Die Kritik legte offen, was auch der Leser der Romanvorlage bemerken konnte: Sowohl Autor Kanon als auch Regisseur Soderbergh legten das Schwergewicht nicht auf eine schlüssige Story oder eine stimmig ausgearbeitete Figurenzeichnung. Kanon ging es um das Thema Schuld & Sühne, während Soderbergh vor allem daran interessiert schien, „The Good German“ möglichst perfekt wie einen Film von 1945 aussehen zu lassen. Nicht jeder Zuschauer war interessiert oder überhaupt in der Lage, diese Spielerei zu würdigen, weshalb „The Good German“ als manieriert und gefühlskünstlich empfunden und abgelehnt wurde.
Autor
Joseph Kanon wurde 1946 im US-Staat Pennsylvania geboren. Er studierte Englische Literatur an der Harvard University sowie am Trinity College in Cambridge, Massachusetts. Außerdem ging er für einige Zeit nach England. Schon in dieser Zeit entstanden erste Kurzgeschichten, die vor allem in der Zeitschrift „The Atlantic Monthly“ erschienen.
Nach seinem Abschluss und wieder in den USA rezensierte Kanon Bücher für die „Saturday Review“. Er strebte eine Verlagslaufbahn an und arbeitete er sich die Karriereleiter hinauf. Kanon leitete schließlich die Verlage Houghton Mifflin und E. P. Dutton in New York, wo er noch heute lebt.
Seit 1995 widmet sich Kanon dem Schreiben. Schon sein Romandebüt „Los Alamos“ (dt. „Die Tage von Los Alamos“) wurde von der Kritik gelobt, mit einem „Edgar Allan Poe Award“ ausgezeichnet und gut verkauft. Mit weiteren Werken konnte Kanon diesen Erfolg wiederholen und festigen. Die Handlung verlegt er gern in die Vergangenheit der 1940er bis 50er Jahre; als Kristallisationspunkt dient ein reales Ereignis. Überhaupt verquickt Kanon wie Graham Greene, Eric Ambler oder John Le Carré seine Geschichten gekonnt mit der politischen Realität der gewählten Epoche.
Taschenbuch: 608 Seiten
Originaltitel: The Good German (New York : Henry Holt and Company 2001)
Übersetzung: Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
http://www.randomhouse.de/goldmann
Der Autor vergibt: