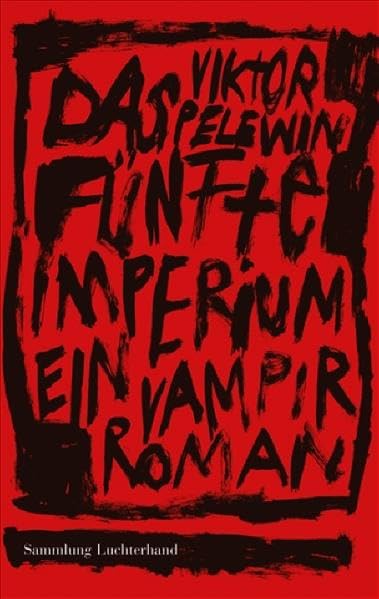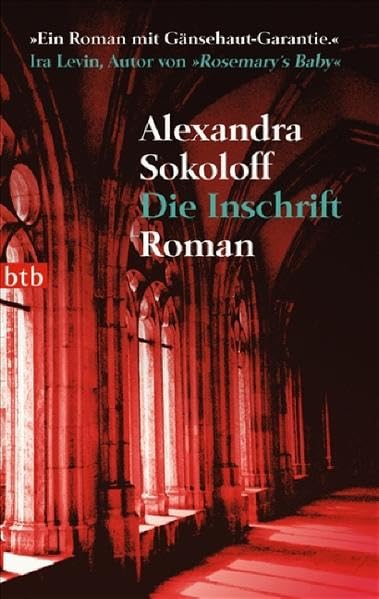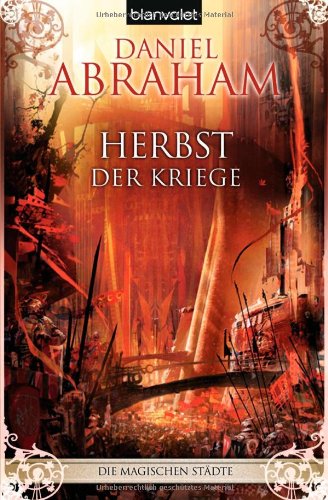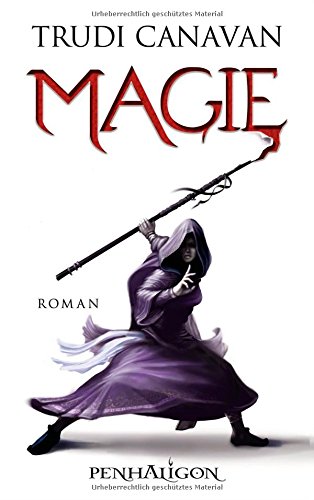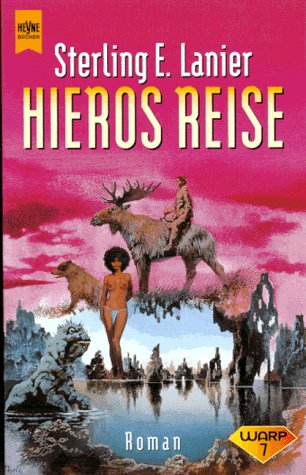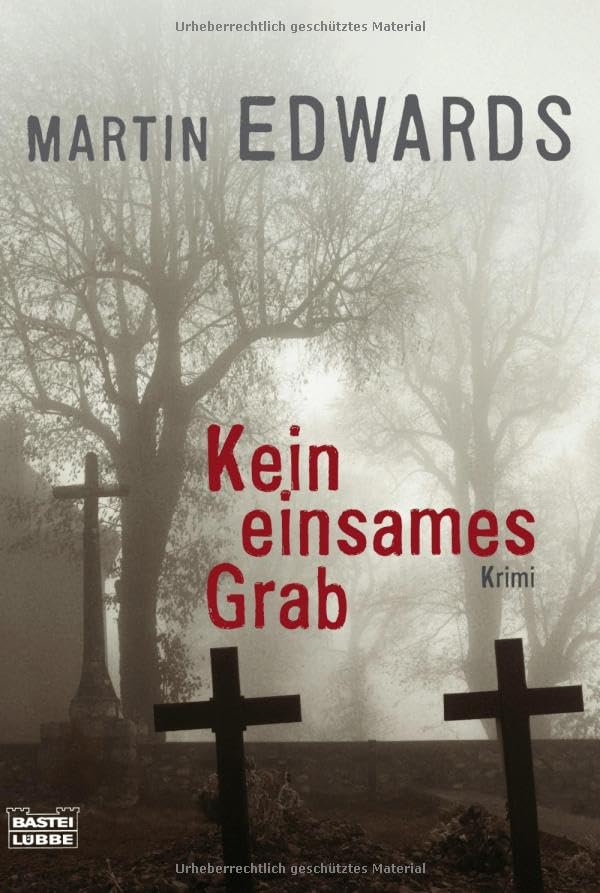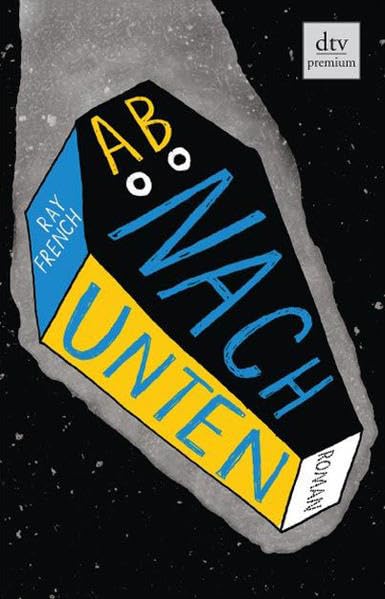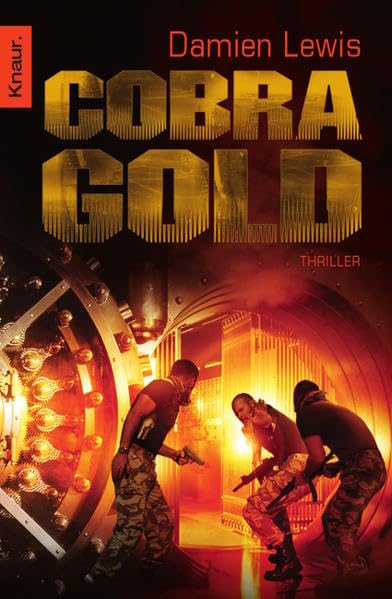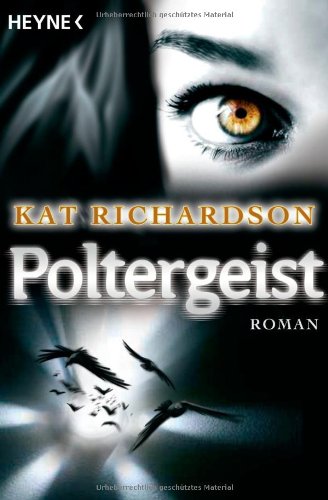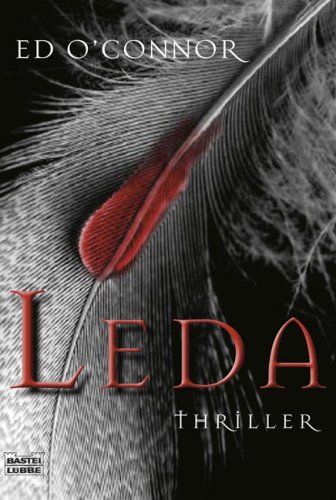_Das geschieht:_
Der 19-jährige Roma gehört zu denen, die vom wirtschaftlichen Aufstieg im neuen Russland definitiv nicht profitieren. Mit seiner Mutter haust er in einer winzigen Wohnung und schlägt sich als Billiglohnsklave einer Supermarktkette durch, als ihm das Glück eines Tages auf denkbar ungewöhnliche Weise hold ist: Roma wird entführt und in einen Vampir verwandelt! Als solcher gehört er nunmehr zu den Herren dieser Erde. Die Menschen, so erfährt er, sind nur genetische Produkte der Vampire, die sich eine möglichst schmackhafte und leicht lenkbare Nahrungsquelle züchten wollten.
Aller Anfang ist auch als Vampir schwer. Roma bekommt einen neuen Namen – Rama – und wird einer aufwändigen Ausbildung durch erfahrene Lehrmeister unterzogen. Er muss lernen, wie ein Vampir zu denken, was nur langsam, mühsam und begleitet von zahlreichen Missverständnissen gelingt, denn die Vampirologie stellt sein bekanntes Weltbild vollständig auf den Kopf: Nichts ist, wie es Rama zu sein schien, weil die Vampire Sorge dafür trugen, dass die Wahrheit nur ihnen vorbehalten bleibt. Die Menschen leben in einer sorgfältig konstruierten Scheinwelt, damit sie ahnungslos und leicht lenkbar bleiben.
Allmählich lebt sich Rama in seine neue Existenz ein. Mit der schönen Vampir-Novizin Hera an seiner Seite dringt er in die faszinierende Welt der Vampire vor, die zu seiner Verblüffung weder untot noch Blutsauger sind. Über interne Zwistigkeiten sind sie allerdings keineswegs erhaben. Dass seine neuen Wohltäter recht finstere Pläne mit ihm schmieden, wird Rama zu spät klar. Mit der für ihn typischen Torheit stolpert er mitten in die Falle …
_Vampire unter & über uns_
In der ‚richtigen‘ Literatur gehört der Bildungsroman zu den altehrwürdigen Erzählformen: Der junge Mensch lernt das Leben in seinen positiven und negativen Fassetten kennen; ein Prozess, der beim Leser die Erinnerung an eigene Erfahrungen in Gang setzt, ihm aber außerdem eine Chance bietet, die scheinbar bekannte Welt durch den Filter eines unverbrauchten und ungeprägten Geistes neu wahrzunehmen.
Dieser Aspekt steht für Viktor Pelewin im Vordergrund. In „Das fünfte Imperium“ bedient er sich zwar vieler Elemente der phantastischen Literatur, legt jedoch nur bedingt einen Roman vor, der sich ins phantastische Genre fügt. Pelewin ist ein Schriftsteller, den man – falls man große Worte nicht scheut – als eine „Stimme des modernen Russlands“ bezeichnen kann. Seine schriftstellerische Karriere begann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, und als Verfasser beschäftigt er sich mit den vielfältigen Folgen einer Kapitalisierung oder Globalisierung im Zeitraffer, die in ihrer Schonungslosigkeit bizarre Blüten treibt.
Dies beschreibt Pelewin manchmal durchaus direkt, lieber aber in allegorischer oder metaphorischer Form. Dies war unter dem sowjetkommunistischen Diktat üblich und lebensnotwendig, wird aber auch heute noch geübt; zwar ist Wladimir Putin kein Stalin, aber als Menschenfreund mit offenem Ohr für kritische Stimmen darf man ihn auch nicht betrachten. Deshalb kann es durchaus ratsam sein, Missstände von Vampiren in Worte fassen zu lassen. Die Literaturkritik – vor allem die des Westens – liebt solch kunstvolle Codierung, und wer mit den lokalen Verhältnissen vertraut ist, weiß ohnehin, was der Autor sagen möchte – ein Reiz, auf den der deutsche Leser nur beschränkt reagieren kann, weshalb Pelewin allzu ‚russische‘ Interna eigens für diese Übersetzung entschlüsselt bzw. allgemeinverständlich umformuliert hat.
_Fantasie und Kritik in homogener Mischung_
Dem an literarisch verbrämter Gegenwartsbespiegelung weniger interessierten Leser bleiben die skurrilen Einfälle, mit denen Pelewin den klassischen Vampirroman bereichert. Der Pedant mag einwenden, dass diese nicht unbedingt neu oder besonders originell wirken, sondern bei anderen Autoren bereits anklingen. Allerdings ist fraglich, ob diese in Stil und Ausdruck mit Pelewin mithalten können. Die bereits mehrfach erwähnte Literaturkritik schwankt zwar im Urteil, aber fest steht, dass dieser Mann zu schreiben versteht! Bei Pelewin lohnt es nicht nur, zwischen den Zeilen zu lesen. Dennoch wird man so manche intelligente oder einfach witzige Anspielung übersehen, denn Pelewin feuert sie im Salventakt ab. So statisch und irritierend „Das fünfte Imperium“ als Roman ohne echte Handlung manchmal wirkt: Die reine Lektüre dieser 400 Seiten ist ein Genuss, muss doch die Phantastik allzu oft als Refugium für Schwätzer und Stammler herhalten!
Aus der Absurdität seiner Geistesblitze macht Pelewin ohnehin keinen Hehl. Die Welt, wie er sie schildert, KANN von uns menschlichen Lesern eigentlich gar nicht verstanden werden, da wir einen von Vampiren gestalteten und sorgfältig überwachten Alltag leben. Mit dem jungen Rama einen Vampir-Eleven einzuführen, ist ein kluger Schachzug, denn als ehemaliger Mensch kämpft dieser mit ähnlichen Schwierigkeiten. Trotzdem lässt sich die vampirische Logik nur ansatzweise begreifen (womit sich der manchmal etwas zu schwurbelige Verfasser wunderbar aus der Verantwortung stehlen kann).
_Die Welt schräg durch andere Augen betrachtet_
Vieles von dem, was Pelewin darbietet, ist purer Spaß und genussvolle Destabilisierung klassischer Horror-Elemente. Seine Vampire schlafen tagsüber nicht in Särgen. Sie zerfallen nicht im Sonnenlicht. Ihr Spiegelbild ist deutlich sichtbar. Gipfel des Mythensturms ist der Verzicht auf das Saugen von Menschenblut. Nicht einmal das Wort findet Verwendung, es gilt unter Vampiren als verpönt. Stattdessen schätzen Pelewins Vampire die gutbürgerliche Küche.
Blut ist für sie nur mehr Informationsträger. Diese Idee wird farbenfroh und überzeugend umgesetzt: Vampir-Bibliotheken bestehen nicht aus Büchern oder Dateien, sondern aus Blutproben. Wenn Rama beispielsweise einen Tropfen Musikerblut verkostet, wird er selbst zum verständigen Musikus – zumindest theoretisch bzw. bis die Wirkung nachlässt.
Denn auch oder gerade in der Welt der Vampire ist nichts so, wie es zunächst zu sein scheint. Dynamik gewinnt „Das fünfte Imperium“ aus Ramas ständigen Missverständnissen, Irrtümern und peinlichen Patzern. Seine Torheit rettet ihm freilich das Leben, denn hinter der Geburt und der Erziehung des Vampirs Rama wird nach und nach eine Verschwörung sichtbar. Auch die womöglich außerirdische Herkunft und das unglaubliche Alter hat die Vampire nicht wirklich reifen lassen. Betrug und Intrige werden auf ein exotisches Niveau gehoben, doch an den niederträchtigen Realität ändert dies nichts.
Mit der Aufdeckung dieses Komplotts versucht Pelewin auf den letzten Seiten, seinem geistreich, aber zerfahren mäandrierenden Roman so etwas wie ein logisches Finale zu verschaffen. Es gelingt, wirkt aber etwas pflichtschuldig. Der Weg ist das Ziel dieses Romans. Wer sich darauf einzulassen vermag, wird mit einem phantastischen Vergnügen der etwas anderen Art belohnt.
_Der Autor_
Viktor Olegowitsch Pelewin ist ein Schriftsteller, der äußerst medienwirksam das Licht der Öffentlichkeit scheut. Lesungen, Interviews und Fernsehauftritte verweigert er, sondern teilt sich ausschließlich über das Internet mit. Er begründet das mit der Ablehnung persönlicher Prominenz, wehrt sich aber auch nicht gegen den Ruf der unbestechlichen Unabhängigkeit, dem ihm dieses Verhalten beschert.
Bekannt ist immerhin, dass Pelewin am 22. November 1962 in Moskau geboren wurde und Elektrotechnik studierte, bevor er an das Moskauer Literaturinstitut wechselte. Seit 1990 veröffentlichte er mehrere Romane und zahlreiche Erzählungen, die in mehr als zehn Sprachen übersetzt wurden.
Als Schriftsteller beschäftigt sich Pelewin mit den politischen und vor allem gesellschaftlichen Umbrüchen, die das moderne Russland nach 1991 erfuhr. Dabei ignoriert er Genregrenzen und arbeitet gern mit – oft ironisch verfremdeten – Elementen der Phantastik.
_Impressum_
Originaltitel: Empire V (Moskau : Eksmo 2006)
Übersetzung: Andreas Tretner
Dt. Erstausgabe: Januar 2009 (Luchterhand Literaturverlag/Sammlung Luchterhand 62138)
400 Seiten
EUR 10,00
ISBN-13: 978-3-630-62138-8
http://www.luchterhand-literaturverlag.de