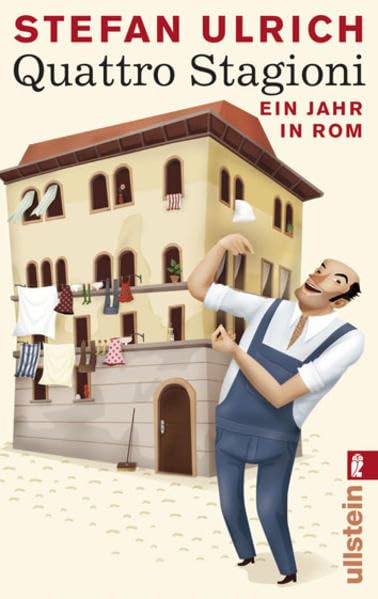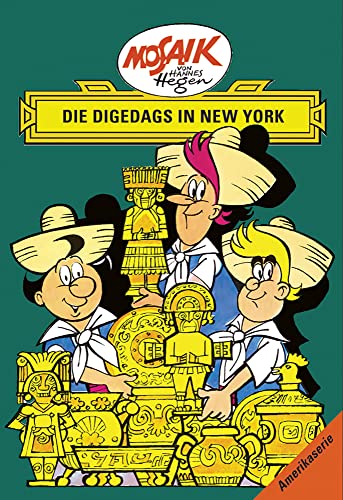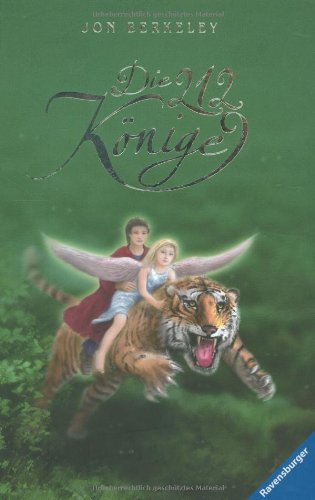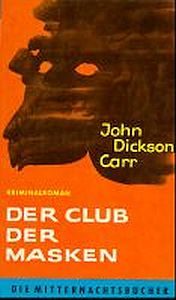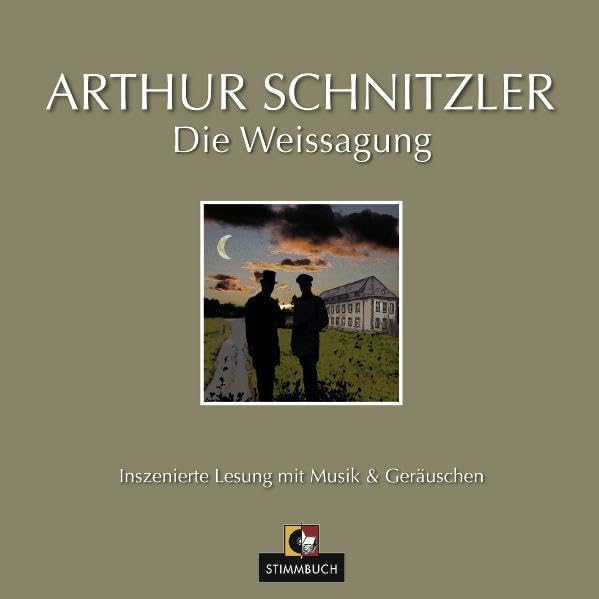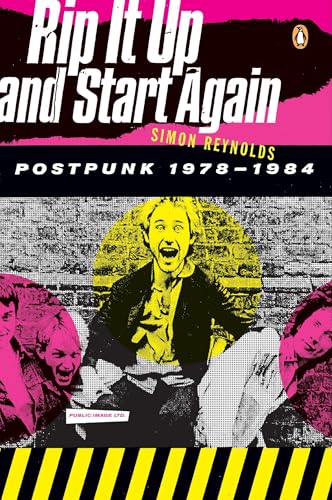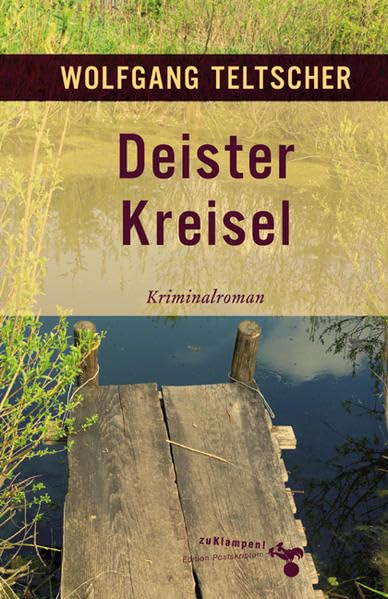_Das geschieht:_
Nach vielen Jahren kehrt Michael Anthony, ein berühmter Autor von Fantasy-Romanen, ins kleine Städtchen Braddock zurück. Hier in Hudson County, Missouri, wurde er nach dem Unfalltod der Eltern von seiner Großmutter Vivian Martin aufgezogen, bis die Behörden einschritten und der zunehmend wunderlich werdenden Frau das Sorgerecht entzogen.
Nun ist Vivian gestorben und hat ihrem Enkel ihr Haus hinterlassen. Michael, inzwischen Ehemann und Vater, nimmt das Erbe gern an, denn schon lange plant er, mit seiner Familie die Stadt zu verlassen. Während der achtjährige Tommy sich auf das Abenteuer, in dem einsam gelegenen Haus zu leben, schon freut, vermisst die 15-jährige Megan ihre Freunde und die vertraute Umgebung sehr, zumal die Bewohner von Braddock die Anthonys unfreundlich empfangen: Vivian galt als verrückte Hexe, und in ihrem Haus soll es umgehen. So spricht auch Sam Tochi vom Stamm der Hopi-Indianer, der von einem unterirdischen Höllenreich schwadroniert, aus dem fiese kleine Schreckgespenster zu entweichen suchen.
Michaels Gattin Holly ist die Erste, die bemerkt, dass in der Tat etwas nicht stimmt. Sie hört Geräusche, für die keinesfalls Mäuse oder andere Ungeziefer verantwortlich gemacht werden können. Auf dem Fußboden zeichnen sich wunderliche Muster ab. Die Manifestationen nehmen erst an Stärke und dann an Bedrohlichkeit zu. Etwas lebt in den Wänden oder im Boden unter dem Haus. Es hat sich schon Vivian Martin geholt und ist jetzt auf größere Beute aus. Die Begriffsstutzigkeit Michaels, der seine Familie und seinen Besitz notfalls mit der Schrotflinte zu schützen gedenkt, gibt ihm die Chance, sich zu formieren …
_Schema-F-Horror mit abgelaufener Haltbarkeitsdauer_
Gibt es unter uns Horrorfreunden jemanden, der die gerade skizzierte Story nicht mitsingen kann? Wie wird sie sich weiterentwickeln? Wird der indianerweise Sam dabei eine Rolle spielen? Kommt es am Ende zur großen Konfrontation zwischen Menschen und Monstern? Sind das nicht müßige Fragen, da die Antworten nur zu bekannt sind?
Leider, leider, denn man möchte die gute, alte Mär vom verfluchten Haus im einsamen Wald ja mögen. Sie ist ein unverwüstlicher Dauerbrenner des phantastischen Genres, was für die literarische Variante ebenso gilt wie für den Film. Man sollte sie freilich variieren – ein bisschen wenigstens, eine Herausforderung, die Autor Goingback jedoch meidet wie seine Spukschatten die hölzernen Schutzgeister im Haus der Anthonys.
Unbarmherzig reiht sich Klischee an Klischee. Die typische Großstadtfamilie fällt mit viel Hallo in die Provinz ein. Dort lebt einfaches Landvolk, das Misstrauen und Ablehnung als Primärtugenden pflegt. Der Sheriff ist ein Widerling, taub und blind für jeden Wink aus dem Jenseits, wobei die Hausgeister allerdings Spielverderber genug sind, jedes Mal durch Abwesenheit zu glänzen, sobald die aufgeregten Anthonys Zeugen oder Hilfe in ihr Heim einladen.
Wie üblich geht es mit schemenhaften Bewegungen und unerklärlichen Geräuschen los. Diese Vorfälle sowie die Suche nach einer ’natürlichen‘ Erklärung walzt Goingback ordentlich aus, bis er sich an der Katze vergreift, die er den Anthonys an die Seite schrieb, damit sie von den Geistern gekillt werden kann. (Vorher ist sie aber noch für einen beliebten Billig-Schock nützlich: Es tappt und schleicht durch die Flure, der ängstliche Hausherr treibt den Spuk in die Enge, reißt die Tür auf – und die fauchende Katze springt ihm ins Gesicht!)
Damit signalisiert er, dass die Handlung in den zweiten Gang schaltet. Ihren Kurs kann sie dennoch weiterhin per Autopilot halten. Jetzt kracht’s und buht’s tüchtig in dem alten Gemäuer, Kinder und Gattin werden nacheinander publikumswirksam in Gefahr gebracht, bis es endlich auch dem notorisch begriffsstutzigen Familienvorstand Michael dämmert: Hier geht es um!
_Figuren ohne Profil und Tiefe_
In Sachen Figurenzeichnung sollte Goingback noch einmal intensiv seinen Stephen King studieren. Wo dieser echte Menschen in die literarische Welt setzt, produziert Goingback nur Pappkameraden. Vor allem die Charakterisierung der Anthony-Kinder provoziert heftiges Augenrollen: Hollywood lässt grüßen. Kiddy- und Teenie-Klischees ergießen sich über den Leser, und wem dies nicht reicht, der wird auch den bigotten Pfarrer, den bodenständigen Bauersmann und andere Knalltüten im Figurenarsenal finden.
Auftritt Sam Tochi, denn natürlich wuchert Owl Goingback mit dem Pfund, das ihm seine Herkunft verleiht: Er ist ein ‚richtiger‘ Indianer, was die Beschreibungen uramerikanischer Folklore quasi zur dokumentarischen Realität erhebt: |“Man metzelte Indianer nieder und verwendete ihre Namen anschließend für Orte, Städte, Staaten. Man brachte ihre Bilder auf Geld, Tabak und Immobilien an, um Profit aus für immer verlorenen Dingen zu schlagen. So liefen die Dinge in Amerika.“| (S. 195)
Wer erschauert ob solch ernster Worte nicht in Ehrfurcht? Heben sich die Schwaden politisch korrekter Akzeptanz, wird dahinter zumindest im Rahmen dieses Buches allerdings nur Budenzauber sichtbar. Goingback selbst war die Figur Sam Tochi nicht wirklich wichtig; irgendwann lässt er sie aus dem Geschehen verschwinden, und niemand – auch nicht die Leserschaft – vermisst ihn.
_“Lang“ und „langweilig“ – das gnadenlose Duo_
Ein etwas strengeres Lektorat hätte „Dunkler als die Nacht“ womöglich um diverse Längen oder merkwürdige Exkurse erleichtert. Was soll der innere Monolog auf den Seiten 88 bis 90, als Goingback Michael Anthony endlos über die Zensur klassischer Zeichentrickserie im US-Fernsehen sinnieren lässt? Ist das ein Kommentar zur Kritik, der sich ein Schriftsteller, der vor allem Horrorgeschichten verfasst, immer wieder ausgesetzt sieht? Aber was hat der an dieser Stelle verloren? Hier gilt es eine Handlung voranzutreiben!
Abschweifungen dieser überflüssigen Art pfropft Goingback viel zu oft einer Handlung auf, die sich ohnehin recht lendenlahm dem Höhepunkt und Finale entgegenschleppt. Dem Text fehlt eine ausgewogene Struktur; die Konfrontation der Anthonys mit den Schreckgespenstern kommt abrupt, sie wird hastig und wiederum unter Einsatz ausgelaugter Spannungsklischees in Szene gesetzt und endet unbefriedigend. Der Tor zur Hölle sollte auf eine Weise geschlossen werden, die nicht gar zu viele logische Hintertürchen offen lässt.
_Klischee – eine Definitionsfrage?_
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einhalten und eine Differenzierung versuchen, um diesem Buch gerecht zu werden, das keineswegs ’schlecht‘ im Sinne von langweilig oder stilistisch stumpf, sondern vor allem mittelmäßig ist: Einer jüngeren Generation, die sich noch nicht durch unzählige kongruent gestrickte Vorgänger gequält hat, mag „Dunkler als die Nacht“ besser gefallen als dem erfahrenen und von Erfahrung gezeichneten Leser. Es ist eine gute, alte Geistergeschichte, die Goingback immerhin professionell abspult. Wer es nicht besser weiß oder wem dies reicht, der wird gut bedient.
_Der Autor_
Owl Goingback (geb. 1959) begann nach einer beruflichen Orientierungsphase, die unter anderem Tätigkeiten als Flugzeugmechaniker und Eigentümer eines Restaurants einschlossen, 1987 professionell zu schreiben. Seitdem ist er als Roman- und Kinderbuchautor, aber auch als Verfasser von Kurzgeschichten und journalistischen Beiträgen aktiv. Außerdem verdingte er sich als Ghostwriter für mitteilsame, aber des Schreibens unkundige Prominenz. Für seinen Horrorroman [„Crota“ 4838 wurde Goingback 1996 mit einem |Bram Stoker Award| für den besten Debütroman ausgezeichnet.
Der Autor trägt seinen indianischen Wurzeln Rechnung, indem er über die Sitten und Bräuche der US-amerikanischen Ureinwohner Vorträge hält. Mit seiner Familie lebt Owl Goingback in Florida. Über seine Arbeit informiert er auf seiner Website:
http://www.otherworld-verlag.com
http://www.owlgoingback.com