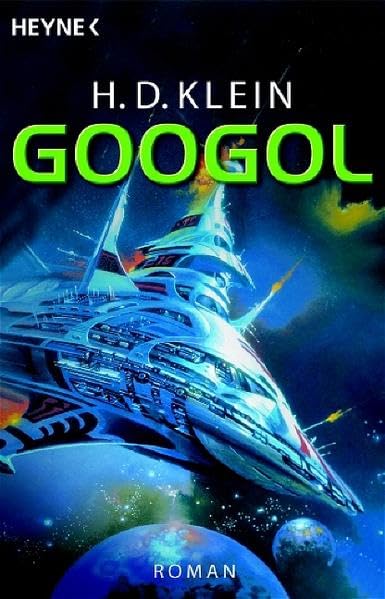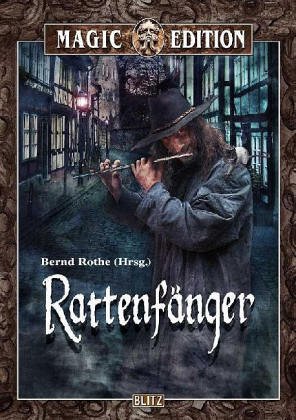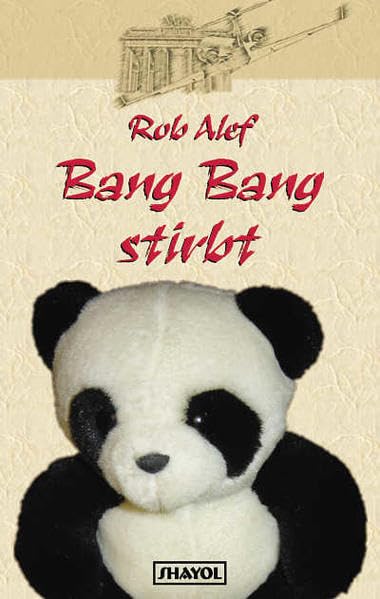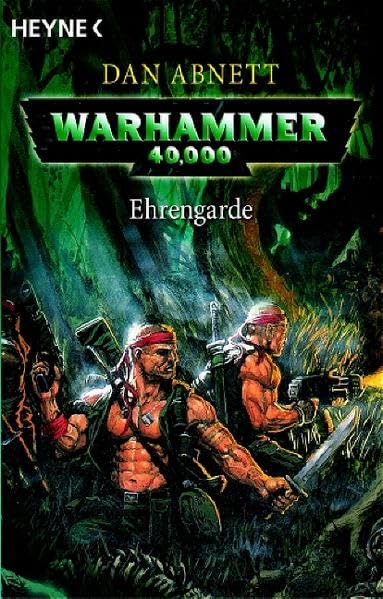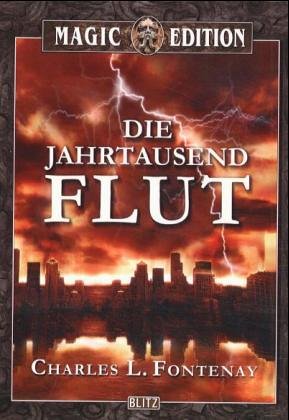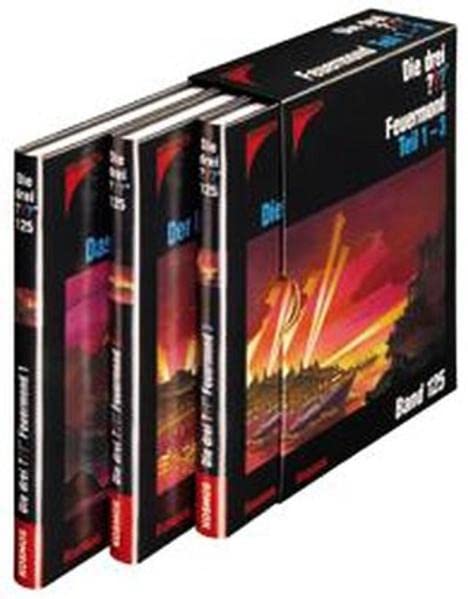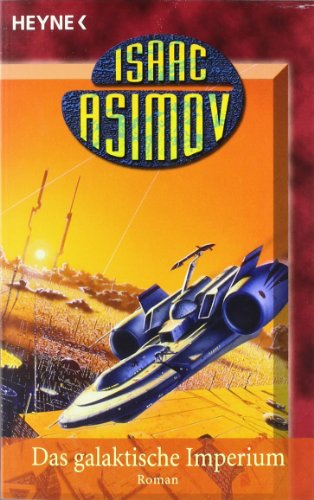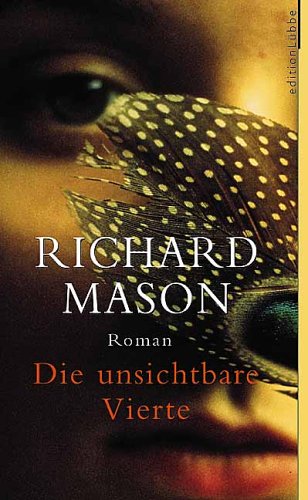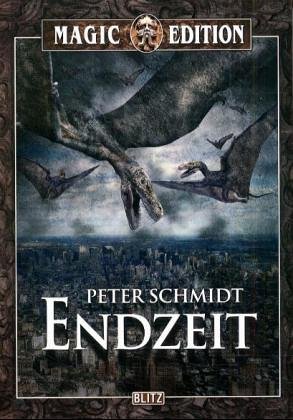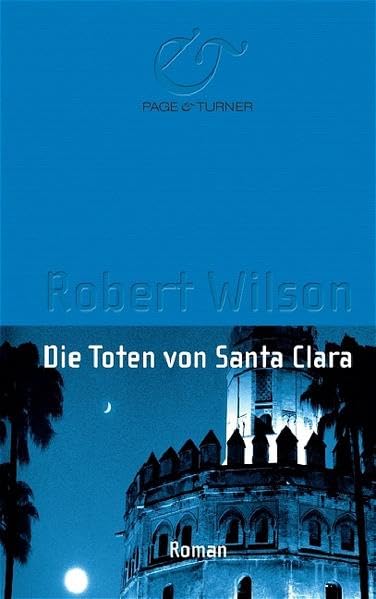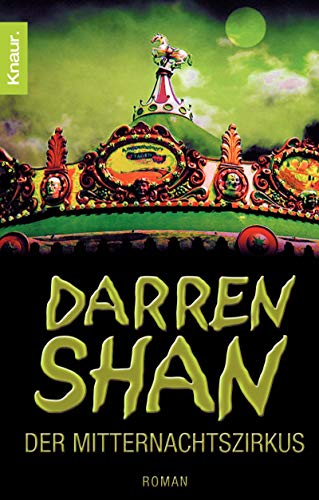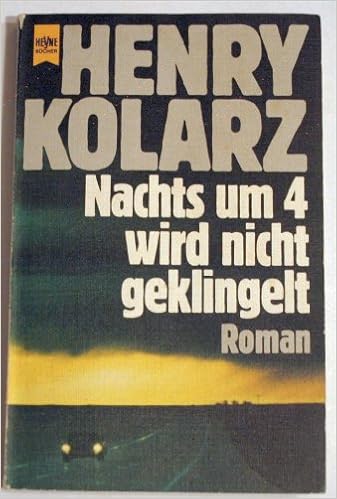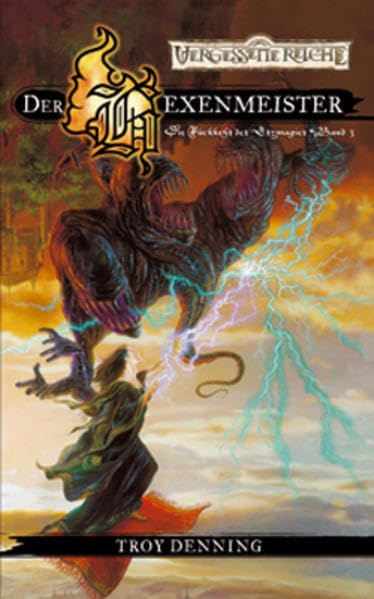Zehn Jahre dauert bereits der „Streit“ und selbst die Reform der _Reform der Rechtschreibung_ nimmt kein Ende. Nach Meinungsforschungsumfragen befürworteten 8 % der Bevölkerung die Reform, 61 % waren dagegen und 31 % unschlüssig. Niemand hält sich daran. Der Vorsitzende des Rechtschreibrates, Hans Zehetmair, nennt das treffend „kollektive Unfolgsamkeit“. Denn Lehrer schreiben weiterhin die bewährte Rechtschreibung an die Tafel, Schüler machen sich über die unsinnigen Regeln lustig und auch sonst kaum ein Bürger richtet sich nach den veränderten Regeln. Auch die Autoren und große Teile der Presse haben die Reform nicht akzeptiert und in zwei Bundesländern, Bayern und Nordrhein-Westfalen, war die am 1. August 2005 endende Übergangsfrist für das Inkrafttreten der Rechtschreibreform um ein Jahr verlängert worden. Die brandenburgische Kultusministerin Johanna Wanka, die bis zum 1. Januar Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) war und ihr Amt turnusgemäß abgab, äußerte sich nun: „Die Kultusminister wissen längst, dass die Rechtschreibreform falsch war. Aus Gründen der Staatsräson ist sie nicht zurückgenommen worden“. Auf der Frühjahrstagung im März wird sich die Kultusministerkonferenz (KMK) mit den Vorschlägen befassen, die der Rat für deutsche Rechtschreibung Ende November gebündelt präsentiert hatte. Die meisten im Gremium vertretenen Verbände – darunter auch der VdS Bildungsmedien und der Börsenverein – haben signalisiert, dass sie die vom Rat erarbeitete Kompromisslösung unterstützen werden. Nennenswerte Änderungen sind vor allem bei der Getrennt- und Zusammenschreibung (etwa „kennenlernen“ neben „kennen lernen“, „aufeinanderbeißen“ neben „aufeinander beißen“), der idiomatischen Adjektiv-Verb-Verbindungen („krankschreiben“ oder „freisprechen“), Zusammenschreibungen, die einen Bedeutungsunterschied markieren („kaltstellen“ statt „kalt stellen“) sowie der Zeichensetzung (zum Beispiel obligatorisches Komma vor „um zu“ oder „ohne“) zu erwarten. Die Abtrennung einzelner Vokalbuchstaben bei der Worttrennung (wie bei „a-ber“, „E-sel“) wird es künftig nicht mehr geben. Schluss ist dann endlich auch wieder mit sinnentstellenden Trennungen wie „Urin-stinkt“. Obwohl das Kapitel Groß- und Kleinschreibung von der KMK als „unstrittig“ eingestuft wird, soll eine Arbeitsgruppe des Rechtschreiberats noch einmal Detailfragen klären. Auf jeden Fall werden die Beschlüsse des Rechtschreiberates und der KMK den Schulbuchverlagen wieder Änderungen bescheren.
Seit mindestens zwanzig Jahren – mehr als diese Zeit bin ich mittlerweile in die Branche involviert – klagen bereits die Buchhandlungen über zu wenige Umsätze bzw. kontinuierlichen Umsatzrückgang und hoffen so sehr auf wirtschaftliche Änderungen. Ganz viele der kleinen Buchhandlungen sind in dieser Zeit von der Bildfläche verschwunden. Aber die _Umsatzzahlen_ des Weihnachtsgeschäftes 2005 sind die bislang drastischsten in all „meiner“ Zeit. Das Weihnachtsgeschäft ist nicht mehr das, was es einmal für den Handel war. Mit Beginn der Weihnachtszeit lag der Umsatzrückgang in den Buchhandlungen zwischen 15 % bis hin zu 40 % ! Je näher Weihnachten rückte, desto besser sahen die Zahlen aber dann aus. Ab dem dritten Advent belief sich das Minus im Schnitt noch auf 3 % zum Vorjahr. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den kleinen unabhängigen Buchläden und den großen Ketten. In den Ketten lief das Geschäft einigermaßen positiv, in den kleinen Läden dagegen schickten die Inhaber teilweise ihre Mitarbeiter aufgrund mangelnder Kundenfrequenz schon am Nachmittag nach Hause. Dauerhaft im positiven Bereich sind die Hörbücher, auch wenn der Zuwachs im Weihnachtsgeschäft 2005 erstmals deutlich unter 10 Prozent lag. Noch im Jahr davor hatten die Hörbücher ein Umsatzplus von fast 20 Prozent erreicht. Auch Kinder- und Jugendbücher verkauften sich besser – sicherlich noch eine Auswirkung von »Harry Potter und der Halbblutprinz«. Ihr Umsatz liegt bei plus 9,5 Prozent. Ein Plus gibt es auch im Bereich Schule und Lernen mit einem Wert von 4,0 Prozent. Alle anderen Büchersparten hingegen sind aber im Minus, wenn auch kurz vor Weihnachten dann Unterhaltungsliteratur, Krimis und die Toptitel der Bestseller (allesamt in höherpreisigen Hardcover-Ausgaben) nochmals zulegten. Der Sparkurs der neuen Bundesregierung trug alles andere als zur Konsumlust bei und die hohen Öl- und Gaspreise haben die meisten Menschen sicher mehr als nur erschreckt. Immerhin verschenken 60 % der Bevölkerung zu Weihnachten ein Buch und die Kunden nahmen auch in den Buchhandlungen zu, aber steigende Kundenfrequenz ist allerdings nicht gleichzusetzen mit einem Umsatzplus.
Für Aufatmen im Handel sorgte die Entscheidung des Bundeskabinetts, den reduzierten _Mehrwertsteuersatz_ von 7 % für Bücher und andere Kulturgüter beizubehalten. Besonders der Börsenverein hatte sich in Berlin immer wieder für die Erhaltung des reduzierten Steuersatzes eingesetzt.
Dagegen ist die Branche in Alarmbereitschaft wegen der hohen Zuwachsraten beim _Gebrauchsbuch-Kauf_. Der Handel nimmt vor allem im Internet problematisch zu. Amazon generiert weltweit und über alle Produktgruppen hinweg bereits 30 % aller Bestellungen über das Marketplace-Programm, das bei jeder Suchanfrage entsprechende gebrauchte Waren anzeigt. Durch die Buchpreisbindung hat das Angebot in Deutschland überdurchschnittliche Bedeutung. Gebrauchte Bücher kosten im Schnitt ein Drittel des Originalpreises, sind häufig neuwertig und werden zum Teil unmittelbar nach der Erstauslieferung angeboten. Damit höhlen sie das Preisbewusstsein beim Endkunden aus – zumal es oft die aktivsten Buchkäufer sind, die sich für ein gebrauchtes Buch entscheiden. Mittelfristig gerät dadurch die Preisbindung in Gefahr. Autoren und Verlage gehen bei schnell wachsenden Umsätzen mit Gebrauchtbüchern leer aus. Der Online-Handel mit Second-Hand-Ware kann zunehmend an die Stelle ihrer Stammumsätze treten. Der Verleger-Ausschuss des Börsenvereins hat deswegen Amazon zu Gesprächen eingeladen, um einen Meinungsaustausch zu ermöglichen. Der Handel mit Gebrauchtbüchern kann natürlich nicht verhindert werden, aber Modelle könnten entwickelt werden, die den Verlagen einen angemessenen Anteil an der Vermittlungsgebühr sichert und vielleicht auch Einfluss auf die Preisgestaltung ermöglichen.
Zum Ende des letzten Jahres gab es im Buchhandel eine Sensation. Alle 26 _Gondrom_-Filialen wurden an den nationalen Marktführer _Thalia_ verkauft. Das Kartellamt muss dem Deal aber noch zustimmen. Reinhold Gondrom bleibt für zwei Jahre Geschäftsführer, mit einer möglichen Verlängerung für weitere drei Jahre. Der Name Gondrom wird beibehalten und weitere Filialen sind geplant. Mit dem Kauf übersprang Thalia gleich zum Auftakt des Jahres die 500-Millionen-Euro-Umsatzmarke im deutschsprachigen Raum. Gondrom hatte zuletzt 60 Millionen Jahresumsatz, Thalia 461 Millionen. Ein weiterer Vergleich: Die _Weltbild Plus Medienvertriebs GmbH_ hatte 2005 in ihren Läden Weltbild plus, Weltbild! und Jokers 266 Millionen Euro umgesetzt. Das Gemeinschaftsunternehmen von Hugendubel und Weltbild betreibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit den drei genannten Ketten rund 310 Buchhandlungen, und Weltbild plus ist zudem zu 51 % an der Wohltat`schen Buchhandlung beteiligt (30 Millionen Euro Umsatz). Weltbild expandiert auch in diesem Jahr mit weiteren zusätzlichen Läden.
Es bleibt also bei den Konzentrationen auf große Konzerne, wie es _Random House_ vormachte. Dessen Expansion nimmt auch kein Ende. 2005 wurden DVA, Kösel, Manesse und die Gerth Medien übernommen.
_Bucheditionen_: Bereits sechs Wochen vor dem Start der _“SZ“-Krimi-Bibliothek_ brachte das Magazin „Stern“ seine Krimi-Edition in den Handel. Vertriebspartner ist das Schwester-Unternehmen Random House, und die überwiegende Zahl der Lizenzen stammt auch aus den Imprints von Random House. Die _“Stern“-Edition_ setzt auf aktuelle Krimis (und konnte in den ersten beiden Monaten – Start war 1. Dezember – 300.000 Bände verkaufen), die „SZ“-Edition dagegen auf Klassiker der letzten 60 Jahre in fünfzig Bänden. Die Süddeutsche Zeitung erwartet allerdings nicht, dass die Krimi-Edition an den Erfolg der „SZ-Bibliothek“ heranreichen kann. Interessant zu sehen ist, dass bislang jedes Buch aus der _“Brigitte“-Edition_ sofort den Sprung in die Bestseller-Verkaufslisten schaffte. Dadurch konnten von den ersten zehn erschienenen Bänden 1,5 Millionen Exemplare verkauft werden. Das Konzept – Empfehlungen von Elke Heidenreich – ist aufgegangen. Die Edition wird im August abgeschlossen und dann 26 Bände umfassen. Ob sie später fortgesetzt wird, ist noch nicht entschieden.
In den _Bestseller-Listen_ vor Weihnachten dominierte ansonsten Joanne K. Rowling mit sieben Harry-Potter-Titeln (da auch der sechste in Englisch dazugehörte). Auf Platz 2 stand Cornelia Funke mit ihrem „Tintenblut“. Natürlich ist auch der Vorgänger „Tintenherz“ hoch im Ranking. Im Januar kam sie auch mit ihrem Buch von 2000 „Herr der Diebe“ in die Charts, da das populäre Kinderbuch als Film in den Kinos angelaufen ist. Durch diese drei Titel schlägt sie die englische Bestsellerautorin, die zwar auch noch mit drei Pottern-Titeln in den Besteller-Listen ist, aber weiter hinten. Marc Levys Liebesroman „Zurück zu dir“ – die Fortsetzung des derzeitigen Kinofilms „Solange du da bist“ – ist einer der gut platzierten derzeitigen Newcomer. Durch den Weihnachtskinofilm gelangte auch C. S. Lewis‘ „Der König von Narnia“ wieder auf vordere Plätze. Auch die Buchversionen der „Perry Rhodan“-Serie gelangen bislang sofort in die Charts. Selbst Kochbücher hatten sich aufgrund ihres „Verschenkwertes“ während des Weihnachtsgeschäftes ganz gut lanciert. Aber Kochen und vor allem Diätratgeber sind seit langer Zeit die liebste Sachbuch-Lektüre der Deutschen. Langsam starten nun aufgrund der kommenden Fußball-WM die Fußball-Bücher in die Sachbuchbestseller-Listen.
In Amerika war „Harry Potter and the Half-Blood Prince“ mit 7,02 Millionen Exemplaren das meistverkaufte Buch 2005. Die Longseller von Dan Brown („Sakrileg“ und „Illuminati“) schafften es dort auf die Plätze 5 und 8.
Auf dem _Hörbuch-Markt_ beginnt neuerdings ein richtiges Preisdumping. Vor Weihnachten bot _Aldi Süd_ in seinen 1600 Fillialen zwei Hörbuchpakete mit jeweils (!) 12 CDs für gerade mal 12,95 Euro an. Diese wurden vom _Tandem Verlag_ exklusiv für den Discounter produziert – Krimis und Weltliteratur, gelesen von namhaften Sprechern wie Matthias Ponnier oder Hannelore Elsner.
Nach „Brigitte“ und „Eltern“ legt sich nun auch der „_Playboy_“ eine Audiobook-Edition zu. Vorerst sind zehn Titel für je 9,99 Euro geplant, darunter „Fanny Hill“ und „Lady Chatterly“. Die _Brigitte-Hörbuch-Edition „Starke Stimmen“_ wird fortgesetzt. Im April kommt die Nachfolgebox – wieder mit zwölf Titeln, wieder mit weiblichen Sprecherinnen, wieder mit Vertriebspartner Random House, aber auch nach Buchvorlagen von männlichen Autoren.
Im Januar wurden im Hessischen Staatstheater Wiesbaden die _Hörbücher des Jahres 2005_ gekürt. Seit 1997 geben das Börsenblatt und der Hessische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem „Buchjournal“ die hr2-Hörbuch-Bestenliste heraus und einmal im Jahr ermittelt die Jury das Hörbuch des Jahres. 2005 fiel die Wahl in der Kategorie Kinder- und Jugendhörbuch auf „Winn-Dixie“ von Kate DiCamillo, erschienen bei der Hörcompany. Zur besten Produktion in der Kategorie Hörbücher für Erwachsene wählte die Jury „Wörter Sex Schnitt“ mit Tondokumenten des 1975 verstorbenen Rolf Dieter Brinkmann, die im Archiv vergraben waren.
Die Finalisten für den _HörCules_ stehen nunmehr auch fest: Aus den 30 im Herbst im „HörBuch“-Magazin vorgestellten Titeln sind drei Spitzenreiter von den Lesern ausgesucht worden, aus denen bei der „ARD-Radionacht der Hörbücher“ per TED der Publikumssieger gewählt wird: „Illuminati“ von Dan Brown (Lübbe Audio), „Mein Venedig“ von Donna Leon (Diogenes) sowie „Nurejews Hund“ von Elke Heidenreich und Michael Sowa (Random House Audio).
Um den _Deutschen Hörbuchpreis_ konkurrieren 33 Hörbücher in fünf Kategorien. Die Auszeichnung des WDR wird am 12. März bei der LitCologne in Köln verliehen.
Durch den _Hörverlag_ wurde ein neuer _Hörbuch-Preis_ für das beste Original-Hörspiel initiiert, welcher alle zwei Jahre, erstmals am 18. Mai 2006 vergeben wird.
_Senioren-Zeitschrift_ jetzt auch als Hörbuch. 1200 blinde oder stark sehbehinderte Menschen in Frankfurt werden sich über ein Projekt des Diakonischen Werks freuen: Die Seniorenzeitschrift, die seit 30 Jahren vom Sozialdezernat herausgeben wird und kostenlos in Apotheken oder Seniorenanlagen ausliegt, erscheint nun auch als Hörbuchausgabe – viermal im Jahr und jeweils fünfeinhalb Stunden lang. Voraussetzung ist ein MP3-CD-Player.
Mit „_Summa Cultura_“ erweitert das Hörbuch-Downloadportal Claudio.de sein Angebot um das bislang einzige Kulturmagazin im Audio-Format. Jede Woche präsentiert die Redaktion von www.summacultura.de einen Überblick über das Wichtigste im aktuellen Kulturgeschehen.
Wie jedes Jahr stehen 2006 auch eine ganze Reihe von Verlags-Jubiläen an, auf die wir zu entsprechender Zeit näher eingehen werden. Das _Patmos-Verlagshaus_ wird 60 Jahre alt und seit der Gründung 1946 kamen eine ganze Reihe weiterer renommierter Verlage hinzu (Sauerländer, Artemis & Winkler, Walter und Dachs). Der seit seiner Gründung in Wien residierende Kinderbuchverlag Dachs mit 23 Novitäten 2005 hat Ende Januar seinen Sitz ins Mutterhaus Patmos nach Düsseldorf verlegt. Seit 2001 gehört Dachs bereits zu Patmos. Eine ausführliche Verlagsgeschichte befindet sich auf der Website www.patmos.de.
Der _Antje Kunstmann Verlag_ begeht auch bereits das 30. Jahr des Bestehens und feiert das mit einer Jubiläumsaktion neun preisgünstiger Erfolgstitel für je 10 Euro, schön gebunden und mit Leseband. Z.B. Fay Weldon „Die Teufelin“, Alice Walker „Roselily“, Veronique Olmi „Meeresrand“ u. a.
Aus der Esoterik-Bewegung des „New Age” ist nach 25 Jahren leider eine Wellness-, Selfness- und Spiritness-Geschichte geworden, die mit dem ursprünglichen Ansatz nichts oder nur wenig zu tun hat. Aber der unabhängig gebliebene _Aquamarin_- Verlag hat es dennoch geschafft bestehen zu bleiben und feiert dieses Jahr 25. Jubiläum. Verlagsleiter Dr. Peter Michel gehört selbst zu den zeitgenössischen Esoterikern und ist mit seinem Programm an der Theosophie orientiert. Gleich mit dem ersten Buch gab es seinerzeit Ärger, denn „Das Geistchristentum“ – eine kritische Analyse christlich-mystischer und christlich medialer Schriften – brachte eine hohe Schadensersatzklage seitens der „Geistigen Loge Zürich“ ein. Jahrelang wurde prozessiert und letztlich vorm Bundesgerichtshof gewonnen, der höchstrichterlich feststellte: „Geister haben kein Copyright“. Die Züricher Loge war längst geschlossen, als das Verfahren vom Verlag gewonnen wurde, und die Gerichtskosten von Seiten der verlierenden Seite sind bis heute offen geblieben. Bestseller gab es im Verlagsprogramm keine, auch wenn sich Titel von „White Eagle“ etwa 100.000-fach verkauften. Vorzeigetitel sind aber „Weltreligion“, von Peter Michel selbst verfasst, oder „Einbruch in die Freiheit“ von Krishnamurti, das, obwohl es lange Zeit als Taschenbuch bei Ullstein vorlag, bei Aquamarin wieder in schöner Hardcover-Ausgabe erhältlich ist. Bedauerlich ist, dass im Gesamtprogramm dennoch auch viel Mainstream-Titel enthalten sind, was ein wirtschaftliches Zugeständnis an den Eso-Markt und das Wegsterben der anspruchsvollen Esoterik-Buchhandlungen darstellt, denn ansonsten würde sich der Verlag nicht halten können. Aber anspruchsvolle Titel gehen nicht unter, was die jüngste „Edition Adyar“ mit wichtigen theosophischen Titeln beweist.
Und die Wochenzeitung „_Junge Freiheit_“ wird in diesem Sommer 20 Jahre alt. Anfänglich ein zweimonatiges Studentenblatt, dann eine Monatszeitung und seit 1994 wöchentlich. Dieses Jubiläum ist deswegen bemerkenswert, weil es sich um einen mediengeschichtlichen Sonder- und Ausnahmefall in Deutschland handelt. Überregionale Zeitungsneugründungen, die ihr Gründungsjahr überlebten, sind mit der Lupe zu suchen. Neugründungen zudem, die nicht von einem der fünf marktbeherrschenden Verlagsgiganten ausgingen, sind kaum festzustellen. Die „Junge Freiheit“ allerdings ist an Krisen gewachsen und ihre Verbreitung nahm stetig dabei zu. Jahrelang wurden sie vom Verfassungsschutz als „rechtsradikal“ diffamiert, bis dem ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im letzten Jahr ein Ende bereitete. Seitdem ist die „Junge Freiheit“ ein lebendiges Denkmal geworden für die Presse- und Meinungsfreiheit. Dennoch gab es Ende Januar erneut eine Überraschung, da vom Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zillo, ein Stand auf der diesjährigen Leipziger Messe versagt wurde, mit der Begründung, ein solcher Messestand „gefährde die ordnungsgemäße Durchführung der Buchmesse“. Auf Nachfragen, welcher Art diese Gefährdung denn sein solle, wurde nicht geantwortet.
10 Jahre Jubiläum feiert der _Karl Blessing Verlag_ und begeht dieses mit einer zehnbändigen Jubiläumsedition für zehn Euro pro Band, u. a. Mit Autoren wie Michael Crichton, Dieter Hildebrandt oder Kathy Reichs.
Die _Verlagsgruppe Lübbe_ und der _Gong-Verlag_ haben mit Beginn des Jahres die _Deutsche Rätsel Verlag GmbH & Co. KG_ als Joint-Venture gegründet. Beide bringen ihre jeweiligen Rätselpublikationen in das neue Unternehmen ein. Lübbe hält 49 % und Gong 51 % an dem Verbund, dem das Kartellamt noch zustimmen muss. Beim Lübbe-Verlag selbst werden nun vom ehemals starken Segment (Rätsel, Comics, Romanhefte) künftig nur noch die Romanhefte betreut und dabei dem Buchbereich von Lübbe zugeordnet.
Der _Schwabenverlag_ hat den _Matthias Grünewald Verlag_ übernommen. Der Mainzer Verlag fügt sich mit Titeln zu Religion, Psychologie und Pädagogik gut in das Portfolio des Schwabenverlags ein. Zur Schwabenverlags-AG gehören unter anderem der Verlag „Jan Thorbecke“ und der „Verlag am Eschbach“.
Der Hamburger _Marebuchverlag_ publiziert die Taschenbuchausgaben seiner Titel ab Mai 2007 exklusiv bei Fischer in Frankfurt. Bisher sind die Taschenbücher seit 2004 bei Piper erschienen. Fischer will um die Mare-Titel herum ein umfangreiches Angebot zum Thema Meer aufbauen, in das auch andere Lizenzen, Titel aus den Fischer-Verlagen und Originalausgaben einfließen sollen. Unter dem Labe „Mare“ könnten dann so 15 Taschenbücher pro Jahr erscheinen, davon vier bis sechs Titel aus dem Mare-Verlag, der 2001 gegründet wurde und jährlich etwa 20 Titel veröffentlicht.
_Piper_ startet im Frühjahr ein neues Programm mit nordischer Literatur. Unter dem Label „Piper Nordiska“ erscheinen zum Auftakt fünf Romane von skandinavischen Autoren – darunter der schwedische Krimiautor Arne Dahl und der Däne Christian Jungersen. Der Verlag will sowohl seine eingeführten nordischen Autoren aus dem herkömmlichen Programm hervorheben als auch Neuentdeckungen präsentieren. Die Titel „Das Leben ein Fest“ von Elsie Johansson und „Rosenrot“ von Arne Dahl sind im Original bei Verlagen der schwedischen Mediengruppe Bonnier erschienen, zu der auch Piper seit 1994 gehört. Künftig sollen pro Halbjahr fünf bis sechs Titel erscheinen. Die Reihe „Piper Boulevard“, in der bisher Aktionstitel erschienen waren, wird zu einem eigenständigen Programm ausgebaut. Die ersten vier Titel für „freche Frauen“ zwischen 18 und 35 erscheinen Ende März, drei weitere folgen im Mai.
Der italienische _White Star Verlag_, gegründet 1984, ist einer der größten Bildband-Verlage der Welt mit einem Fundus von mehr als 5000 Titeln und arbeitet bereits seit 15 Jahren mit deutschen Koproduzenten wie Frederking & Thaler zusammen. Im Februar startete er nun auch mit einem eigenen deutschen Programm. Zwar ist der Preisverfall im Bildbandbereich durchaus groß, aber nach wie vor gibt es einen Markt für hochwertige Bildbände jeder Art. In dieser Preisgruppe findet noch keine Preisschlacht statt. Der Verfall findet nur im unteren Segment statt. White Star sieht sich programmgemäß in einer Linie mit Verlagen wie Frederking & Thaler, Knesebeck oder Rosenheimer. Bereiche sind Archäologie, Kunst, Geschichte, Kulturgeschichte, Ethnologie, Natur und Architektur. Seit 2001 arbeitet der Verlag mit National Geographic zusammen und ist in Italien der exklusive Verleger der National Geographic Society. In Deutschland werden diese Titel allerdings bereits durch Random House vertrieben und kommen nicht ins Programm von White Star. Gestartet wird im Frühjahr mit 22 Bildbänden und vier Kalendern, im Herbst folgen weitere 30 Bücher.
Hans Robert Cram, bisher Hauptgesellschafter und Beiratsmitglied des Berliner Wissenschaftsverlags Walter de Gruyter, ist selber wieder verlegerisch tätig geworden und hat von der Beteiligungsgesellschaft Valiva die Berliner Kunstbuchverlage _Dietrich Reimer_, _Gebr. Mann_ sowie den _Deutschen Verlag für Kunstwissenschaft_ übernommen. Im selben Zug hat Cram seinen Anteil an de Gruyter (33 %) an den geschäftsführenden Gesellschafter Klaus G. Saur und die übrigen Gesellschafter verkauft. Einen Teil davon reichen die neuen Eigentümer an die geplante Walter de Gruyter-Stiftung für Wissenschaft und Forschung weiter, die damit selbst an dem Unternehmen beteiligt wird. Die von Cram erworbenen Kunstbuchverlage gehörten ursprünglich zur Weltkunst-Gruppe, die Axel Springer 2003 an die Starnberger Arques-Gruppe verkauft hatte. An dem Verlagsverbund, zu dem auch der Deutsche Kunstverlag, Hirmer und Philip von Zabern gehören, beteiligte sich später auch die Valiva AG in Zürich, die nun als Wiederverkäufer auftritt und sich Zug um Zug von dem Unternehmen trennt. Anfang 2005 übernahm der Zeitverlag Zeitschriften und Buchtitel des Weltkunstverlags; Mitte 2005 ging der Philip von Zabern-Verlag an die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Die verbliebenen Verlage wurden anschließend in der _Verlagsgruppe Kunstbücher_ mit Sitz in Berlin und München gebündelt. Die drei traditionellen Labels, die Cram nun aus dem Verbund herausgekauft hat, erzielen einen Jahresumsatz von rund einer Million Euro und verfügen über eine Backlist von 2000 Titeln. Auch unter der Führung von Cram verbleiben sie zunächst in der Berliner Bürogemeinschaft mit dem Deutschen Kunstverlag und Hirmer, die nach wie vor zu Valiva gehören. Die bisherigen Geschäftsführer der übernommenen Verlage scheiden aus.
Seit Januar besitzt der Oldernburger _Lappan Verlag_ sämtliche Anteile an der Achterbahn Verlags-GmbH in Kiel. Lappan, schon seit 2003 mit 51 % an Achterbahn beteiligt, hat nun die restlichen 49 % gekauft. Das Achterbahn-Programm soll sich künftig an die „freche Comic- und Humorbuch-Linie“ für die Zielgruppe ab 16 Jahren aufwärts positionieren. Lappan widmet sich dagegen weiterhin dem Bilderbuchsegment und den Cartoons, etwa von Uli Stein. Unter dem Label Looping sind sämtliche Kalender-Aktivitäten gebündelt.
Johannes Thiele hat den stillgelegten _Europa Verlag Wien_ gekauft, den er mit einem kleinen, feinen Programm wiederbeleben will. Er begann seine Verlagsarbeit beim Benzinger Verlag in Zürich, war dann in Stuttgart bei Kreuz tätig, danach in Hamburg bei Hoffmann und Campe, dann ging er nach München zu List und Marion von Schröder, von dort nach Bergisch Gladbach zu Lübbe und 2005 wieder an die Elbe, wo er unter dem Verleger Arne Teutsch Programmleiter des Europa Verlages wurde. Nun arbeitet er erstmals auf eigenes Risiko als Verleger.
Der Schriftsteller Habib Bektas und der Übersetzer Yüksel Pazarkaya haben den [Sardes Verlag]http://www.sardes.de gegründet. Damit hat türkische Literatur eine neue Adresse in Deutschland. Im auf sechs Titel pro Jahr angelegten Programm werden Werke deutsch-türkischer Autoren sowie zeitgenössische türkische Literatur erscheinen.
Der _Suhrkamp Verlag_ ist erneut in der Krise, nachdem das Unternehmen am 12. Januar die Trennung von Geschäftsführer Georg Rippel bekannt gab, der seit 2004 für Marketing, Vertrieb und Werbung zuständig war. Über die Gründe wird in den Feuilletons heftig debattiert, manche denken, seine Marketing-Konzepte wie beispielsweise die Fernsehspots zu Isabelle Allendes „Zorro“ seien zu teuer gewesen, andere glauben, dass die Differenzen mit Suhrkamp-Chefin Ulla Unseld-Berkéwitcz zu groß geworden waren. „Man weiß nicht mehr, wohin der Verlag steuert“, sagt aber auch Joachim Unseld, Verleger der Frankfurter Verlagsanstalt und Miteigentümer der Suhrkamp GmbH & Co. KG. „Eine erfolglose Programmpolitik, der Weggang erfolgreicher Autoren, eine erfolglose Personalpolitik, schließlich Erfolglosigkeit in ökonomischer Hinsicht – all das bestätigt meine große Sorge um die Marke Suhrkamp“. Manche sehen das aber auch ganz anders. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, dass sie das Erbe Siegfried Unselds zu bewahren versuche, auch wenn sie dessen Erbe vielleicht völlig missverstehe. Alle deutschen Verlage hatten in den letzten Jahren eine Transformation durchlaufen: War früher das Lektorat die taktgebende Einheit, so haben diese Funktion mehr und mehr die Marketing- und Vertriebsabteilungen übernommen. Ulla Berkewicz stemmt sich gegen diesen Wandel. Sie will ihr Ausnahmehaus als Programm-, nicht als Publikumsverlag führen. Ökonomisch gibt das Programm, die berühmte Backlist eben, einen solchen Sonderweg aber nicht mehr her. Es ist schon ein Verdienst von Berkewicz wenn vielleicht auch ökonomisch ein Privatvergnügen -– dass sie jüngst anstelle von Bestsellern einen „Verlag der Weltreligionen“ aus dem Boden stampfte. Auf literarische Qualität zu setzen, ist unternehmerisches Risiko, aber das ist doch eigentlich die Tradition von Suhrkamp. Natürlich wäre es tragisch, wenn Suhrkamp durch seine Beharrungskräfte finanziell in eine Krise geräte, aber bislang gab es weder Sparkurse noch Entlassungen. Intern wurden nun die Bereiche von Georg Rippel auf zwei Mitarbeiterinnen verteilt, von denen aber keine in den Rang der Geschäftsführung kam. Auf Geschäftsführungsebene ist nun der kaufmännische Geschäftsführer Philip Roeder für Marketing und Vertrieb zuständig. Den Vorsitz hat Ulla Unseld-Berkewicz, für das Programm ist unverändert Rainer Weiss verantwortlich.
Ein Rechtsstreit aus dem letzten Jahr – das Verbot des Romans _“Esra“ von Maxim Biller_ – nimmt kein Ende. Verboten wurde er wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten, da in den Romanfiguren reale Personen erkennbar seien. Der Verlag hatte Verfassungsbeschwerde gegen das Verbot eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat nun den Börsenverein, das deutsche PEN-Zentrum und den Verband Deutscher Schriftsteller um Stellungnahme gebeten. Der Börsenverein bemängelt am Urteil, dass der Eigenschaft des Romans als Kunstwerk nicht genug Rechnung getragen wurde. Ein Roman ist auch über das Recht der Kunstfreiheit geschützt, was nicht hinreichend berücksichtigt wurde. Bei der Prüfung der Persönlichkeitsrechtsverletzung haben die Gerichte so argumentiert, als gehörten die Romanfiguren der Wirklichkeit an. Äußerungen über Romanfiguren dürfen aber nicht mit Äußerungen über reale Personen gleichgesetzt werden. Das PEN-Zentrum hat um eine Fristverlängerung seiner Stellungnahme gebeten, und der Verband Deutscher Schriftsteller argumentiert ähnlich wie der Börsenverein. Würde das Verbot vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, wird die bereits jetzt spürbare Verunsicherung bei Autoren und Verlagen noch weiter zunehmen und manch gutes Buch vielleicht nicht mehr verlegt.
Das Gerichtsverfahren gegen den diesjährigen Friedenspreis-Träger _Orhan Pamuk_ in Istanbul wurde eröffnet und kurz danach aufgrund scharfer Kritik der Europäischen Union eingestellt. Der Autor war wegen „Herabsetzung des Türkentums“ angeklagt, weil er die Verfolgung von Armeniern und Kurden in einem Zeitungsinterview offen angesprochen hatte. Die Literaturnobelpreisträger Josè Armago, Gabriel Garcia Márquez und Günter Grass hatten gemeinsam mit anderen prominenten Autoren wie Umberto Eco und Mario Vargas Llosa eine Solidaritätserklärung unterzeichnet, die vom Prisa-Konzern, dem spanischen Verlagshaus der Autoren, publiziert wurde. Pamuk selbst, dem eine Haftstrafe bis zu drei Jahren droht, zeigte sich vor Prozessbeginn zuversichtlich: „Ich glaube nicht, dass sie mich ins Gefängnis werfen werden“. 169 türkische Intellektuelle hatten mittlerweile auch die Regierung in Ankara aufgefordert, die „Kopenhagen-Kriterien“ der EU (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Achtung von Menschenrechten) einzuhalten und zwei bedenkliche Vorschriften aus dem türkischen Strafgesetzbuch zu streichen. Paragraf 301, auf den sich die Anklage gegen den Friedenspreisträger Orhan Pamuk stützte, stellt die „Herabwürdigung des Türkentums“ unter Strafe; Paragraf 305, der „Propaganda gegen nationale Interessen“ sanktioniert, behindert vor allem die Arbeit von Journalisten. Der Prozess gegen Pamuk war Teil einer Klagewelle, mit der Ultranationalisten, Militär und Staatsanwaltschaft derzeit Autoren, Journalisten, Hochschullehrer und Unternehmer in der Türkei überziehen. EU-Kommissar Olli Rehn begrüßte die Entscheidung, den Prozess gegen Pamuk einzustellen, als wichtigen Schritt für die Meinungsfreiheit in der Türkei. Er betonte aber, dass dort noch ein Dutzend ähnlicher Prozesse gegen Journalisten und Autoren in Vorbereitung sei. Pamuk ist nicht freigesprochen worden, zum Jubilieren besteht kein Grund.
Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ging in diesem Jahr an _Juri Andruchowytsch _ aus der Ukraine für sein Werk „Zwölf Ringe“ (Suhrkamp). 1985 gehörte er zu den Gründern der legendären Performance-Gruppe Bu-Ba-Bu und im Herbst 2004 engagierte er sich für die Orange Revolution in seiner Heimat.
Die Günter-Grass-Stiftung hat einen neuen Literaturpreis ins Leben gerufen, den „_Albatros_“ für das Werk eines Autors, das offenes Denken und die freie Auseinandersetzung mit allen Lebensbereichen befördert. Mit dem Original zusammen wird eine Übersetzung gewürdigt, die der literarischen Eigenart des Werks besonders gerecht wird, also eine Doppel-Ehrung für Autor wie Übersetzer. Es geht um die Würdigung großer literarischer Leistungen, die aus anderen Ländern zu uns kommen – zusammen mit der Würdigung der besonderen Leistung des Übersetzers. Erste Preisträgerin ist die Portugiesin _Lidia Jorge_. In ihren Romanen spürt sie den Nachwirkungen historischer Ereignisse wie den Kolonialkriegen oder der Diktatur nach – im intimen Rahmen des Familien- oder Gruppenbilds. Ihre Übersetzerin _Karin von Schweder-Schreiner_ ist es zu verdanken, dass dem Werk von Lidia Jorge auch in Deutschland – im Suhrkamp Verlag – die gebührende sprachliche Sorgfalt zukommt. Trotz des Namens der Stiftung hat Günter Grass selbst mit dem Preis nichts zu tun.
Am 24. November 2005 war nach langer Krankheit der Bestseller-Autor _Harry Thürk_ im Alter von 78 Jahren verstorben. Der in Weimar lebende Schriftsteller galt als „Konsalik des Ostens“. Zu seinen Erfolgen gehören der Antikriegsroman „Die Stunden der toten Augen“ und die in Fernost spielenden Romane „Der Tiger von Shangri-La“ und „Des Drachens grauer Atem“.
Anfang November ist _Detlef Pillat_ im Alter von 47 Jahren an einer schweren Muskelschwäche-Krankheit verstorben. Er war einer der engagierten Esoterik-Verlagsvertreter und lebte im Kulturzentrum ZEGG bei Belzig. Daneben unterstützte er viele sinnvolle politische Initiativen in seiner Heimatregion Hoher Fläming, u. a. das „Infocafe gegen Rechtsextremismus und Gewalt“, die Wiederaufforstungsaktion „Grüner Gürtel“ und eine von der Sängerin Ida Kelerova gegründete Roma-Initiative in Tschechien.
Am 15. Januar 2006 verstarb der 82-jährige anthroposophische Autor _Georg Kühlewind_, geboren am 6. März 1924. Bereits als Jugendlicher hatte er sich ausgiebig mit der Psychoanalyse beschäftigt, wobei er für sich entdeckte, dass die Probleme des Einzelnen sowie auch diejenigen der Gesellschaft primär ein Bewusstseinsproblem darstellen. Wichtig dabei war die Begegnung mit dem Kulturwissenschaftler Karl Kerenyi, der ihm die Mythologien begreiflich machte. 1944 wurde er unter den Nazis zum Arbeitsdienst verpflichtet und anschließend in mehrere Lager deportiert, darunter das KZ Buchenwald. 1945 wurde er von den Amerikanern befreit. Zur Anthroposophie stieß er erst im Jahre 1942. In seinen letzten Jahren beschäftigte er sich vor allem mit dem Phänomen sogenannter ADS-Kinder und nahm kritische Positionen zu dieser Diagnose ein.
Kurz nach seinem 75. Geburtstag verstarb am 27. Januar Altbundespräsident _Johannes Rau_ (SPD), der auch tief mit der Buchbranche verbunden war. Der gelernte Verlagsbuchhändler leitete in den 1960er Jahren den Peter Hammer Verlag in Wuppertal, der damals noch Jugenddienst-Verlag hieß, und arbeitete zwei Jahrzehnte als Verleger. Auch danach zeigte er seine Verbundenheit noch durch Taten. Er sprach zum Festakt des 175-jährigen Bestehens des Börsenvereins 2000, war Gast bei zahlreichen Börsenvereinsveranstaltungen, besichtigte die Schulen des Deutschen Buchhandels, war Schirmherr des Vorlesewettbewerbs, nahm den damaligen Vorsteher des Börsenvereins, Dieter Schormann, mit zum Staatsbesuch nach Spanien und sprach bei einer Veranstaltung in Berlin, mit der Börsenverein und PEN 2003 an den 70. Jahrestag der Bücherverbrennung erinnerten.
Im Juni eröffnet in Marbach das _Literaturmuseum der Moderne_ vom deutschen Literaturarchiv der Schillergesellschaft. Am 6. Juni wird die erste Ausstellung mit Bundespräsident Horst Köhler eröffnet. Gezeigt werden künftig Manuskripte und Dokumente aus dem literarischen Leben – Romanmanuskripte, handgeschriebene Briefe, Kladden und Notizbücher, Erstausgaben und Dokumente aus dem Leben der Schriftsteller und Dichter. Es ist der kostbare Rohstoff, den Wissenschaftler immer wieder aus den Magazinen fördern, um bisher Unveröffentlichtes zu publizieren, Werkausgaben zu revidieren oder neue Editionen zu planen. Rund 1200 Nachlässe und Vorlässe lagern im Deutschen Literaturarchiv – neben einer Reihe von Sammlungen und Verlagsarchiven: etwa von S. Fischer, Piper, Insel und Luchterhand. Das Gebäude ist treppenartig in den Hang neben dem Schiller-Nationalmuseum hineingebaut. Für Museumsleiterin Heike Gfrereis soll das „LiMo“ in erster Linie eine Brücke bauen: zwischen dem sammelnden Archiv, das seine Bestände „langsam, asketisch, esoterisch“ erweitert, und der Ausstellung, die die Betrachter unmittelbar ansprechen soll. Gfrereis will dem „flachen Papier zur Dreidimensionalität verhelfen“. In schrankhohen Vitrinen sind ab Juni in den vier unterschiedlich großen Ausstellungsräumen auf 1000 Quadratmetern Kostbarkeiten zu sehen: die Originalmanuskripte von Franz Kafkas „Prozess“, Martin Heideggers „Sein und Zeit“ und Alfred Döblins „“Berlin, Alexanderplatz“ sowie zahlreiche andere Texte und Dokumente von Jean Amery über Paul Celan bis Ernst Jünger, von Günter Grass über Sarah Kirsch bis Oskar Pastior. Neben der Dauerausstellung, die rund 600 Quadratmeter beansprucht, werden auf den übrigen 400 Quadratmetern im Wechsel Ausstellungen aus den Archivbeständen zu sehen sein. Gfrereis verfolgt beim Entwurf der Ausstellung ein ungewöhnliches didaktisches Konzept: „Dem Besucher wird keine Orientierung anhand von Schautafeln und tradierten Einteilungen der Literaturgeschichte geboten. Wir geben keine Handreichungen zu Leben und Werk von Autoren. Stattdessen gehen wir gleichsam archäologisch vor: Wir legen die Bestände des Archivs offen und stellen ihre phänomenale Seite, ihre Materialität, in den Vordergrund.“ So kann der Besucher künftig etwa Gedichte von Gottfried Benn in Augenschein nehmen, die der Dichter auf die Rückseite von Speisekarten schrieb, oder die Zettelkästen des Philosophen Hans Blumenberg. Gfrereis geht es darum zu „zeigen, wie Literatur aussieht, wenn sie ins Leben kommt, wenn sie geschrieben und gelesen wird“. Eine Navigationshilfe wird in Gestalt des Multimedia-Readers
„M 3“ gegeben, der Kurzführungen abspielt, Manuskripte transkribiert und Stimmen der Dichter zu Gehör bringt. Das Motto des ersten Jahresprogramms lautet „Zeigen“, unter der das Deutsche Literaturarchiv und das „LiMo“ zahlreiche Lesungen, Ausstellungen und Podien stellen – unter anderem zu Carl Schmitt, Arno Schmidt und Gottfried Benn. Im Literaturmuseum der Moderne werden also nicht nur Dichter Thema sein, sondern auch Wissenschaftler und Gelehrte. Zum Thema Carl Schmitt wird eine Editorentagung stattfinden, in die die beteiligten Wissenschaftsverlage einbezogen werden. Für Verlage wird das „LiMo“ künftig ein wichtiger Referenzpunkt sein; zeigt es doch die Literatur in ihrem Materialstadium und macht den Zusammenhang plastisch sichtbar, in dem die moderne deutschsprachige Literatur steht. Bereits vor der Eröffnung findet in Worms am Donnerstag, den 27. April, um 20 Uhr im Heylsschlösschen (Eingang Schlossplatz) bei freiem Eintritt, veranstaltet vom Nibelungenmuseum, ein Vortrag der Leiterin des „LiMo“ Dr. Heike Gfrereis „Museale Präsentation von Literatur“ statt, wo sie ihr Museumskonzept zwischen Tradition und Innovation vorstellt.
http://www.dla-marbach.de und http://www.nibelungen-museum.de
Wie im letzten Jahr berichtet, wollte der Bundestag die _Deutsche Bibliothek_ in _Deutsche Nationalbibliothek_ umbenennen. Dies ist nunmehr vom Bundesrat abgelehnt worden. Bayern und Berlin hatten eingewandt, dass die Bayrische Nationalbibliothek und die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz gleichrangige Funktionen hätten. Kulturstaatsminister Bernd Neumann verteidigt aber weiterhin die Umbenennung gegen die Kritik aus den Ländern: „Die Deutsche Bibliothek erfülle aufgrund ihres Sammel- und Archivauftrags seit über 90 Jahren die Kernaufgaben einer Nationalbibliothek“.
Wie schon in der vorherigen Buchwurminfo berichtet, ist _Gottfried Honnefelder_ vom Kölner Verlag Dumont Literatur und Kunst ab Januar 2006 neuer Vorsteher des Börsenvereins, zunächst bis zur Hauptversammlung im Mai. Sein Stellvertreter ist _Olte Schultheis_ (Bücherjolle Starnberg). Honnefelder war bislang Stellvertreter und rückte nach Ausscheiden von _Dieter Schormann_ nach. Mit dem neuen Vorstand beginnt eine Debatte um die Konzern-Marktkonzentrationen. Aggressives Marktverhalten soll im Licht der eigenen Regeln der Buchbranche bewertet und geprüft werden, wie weit Marktteilnehmer in ihrer Politik gegenüber Branchenkollegen gehen dürfen. Der Börsenverein sucht nicht die Konfrontation mit einzelnen Mitgliedern, sondern will gemeinsam mit ihnen die Marktentwicklung auf breitem Konsens bewerten und gegebenenfalls Branchenregeln überdenken. Zu prüfen, ob die Spielregeln, die sich die Branche selbst gegeben hat, von allen eingehalten werden und ob sie tauglich sind, bleibt Aufgabe des Verbandes. Da sich der Markt rasant verändert, will man auch künftig rascher zu Ergebnissen kommen. Das zeigt sich auch beim Thema Volltextsuche. Amazon und Google treiben ihre Projekte mit Hochdruck voran. Damit die Verlage die Hoheit über ihre Daten nicht aus der Hand geben müssen, feilt der Börsenverein an einer Branchenlösung zur „Volltextsuche online“.
Frankfurt ist um ein Schmuckstück reicher geworden. Korea hat sich als Dank für seinen Gastlandauftritt auf der _Frankfurter Buchmesse_ mit einem ganz besonderen Geschenk bedankt. Im Frankfurter Grünewaldpark befindet sich nun eine fernöstliche Anlage, die Korea gestiftet hat.
Bundeskanzlerin Angela Merkel warb beim amerikanischen Präsidenten dafür, dass die USA 2008 Gastland der Frankfurter Buchmesse werden. Als Buchliebhaberin hat sie sich zuvor nicht unbedingt präsentiert. 2003 besuchte sie zum ersten Mal die Frankfurter Buchmesse. Zumindest Laura Bush, die Gattin des amerikanischen Präsidenten, steht der Präsentation ihres Landes bei der Frankfurter Buchmesse wohlwollend gegenüber. Sie ist in den USA auch sehr engagiert, was das Thema Leseförderung anbelangt, und verfügt über gute Kontakte in der US-Verlagsszene.
|Das Börsenblatt, das die hauptsächliche Quelle für diese Essayreihe darstellt, ist selbstverständlich auch im Internet zu finden, mit ausgewählten Artikeln der Printausgabe, täglicher Presseschau, TV-Tipps und vielem mehr: http://www.boersenblatt.net/. |