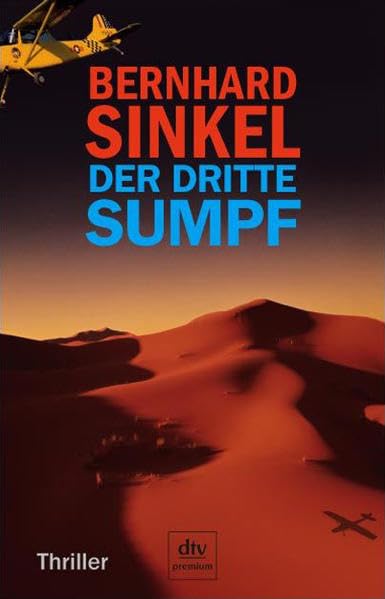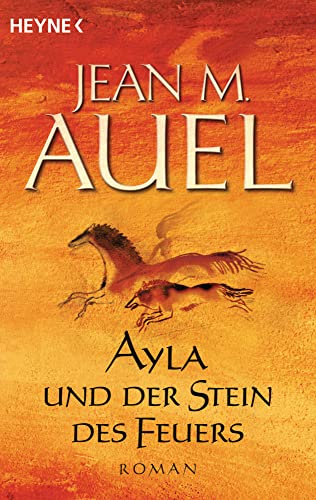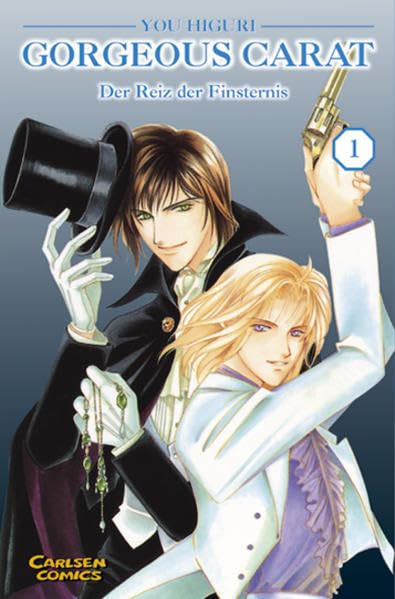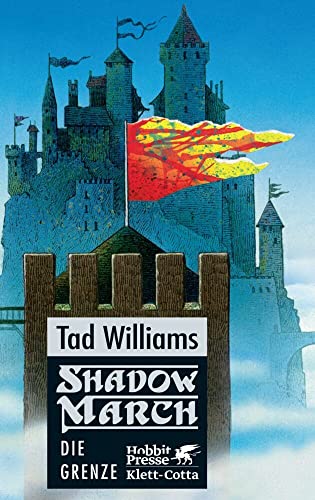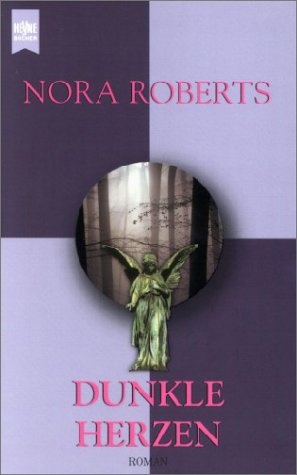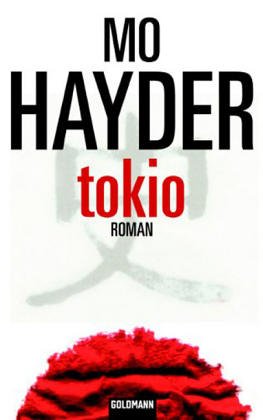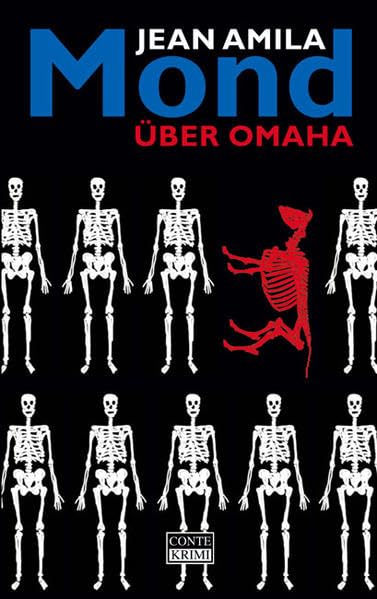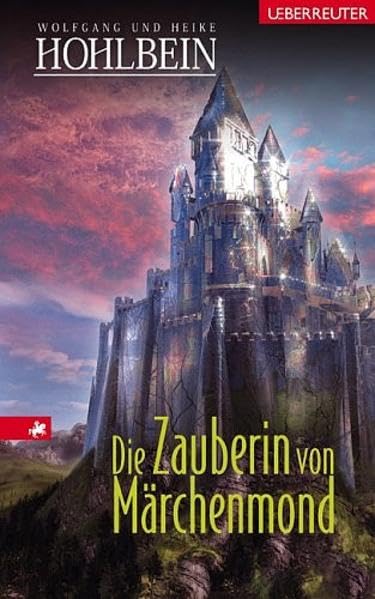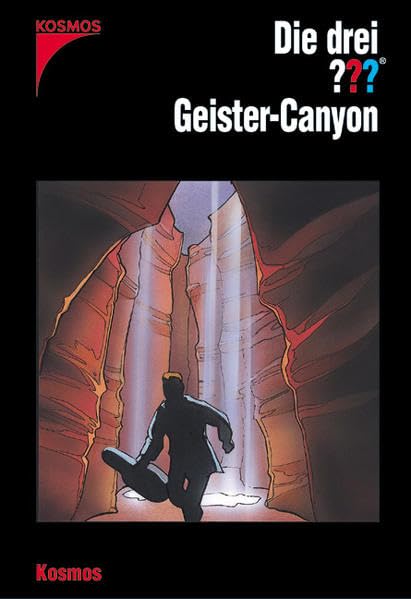
Sinkel, Bernhard – dritte Sumpf, Der
_Der Autor_
Bernhard Sinkel wurde am 19. Januar 1940 in Frankfurt am Main geboren. Erstes und Zweites Juristisches Staatsexamen. Von 1970 bis 1972 Leiter des Archivs und der Dokumentation des Magazins |Der Spiegel|.
Seit 1974 Arbeiten als Produzent, Drehbuchautor und Regisseur u. a. von „Lina Braake“ (1974), „Berlinger“ (1975), „Deutschland im Herbst“ (1978) und „Der Kinoerzähler“ (1992), für die er mit zahlreichen internationalen Filmpreisen ausgezeichnet wurde.
_Story_
Raoul Levkowitz ist der CIA noch immer ein Dorn im Auge. Wegen einer geheimen Dopingakte, mit der er einigen in den USA ansässigen Doppelagenten an die Wäsche hätte gehen können, ist CIA-Agent Gallagher ihm schon länger auf der Spur. Ein weiterer Grund für das Interesse des Geheimdienstes: Weil Levkowitz die Dokumente nicht herausgerückt hat und die Geschichte mittlerweile größere Kreise gezogen hat, wurde außerdem das Zeugenschutzprogramm des CIA merklich gefährdet.
Natürlich ist Gallagher auch weiterhin hinter den Daten her und bittet Levkowitz um Vernunft. Deswegen fordert er ihn auch zur Zusammenarbeit auf, die der Berliner Ex-Stasi-Spitzel, dessen besonderes Merkmal ein fotografisches Gedächtnis ist, aber kategorisch ablehnt. Noch dramatischer wird die Situation für die Ermittler, als bekannt wird, dass Levkowitz seit frühester Kindheit mit dem jemenitischen Terroristen Ahmed bin Salim al-Amir befreundet ist, den die USA dringend zur Strecke bringen möchten. Raoul jedoch hält nicht viel von den Machenschaften der verschiedenen Geheimbünde, die ihm ob dieser Bekanntschaft fortan auf den Fersen sind und verweigert jegliche Kooperation.
Die CIA sieht sich dazu gezwungen, andere Mittel zu bemühen, und erpresst Levkowitz, der kurz davor steht einzulenken. Dann jedoch ergibt sich für seine Freundin Dorothy Jensen die Gelegenheit, ein Archäologenteam in die Wüste des Jemen zu fliegen. Auch Raoul soll mit an Bord gehen, wird aber kurz vorher krank und muss passen. Als Dorothys Flugzeug allerdings in der Wüste abstürzt, begibt er sich ebenfalls in den Jemen und sucht verzweifelt seine verschollene Freundin. Levkowitz weiß jedoch nicht, dass die CIA eine erneute Verschwörung gestartet hat, bei der Raoul sie geradewegs zum Terroristenführer al-Amir führen soll …
_Meine Meinung:_
In „Der dritte Sumpf“ setzt Bernhard Sinkel die im letzten Thriller „Bluff“ gestartete Geschichte um seinen Hauptcharakter Raoul Levkowitz fort. Auch in seinem neuesten Werk bezieht sich der Autor dabei auf die Stasi-Vergangenheit seines Schützlings bzw. deren Bedeutung für das Jetzt, wobei die Folgen seiner ehemaligen Bekanntschaften dieses Mal weitaus verheerender sind.
Sinkel lehnt sich dabei sehr weit aus dem Fenster und schießt indirekt besonders gegen die CIA, die mit ihren verschwörerischen Machenschaften selbst vor den grausamsten Erpressungsmethoden nicht zurückschreckt. Lag sein Schwerpunkt im ersten Band noch auf den Zusammenhängen hinsichtlich des CIA-Einflusses in der DDR, spannt er nun das Netz bis hin zur US-amerikanischen Anti-Terrorpolitik im Nahen Osten und hat sich hierfür exemplarisch den Jemen als Zielort herausgesucht. Nun, gut: Dass ausgerechnet dieser Levkowitz auch Kontakte in den arabischen Staat haben soll, ist im Gesamtkontext sicherlich etwas weit hergeholt, aber über so etwas sollte man erst gar nicht nachdenken. Stattdessen sollte man einfach genießen, wie Sinkel mit sehr einfachen Mitteln eine ziemlich komplex arrangierte Story aufbaut, die bis ins letzte Detail fein ausgeklügelt ist und trotz ihrer fiktiven Entwicklung sehr realistisch wirkt. Der Autor bezieht sich sehr stark auf ein mittlerweile alltäglich gewordenes, sehr brisantes Thema und bettet dieses in einen sehr spannenden Thriller ein, der einerseits ziemlich brutal (auf mentaler Ebene), andererseits dadurch aber auch nur authentischer wird.
Natürlich bleiben die politische Meinung und die deutliche Kritik an den Institutionen der Vereinigten Staaten seitens Sinkel nicht außen vor, aber wären diese nicht enthalten, könnte er die Erzählung sicherlich auch nicht mit einer derartigen Überzeugungskraft ausfüllen, wie es schlussendlich der Fall ist. Diese Entschlossenheit zeigt sich letztendlich auch im enorm flotten Erzähltempo: Sinkel lässt kaum Zeit verstreichen, um die Handlung einzuleiten; dazu reicht schon ein minimaler Prolog mit den Ereignissen aus dem vorangegangenen Buch. Danach startet der Autor direkt mitten im Geschehen und kommt auch während der Entwicklung des Plots immer sehr zügig auf den Punkt, was sicherlich ein weiteres Indiz für die recht nervenaufreibende Atmosphäre der Handlung ist.
Gut 250 Seiten reichen schließlich aus, um einen ziemlich gewagten und gerade deshalb auch äußerst lesenswerten Polit-Thriller zu kreieren, der trotz sprachlicher Schlichtheit durchgängig zu fesseln weiß. Für Freunde solcher Materie ist „Der dritte Sumpf“ aus diesem Grund auch nur empfehlenswert – speziell für Leute, die eine Antipathie gegen die Bush-Regierung und ihre zahlreichen Nebenarme haben. Für diese Zielgruppe lohnt sich dann aber auch das komplette, mit „Bluff“ beginnende Paket, auf dem Teile der Handlung aufbauen.
Erik Larson – Isaacs Sturm
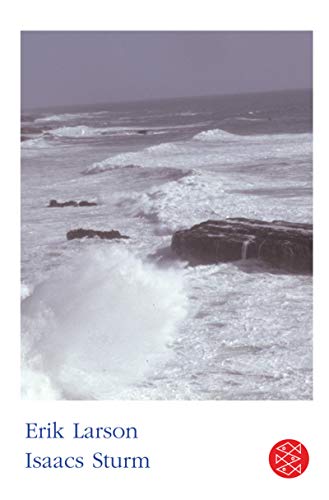
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts scheint der Mensch erstmals und endlich in der Lage zu sein, die Welt zu verstehen und nach seinem Willen zu formen. Details machen ihm noch zu schaffen, aber auch das wird sich binnen kurzer Zeit gewiss ändern. Der berechtigte Stolz darauf, was Technik und Wissenschaft in den geschaffen haben, geht freilich leicht in Hybris über. Diese Lektion muss die aufstrebende Weltmacht USA im Sommer des Jahres 1900 auf grausame Weise lernen.
Vielleicht ist gesunder Menschenverstand zu viel verlangt für ein nationalstolzes Land, das sowohl energisch als auch erfolgreich daran arbeitet, politisch und militärisch seine Konkurrenten auszuschalten. Gerade erst haben die Vereinigten Staaten einen Krieg mit Spanien vom Zaun gebrochen, mit geradezu spielerischer Leichtigkeit gewonnen und die karibische Kolonie Kuba in ihren Besitz genommen.
Isaac Cline ist der perfekte Repräsentant der neuen Zeit. Der junge Mann stammt aus relativ einfachen Verhältnissen, doch mit seinem messerscharfen Verstand, seiner nie versiegenden Energie und seinem unerhörten Arbeitseifer gelingt ihm die Realisierung des „Amerikanischen Traums“, der ihn binnen weniger Jahre zu Reichtum, Anerkennung und gesellschaftlichem Aufstieg führt. Clines Interesse gilt dem Wetter und vor allem der Möglichkeit, es vorauszusagen. Um 1900 beginnt sich die Meteorologie von einer Schwarzen Kunst in eine Wissenschaft zu verwandeln und in ein Politikum: Unter der Flagge der Vereinigten Staaten fährt um die Jahrhundertwende eine der mächtigsten Flotten der Welt.
Wissen ist tatsächlich Macht
Die größte Gefahr droht diesen Schiffen nicht von ihren Feinden, sondern von unvorhergesehenen Stürmen auf hoher See. Besonders in der Karibik, dem gerade gewonnenen Vorhof der jungen Großmacht, gehen auf diese Weise jährlich zahlreiche Schiffe und ihre Besatzungen buchstäblich zugrunde. Die besonderen Wetterverhältnisse führen über dem Golf von Mexiko in jedem Sommer zur Entstehung von Hurrikans, gewaltigen tropischen Wirbelstürme, die von ihrer Wiege, dem afrikanischen Kontinent, über den Atlantik kommend, entlang der Küstenlinie des nördlichen Südamerikas und Mittelamerikas eine Kurve nach Nordosten über die USA schlagen und dabei alles verwüsten, was ihren Weg kreuzt.
Zu den besonders gefährdeten Bundesstaaten gehört Texas, das dem Europäer eher durch Prärien und kleine Städte des Wilden Westens präsent ist, tatsächlich jedoch über eine lange Küste zum Golf von Mexiko verfügt. Hier liegen die beiden Städte Houston und Galveston, die um 1900 darum wetteifern, zur Hauptstadt ihres Staates zu werden. Die Waagschalen neigen sich allmählich zu Gunsten Galvestons. Das US Wetteramt siedelt seinen Chef Meteorologen für Texas hier an, da Galveston einen Logenplatz auf die labile Wetterlage der westindischen Region bietet.
Seit gut einem Jahrzehnt steht Isaac Cline der angesehenen Wetterstation in Galveston vor. Er gehört zur Prominenz der Stadt, hat nebenbei Medizin studiert, schreibt Artikel über seine Arbeit, gibt Vorlesungen und hat sogar die Zeit gefunden, eine Familie zu gründen. Alles ist planmäßig gelaufen im Leben Clines, der im Jahre 1900 auf der Höhe seiner Karriere steht. Er glaubt alles über das Wetter zu wissen, was die moderne Meteorologie, als deren hervorragender Vertreter er sich ohne falsche Bescheidenheit sieht, herausgefunden hat. Dass er sich quasi anmaßt, die Naturgesetze zu diktieren, ist ihm nicht bewusst. Hurrikans, davon ist Cline überzeugt, kündigen sich durch unverwechselbare Vorzeichen an. Solange er diese nicht am Himmel erkennt, wird es ergo auch kein Unwetter geben.
Ein verhängnisvoller Irrtum
Der große Hurrikan von 1900 will sich nicht in Clines Weltbild fügen. Eine Reihe klimatischer Ausnahmebedingungen lässt ihn direkten Kurs auf Galveston nehmen. Die Katastrophe naht nicht unbeobachtet, doch Cline, der den Himmel über Galveston und die Gezeiten beobachtet, kommt zu dem Schluss, dass der Sturm sich auflösen wird, bevor er die Stadt erreicht. So gibt es für die Bürger von Galveston keine Vorwarnung. Ahnungslos gehen sie ihren alltäglichen Geschäften nach, während der Hurrikan sich über dem Golfstrom nähert und dabei eine gewaltige Flutwelle vor sich aufzuschieben beginnt.
Galveston ist eine Boomstadt, die praktisch planlos und genau dort an der Küste errichtet wurde, wo es zwischen Meer und Land keinerlei Hindernis gibt, die eine Flutwelle brechen oder einen Sturm ablenken könnte. Die Bürger haben es aus Bequemlichkeit und Kostengründen nie für nötig befunden, einen schützenden Damm zu bauen. So nimmt das Verhängnis seinen ungehinderten Lauf: Binnen weniger Stunden wird Galveston ausgelöscht. Mindestens 6000 Menschen, vielleicht aber auch die doppelte Anzahl, verlieren ihr Leben. Genau wird man es niemals wissen, weil sich die Stadt in eine riesige Schlamm und Trümmerwüste verwandelt hat, unter der zahllose Opfer für immer begraben liegen.
Die verdrängte Katastrophe
Der Untergang der Stadt Galveston gehört zu jenen Ereignissen, die aus zunächst unerfindlichen Gründen zu einer Fußnote der Weltgeschichte herabgesunken sind. Bei näherer Betrachtung trifft man allerdings sehr alte Bekannte wieder, die dafür verantwortlich sind: Dummheit, Ignoranz, Selbstgefälligkeit, vor allem aber der tief verwurzelte menschliche Drang, unangenehme Erfahrungen zu verdrängen besonders dann, wenn man sie zwar verschuldet hat, aber selbst nicht betroffen ist.
Die wahre Tragödie ist weniger die Katastrophe selbst, sondern die Tatsache, dass sie in diesem Ausmaß hätte verhindert werden können. Dieser Erkenntnis mochte man sich bisher nicht einmal in Galveston selbst stellen. Dort sang man lieber das hohe Lied des Heldentums im Angesicht der drohenden Gefahr, und am lautesten erklang das Lob für Isaac Cline, den angeblichen Helden, der selbstlos seine Mitbürger noch vor dem Hurrikan warnte, als die Sturmflut bereits ganze Häuserzüge durch die Luft wirbelte. Cline hat persönlich an seinem Denkmal gearbeitet, und das gelang ihm angesichts seines publizistischen Geschicks hervorragend, zumal er so alt wurde, dass er jene, die es besser wussten, in der Mehrzahl einfach überlebte.
Erik Larson hatte es folglich nicht leicht, als er sich daran machte, die Geschichte Galvestons und des großen Hurrikans von 1900 zu rekonstruieren. Der Sturm hat die frühen Archive vor Ort vollständig vernichtet. Aber in den Familien der zahllosen Opfer fand Larson viele Augenzeugenberichte, die ein in dieser Klarheit bisher nicht gekanntes Bild der Katastrophe zeichnen. Die detaillierte Schilderung des Sturms und seiner Folgen ergänzt Larson durch einen ausführlichen Blick auf die Geschichte der Vereinigten Staaten an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Ohne würden die Ereignisse in Galveston unverständlich bleiben. Nicht fehlen darf eine Einführung in die Wetterkunde und hier naturgemäß in die Genese großer Wirbelstürme.
Der Leser als Zeuge
Larson wählt für sein Buch die Form des Tatsachenromans. Er schildert, was gewesen ist, scheut sich aber nicht, Lücken durch (allerdings gut abgesicherte) Vermutungen zu schließen. Wie der große Hurrikan vor der westafrikanischen Küste entstand und seinen verhängnisvollen Weg nahm, ist inzwischen geklärt. Larson präsentiert die komplizierten Mechanismen des Wetters verständlich und spannend zugleich. Dies gilt auch für die politischen Intrigen im und um das Wetteramt, die wohl hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass der Sturm ein völlig ahnungsloses Galveston traf.
„Isaacs Sturm“ ist nicht nur die Chronik einer Katastrophe, sondern auch die Tragödie eines Mannes, der (zu) viel wusste und doch unwissend war. Um 1900 benannte man große Stürme nach prominenten Opfern. Larson greift diese Tradition auf. Auch wenn Isaac Cline (1862 1955) das Unglück überlebte und niemals zur Rechenschaft gezogen wurde, blieb er für den Rest seines langen Lebens gezeichnet: Mit seiner Frau kam sein ungeborenes jüngstes Kind um, und in Augenblicken echter, von Selbstbetrug freier Reflexion begriff Cline durchaus, dass er und sein verehrtes Wetteramt kapitale Fehler begangen hatten.
Eric Larson ist mit „Isaacs Sturm“ zu Recht ein Bestseller gelungen. Mit dem Talent des echten Erzählers behält er die Fäden seiner Geschichte, die den halben Erdball umspannen, jederzeit fest in der Hand. „Spannend wie ein Krimi“ ist ein Urteil, das (viel zu) oft über ein Buch gesprochen wird, doch auf „Isaacs Sturm“ trifft es
zweifellos zu. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann das Fehlen von Bildern, die es in großer Zahl gibt. Aber das Internet gleicht dieses Manko aus. Die Eingabe der Begriffe „Galveston“ und „hurrican“ genügt, um zeitgenössische Fotos aus der dem Erdboden gleichgemachten Stadt betrachten zu können.
Autor
Erik Larson (geb. 1954) wuchs in Freeport, Long Island, auf. Er absolvierte die University of Pennsylvania, die er mit einem Abschluss in Russischer Geschichte verließ. Klugerweise ergänzte er dies mit einem Studium an der Columbia Graduate School of Journalism. Im Anschluss arbeitete er viele Jahre für diverse Zeitungen und Magazine.
Inzwischen hat Larson diverse Sachbücher veröffentlicht, von denen „Isaac’s Storm“ (1999, dt. „Isaacs Sturm“) ihm den Durchbruch und Bestseller-Ruhm brachte. Der Autor lebt mit seiner Familie in Seattle.
Taschenbuch: 373 Seiten
Originaltitel: Isaac’s Storm. A Man, a Time, and the Deadliest Hurricane in History (New York : Crown Publishers 1999)
Übersetzung: Bettina Abarbanell
http://www.fischerverlage.de
Der Autor vergibt: 



Parzzival, S.H.A. – Todesanzeigen (Titan-Sternenabenteuer 22)
Mit Band 22 beginnt in der Reihe der „Titan-Sternenabenteur“ ein gänzlich neuer Zyklus, der zwar auf den bekannten Hauptfiguren aufbaut, sich thematisch aber stark von den bisherigen Teil-Episoden löst. Der |BLITZ|-Verlag nennt den neuen Schwerpunkt Social Fiction und beschreibt damit den vermehrten Einbezug von Szenarien, die such außerhalb des Weltraums abspielen. In „Todesanzeigen“ feiert zudem ein neuer Autor im Rahmen dieser Serie sein Debüt. Jedoch gibt es bislang noch keine detaillierten Informationen zur Person, die unter dem Pseudonym S.H.A. Parzzival schreibt. Feststeht lediglich, dass die Ideen, auf denen die Story im neuen Zyklus beruht, vom leider im letzten Jahr verstorbenen Thomas Ziegler abstammen, dem man mit dem noch unbetitelten Zyklus auch eine Art Tribut zollt.
_Story_
Nach den Anschlägen auf die Asteroidenwerft der CRC bzw. den Abenteuern im fremden Reich innerhalb der Parakonblase haben sich Shalyn Shan und das Team der |TITAN| ein paar Tage Urlaub gegönnt, der von der Kommandantin eines Abends dazu genutzt wird, um zusammen mit dem befreundeten Kollegen, dem Quogonen Sir Klakkarakk, eine prominente Disco zu besuchen. Dort lernt sie die faszinierende Monja kennen, zu der sich Shalyn sofort hingezogen fühlt. Ganz entgegen ihren sonstigen Prinzipien nimmt die Suuranerin die fremde Dame noch am selben Abend mit in ihre Wohnung und beginnt eine leidenschaftliche Beziehung mit Monja.
Die direkte Umgebung Shalyns ist ein wenig irritiert ob der neuen Situation, lässt das lesbische Liebespärchen alerdings gewähren und akzeptiert ihre Zuneigung zueinander. Allerdings ist Amos Carter, Shalyns Chef und der Anführer der CRC, ein wenig beunruhigt, weil es kaum Informationen zur Vergangenheit Monja gibt. Als man schließlich herausfindet, dass beinahe alle Ex-Geliebten der hübschen Fremden kurz nach dem Ende einer Beziehung ums Leben gekommen sind, macht sich auch Shalyn ernsthaft Sorgen und stellt ihre Freundin zur Rede. Erst als sich die Mysterien halbwegs aufdecken lassen und man herausfindet, dass Monja an ständigen Blackouts leidet, beruhigt sich die Kommandantin der |TITAN| wieder. Dann jedoch tritt ein erneuter Todesfall im Umfeld von Monja ein …
Währenddessen herrscht auf der Erde Aufruhr wegen eines plötzlichen Befalls von Rieseninsekten. Die monströsen Viecher haben es in erster Linie auf die WORLD MARKET-Kette des Großinduistriellen Michael Moses abgesehen, doch kurze Zeit später tauchen sie auch in bewohnten Gebieten auf und fordern erste Todesopfer. Die World Police nimmt sich des Falles an und vermutet, dass einige Öko-Terroristen hinter den zahlreichen Anschlägen stecken, deren Ziel es ist, den enorm einflussreichen Moses und dessen weltweites Kartell zu zerstören …
_Meine Meinung_
Eine neue Ära der „Titan-Sternenabenteuer“ und tatsächlich eine völlig neue Perspektive bietet dieser erste Band des neuen Zyklus. S.H.A. Parzzival beschreibt die ‚etwas andere‘ Handlung vornehmlich aus der Sicht von Shalyn Shan, kann den Leser aber anfangs noch nicht sonderlich fesseln. Vor allem die etwas übertrieben dargestellte Faszination für die mysteriöse Monja nimmt zu Beginn der Geschichte viel zu viel Raum ein, und die Betonung, dass man der Fremden trotz aller Begleitumstände nicht böse sein kann, hätte man diesbezüglich – nur um mal ein Beispiel zu nennen – durchaus eingrenzen können. Klar, die Dame spielt die wahrscheinlich tragendste Rolle im gesamten Roman, und daher ist es auch berechtigt, sie in einem besonderen Rahmen vorzustellen und in die Handlung einzuführen, aber da sich diese Haltung selbst in den Szenen, in denen dem neuen Liebespaar eine enorme Gefahr droht, etabliert, wirkt das Ganze auf die Dauer sehr überstrapaziert.
Zu der lesbischen Beziehung, die demzufolge natürlich auch eine sehr große Beachtung findet, kann man hingegen stehen, wie man will. Ich persönlich finde dieses Element recht belebend und erfrischend, was aber sicherlich auch daran liegt, dass S.H.A. sich Details ausspart und lediglich Andeutungen über die Liebeleien der beiden Frauen macht. Tatsächliche Erotik statt lüsterner Beschreibung einer heißen Affäre – damit fährt der Autor (die Autorin?) ziemlich gut, und somit hat die plötzliche Wandlung der Shalyn Shan auch ganz klar eine Berechtigung.
Der neue Zyklus verspricht indes auch spannend zu werden; Parzzival hat im ersten Teil schon so einige Handlungsstränge eröffnet, in denen eine Menge Potenzial steckt. In dieser Hinsicht gefällt mir sehr gut, dass er/sie zum Ende des Buches nur kurze Andeutungen auf die Urheber der globalen Attacken macht, die genauen Umstände aber unerwähnt lässt und so auch die Spannung übr diesen Band hinaus problemlos aufrechterhält. Gleiches gelingt ihm mit der Darstellung der seltsamen Monja sowie den undurchsichtigen Rückblicken auf ihre unbekannte Vergangenheit. Wer ist diese Frau wirklich? Und kann man ihr trauen? Hier wird sich im folgenden Buch „Germania“ sicher mehr ergeben, und die Vorfreude hierauf ist nach dem etwas schwerfälligen Einstieg in den neuen Zyklus dann doch wieder recht groß. Andererseits: Ganz so gut wie der „Parakon-Zyklus“ gefällt mir die neue Reihe noch nicht, was ich in erster Linie auch an der stilistisch ganz neuen Herangehensweise festmache. Fans der Serie sollten sich davon aber nicht beirren lassen und der |TITAN| auch weiterhin treu bleiben. Die Hauptfiguren sind schließlich dieselben, und hat man sich mit diesen einmal angefreundet, kommt man auch nicht mehr von ihnen los.
http://www.blitz-verlag.de/
Zsuzsa Bánk – Heißester Sommer. Erzählungen
Im Jahr 2002 wurde Zsuzsa Bánks Debütroman [„Der Schwimmer“ 2054 zum Überraschungserfolg des damaligen Buchherbstes. Die sensibel erzählte Geschichte, von der Kritik mit zahlreichen Preisen bedacht, bleibt vor allem durch Bánks einfühlsame Sprache im Gedächtnis. Ihr melancholischer und wehmütiger Erzählfluss geht direkt ins Herz, nistet sich dort ein, brütet und lässt den Leser nicht mehr los. Zsuzsa Bánk fesselt mit dem Nicht-Gesagtem, dem Angedeuteten, dem vage Umschriebenen und schafft damit eine unwirkliche Atmosphäre, die schimmert wie der Asphalt einer sonnenbeschienenen Straße.
Bei einem so kraftvollen und überzeugenden Erstling erwartet der Leser viel vom nächsten Buch. Doch statt eines zweitens Romans hat die Autorin nun einen schmalen Band mit zwölf Erzählungen veröffentlicht. Erzählungen, die über Jahre hinweg entstanden sind, beispielsweise während ihrer Lesereise für „Der Schwimmer“.
Schon auf den ersten Seiten, ja nach den ersten Sätzen, ist sie wieder da: diese ganz spezielle Stimmung, die nur Bánk so zu evozieren vermag. Es ist ein gefühliges Schweben, eine schwere Melancholie, die den Leser mehr einhüllt als die Figuren der Erzählungen. Die sind zumeist viel zu sehr in ihrem Leben gefangen, um Muße zur Reflektion zu haben. Da sind zwei Freundinnen, die jährlich eine Bekannte in einer Anstalt besuchen, das Wiedersehen zwischen alten Bekannten oder das Zerbrechen einer Beziehung. Alle der zwölf Geschichten, mit Ausnahme der abschließenden „Delphine“, kreisen als Variation um ein Thema. Es geht um den Abschied, um die Vergänglichkeit von Freundschaften, Liebschaften, Beziehungen. Es geht um das Zerbrechen von Dingen, die man für ewig und wichtig gehalten hat.
Doch nichts ist von Dauer in dieser Sprachwelt von Zsuzsa Bánk, die wie ein Wirbel zwischenmenschliche Beziehungen in den Abgrund reißt. Die Zeiten ändern sich, Menschen und Umstände ändern sich. Und manchmal ist es einfach unmöglich, an Gefühlen und Zuständen festzuhalten, wie verzweifelt man es auch immer versucht. Menschen leben sich auseinander; sie schlagen unterschiedliche Lebenswege ein, doch dies verträgt sich kaum mit dem Wunsch nach Stetigkeit.
Bánks Geschichten leben von dem, was sie verschweigt oder nur andeutet. Beziehungen zwischen den Figuren werden fast nie deutlich benannt, nur skizziert. Doch gerade dadurch gewinnen sie in der Vorstellung des Lesers an Gewicht und Lebendigkeit. Ihre Darstellung ist minimalistisch und doch punktgenau – rein sprachlich ein Genuss.
„Heißester Sommer“ hat jedoch ein Problem: Die Erzählungen lesen sich wie zwölf Variationen auf ein Thema, wieder und wieder hält Bánk den Finger in die Wunde menschlicher Empfindung. Allerdings verschwimmen die Geschichten ab einem gewissen Punkt, all die Frauennamen werden zu einem Pool kaum unterscheidbarer Protagonistinnen. Es ist schwer, die einzelnen Erzählungen in Erinnerung zu behalten, da sie thematisch jeweils so ähnlich liegen und bewusst beim Leser ähnliche Gefühle und Reaktionen hervorrufen sollen. Das ermüdet auf Dauer. Es ist daher sicherlich wie auch schon beim „Schwimmer“ zu empfehlen, den Erzählband in kleinen Dosen zu genießen, all die Schwermütigkeit könnte ansonsten zu Überfütterung führen.
Diese thematische Eigenheit des Buches beeinflusst jedoch nicht dessen stilistische Brillanz. Eindringlich ist Bánks Sprache, reduziert auf das Wesentliche, und so gelingt es ihr auch, ganze Lebenswege in Geschichten anzudeuten, die zwanzig Seiten kaum überschreiten. Ihre Erzählweise zieht den Leser sprichwörtlich in einen Bann, in einen Strudel aus Worten und Bedeutungen, die entknüpft und verdaut werden wollen. Zsuzsa Bánk ist nichts für den Strand, auch nicht für die Bahn. Ihre Gesellschaft ist etwas, das bewusst genossen und nicht in Eile konsumiert werden sollte.
Mit „Der Schwimmer“ war ihr vor drei Jahren der große Wurf gelungen. „Heißester Sommer“ ist ein solider Nachfolger, sprachlich fehlerlos, doch thematisch keineswegs so fesselnd wie ihr Roman. Der Erzählband ist eher das dauernde Schwingen einer Stimmung denn eine Sammlung von Erzählungen im klassischen Sinne. Wer nach frischer Wortgewalt von Zsuzsa Bánk lechzt, dem wird „Heißester Sommer“ ein treuer Gefährte sein. Wer Zsuzsa Bánk bisher noch nicht kennt, sei doch lieber an ihr Romandebüt verwiesen.
Jean M. Auel – Ayla und der Stein des Feuers (Erdenkinder 5)
30000 Jahre mag es her sein, da wird an der Küste des Schwarzen Meeres Ayla, ein kleines, halb verhungertes, durch ein Erdbeben eltern- und stammeslos gewordenes Mädchen vom Menschenschlag der Cro-Magnons – Sie und ich gehören ihm noch heute an – von einer Horde Neandertaler (der leicht vormenschlichen Konkurrenz), dem „Clan der Höhlenbären“, gefunden und aufgenommen – recht widerwillig, entspricht doch die Neue mit ihrem schlanken, geraden Wuchs, den blauen Augen, der hohen Stirn und den blonden Haaren so gar nicht den Schönheitsidealen ihrer krummbeinigen, wulstbrauigen und wortkargen Gastgeber. Das hässliche Schwänlein muss unter vielen stolzen Enten denn auch ein an Zuneigung armes aber an Knüffen und Püffen umso reicheres Dasein fristen, das durch die Feindschaft zwischen den „Anderen“, wie die Neandertaler Aylas Leute nennen, und den „Flachköpfen“, wie diese wiederum ihre urtümlichen Nachbarn schimpfen, nicht eben einfacher wird. Trotzdem arrangiert man sich, und Ayla schenkt sogar einem Sohn das Leben, der sich zwar schon im Vorschulalter rasieren müsste aber trotzdem von seiner Mutter heiß geliebt wird, bevor diese ihn dem fiesen, intriganten Kindsvater überlassen muss, als der Clan der Höhlenbären sie schnöde verstößt. („The Clan of the Cave Bear“, 1980; dt. „Ayla und der Clan des Bären“)
Es schließen sich einsame Lehr- und Wanderjahre eines Engels auf (vorzeitlicher) Erden an, der viel zu edel für diese Welt ist sowie dank eines schamanischen Crash-Kurses bei erwähntem Höhlenbären-Clan einen guten Draht zu Mutter Natur und ihren übersinnlichen Kindern besitzt. Diese sitzen irgendwo auf Wolke Sieben und lenken von dort die Geschicke derer, die da unter ihnen k(r)euchen und fleuchen. Einen Odem purer Güte und Nächstenliebe ausdünstend und im absoluten Wissen um die Heilkraft jedes Kräutleins, das da blüht, gelingt es Ayla, a) den bösen Wolf zum braven Haushund, b) das wilde Pferd zum geduldigen Reittier und c) den edlen Löwen zum Kingsize-Kätzchen zu zähmen. Nachdem sie diese Künste zur Vollendung gebracht hat, naht auch Mr. Right: der Werkzeugmacher Jondalar, wohlgestaltet, einfühlsam, liebevoll und – nicht zu vergessen – ein toller Liebhaber. Dieses Gottesgeschenk an die moderne Frau von Vorgestern hat auf einer kühnen Reise, die Jondalar aus seiner weit entfernten Heimat, der südfranzösischen Dordogne, den Fluss Donau – hinabführte, buchstäblich Schiffbruch erlitten und muss von Ayla zusammengeflickt und gepflegt werden, bevor man sich näherkommen und die gemeinsame Rückkehr in Jondalars Heimat beschließen kann. („The Valley of Horses“, 1982; dt. „Das Tal der Pferde“)
Gar lang ist die Reise, dazu hart und beschwerlich, und sie wird nicht einfacher dadurch, dass Ayla und Jondalar immer wieder warten müssen, während die Große Geistin dieser Urzeit-Welt – vulgo Jean M. Auel genannt – ihrer Neigung frönt, jedem Grashalm, jedem Pilz und jedem Kleintier, der oder das am Wegesrande sichtbar wird, aus- und abschweifende Exkurse zu widmen („essbar“ – „heilend“ – „kleidsam“). Kein Wunder, dass es gar nicht mehr vorwärtsgeht, als unser Paar auf Menschen trifft. Die Mamutoi oder Mammut-Jäger des Löwenlagers pirschen den großen Urzeit-Elefanten hinterher. Ayla ist angetan von diesem Stamm, und diese Zuneigung wird erwidert: Der schwarzhäutige Ranec ist‘s, der hier der blonden Fremden nachzusteigen beginnt. Für den armen Jondalar brechen harte Zeiten an, denn der Rivale ist fast so ein guter Frauenversteher wie er, sodass Ayla über 800 Seiten hin- und hergerissen wird, bevor man wieder zusammenfindet und die Reise nach Frankreich fortsetzt. („The Mammoth Hunters“, 1985; dt. „Mammutjäger”)
Die nächsten Tage und Wochen verbringen Ayla und Jondalar damit, ihre angeschlagene Beziehung wieder zu kitten. Spannungen, die trotz wertvoller & endloser Frau-Mann-Gespräche zurückbleiben, werden vorzeitlich unbekümmert in den Feuern der „Wonne“ verbrannt. Nachdem man sich so die Donau-Auen hinaufdiskutiert und -gebumst sowie zwischenzeitlich hustende Neandertaler oder bauchwehkranke Cro-Magnon-Genossen mit selbstgebrauter, ökologisch einwandfreier Medizin kuriert hat, wird es noch einmal dramatisch: Amazonen (!) verschleppen Jondalar in ihr Lotterlager, wo er für kräftige Nachkommen sorgen soll. Die kluge Ayla kann ihn vor diesem schrecklichen Schicksal retten, und man setzt die Reise auf die oben beschriebene Weise fort. Dann gilt es noch einen Gletscher zu überwinden, und im Finale ist das Ziel zum Greifen nahe. („The Plans of Passage“, 1990; dt. “Ayla und das Tal der Großen Mutter“)
Das geschieht dieses Mal:
Home at last! Zwölf reale Jahre nach Beginn ihrer ausgedehnten Lust- und Studienreise erreichen Ayla und Jondalar endlich die Dordogne und die Zelandonii der Neunten Höhle. Der Empfang ist allerdings nur partiell herzlich, denn die freigeistige Ayla eckt wieder einmal an. Das geht schnell in dieser höchst komplexen, von schier unendlich vielen, bekannten und ungeschriebenen Regeln, Protokollen und Kodizes bestimmten Gemeinschaft, die selbst das englische Könighaus vor Neid erblassen ließe. Ayla kann Tiere zähmen und Feuer mit Hilfe von Steinen entfachen: Talente, die von den Priesterinnen des Clans mit Misstrauen und Konkurrenzängsten zur Kenntnis genommen werden.
Aber Ayla spuckt grazil in die Hände und beginnt beherzt, ein weiteres Land unserer Ahnen im Sturm zu erobern. Mit gnadenloser Freundlichkeit und Herzenswärme sucht Mrs. Supertüchtig Höhle um Höhle heim, heilt alles Sieche nieder, beschämt dumme, geile Kerle und gewinnt die Herzen der weisen Frauen. Schließlich stürmt sie sogar die letzte Klippe, auf der lange unbezwingbar Marthona hockte, die gestrenge Schwiegermutter, der nicht gefällt, was Sohn Jondalar da aus fernen Landen in Höhle Nr. Neun geschleppt hat.
Doch von ebendiesem Jondalar empfing Ayla in einem wahren Pandämonium der Liebe, des Glücks und des geschriebenen Kitsches inzwischen ein Kind, das nach knapp tausendseitiger Schwangerschaft endlich das Licht der Welt erblickt und im bereits angedrohten sechsten Teil der „Erdenkinder“-Saga mit seinen Eltern, Freunden und Feinden sicherlich noch viele gute Zeiten, schlechte Zeiten durchleben und durchleiden wird.
„The same procedure as every year”
Da ist sie also wieder – die blonde Ayla, Schamanin, Super-Mom, Klassefrau & Mutter Theresa der Steinzeit. Dabei schien endlich Ruhe zu sein im Steinzeit-Karton, als sich Ayla und Jondalar in Band 4 zwölf Real-Jahre zuvor verabschiedet hatten. Im Schlusskapitel winkten schon die Zelandonii: ein durchaus taugliches Ende für eine Saga, die sich längst in Agonie dahinschleppte. „Ayla und das Tal der Großen Mutter“ war eine Zumutung; eine geschwätzige, kitschige Seifenoper im pseudo-exotischen Gewand, künstlich über jede Lesbarkeit hinaus aufgeblasen durch ausufernde Landschaftsbeschreibungen, peinliche Folkloredarbietungen und vor allem durch die zum Wahnwitz geronnene Manie der Verfasserin, ihre Leser noch über die Herstellung der letzten Haarnadel exakt ins Bild zu setzen.
Die Rekonstruktion des Steinzeit-Alltags war Jean M. Auel immer ein Herzensanliegen, zumal die Darstellung der Ergebnisse entsprechender Recherchen die Autorin einer Verpflichtung enthob, der sie mangels Talent oder Disziplin selten nachkommen konnte: Spätestens seit „Das Tal der Pferde“ erzählte Auel keine Geschichten mehr, sondern betätigte sich als Schreibautomat, bei dem nach jeweils tausend niedergeschriebenen Seiten die Batterie gewechselt wurde.
Zwölf Jahre Pause – man sollte meinen, Auel habe mehr als genug Zeit gehabt, sich endlich Neues einfallen zu lassen. Stattdessen mutet sie uns üblichen Quark zu, nur dass dieser noch ein gutes Stück breiter getreten wird. Schlimmer: „Der Stein des Feuers“ ist eine dreiste Neuauflage von „Der Clan des Bären“ – dieses Mal ohne Neandertaler.
Dass die Zelandonii stattdessen der Sprache mächtig sind, erweist sich als zusätzliches Manko: Kein Mund will stillstehen in ihren Höhlen, und was wir hören, erinnert fatal an die Endlos-Seifenopern des Fernsehens. Mag sein, dass sich die Menschen seit 30000 Jahren nicht grundsätzlich verändert haben und Intrigen, Klatsch und üble Nachrede auch den Alltag in den Höhlen der Dordogne bestimmten. Das möchte ich jedoch nicht unbedingt in epischer Breite nachlesen – und falls doch, dann bitte so, dass mir ob der unter dem Gewicht der ihnen aufgeladenen Klischees neandertalerkrumm daherkommenden Figuren, der Dämlichkeit der Dialoge oder des absoluten Leerlaufs der weitgehend durch Abwesenheit glänzenden Story nicht ständig die Tränen kommen.
In einem ist Auel allerdings konsequent: Immer wenn man glaubt, nun könne es einfach nicht schlimmer kommen, widerlegt sie dies mit Leichtigkeit. Dieses Mal lässt sie ihren Röntgenblick nicht nur über jeden Stein und jeden Strauch in und um die Zelandonii-Höhlen schweifen; wir können den Ort des langweiligen Geschehens anschließend quasi aufzeichnen. Zusätzlich wird ausführlich wiederholt, was in den vorangegangenen vier Bänden der „Erdenkinder“-Saga geschehen ist. Sicherlich muss die lange Pause nach Teil 4 irgendwie überbrückt werden. Wieso dies nicht in einer Zusammenfassung vor dem Einsetzen der eigentlichen Handlung geschehen konnte, bleibt rätselhaft. Stattdessen nerven Ayla und Jondalar die Leser, die ohnehin die Vorgängerbände kennen, mit uferlosen „Weißt-Du-noch?“-Histörchen.
Wenn der Höhlensegen schiefhängt
Unterhaltungsfeindlich sind darüber hinaus Auels ebenso hartnäckige wie vergebliche Versuche, neben der Alltags- auch die Geisteswelt der Steinzeit zum Leben zu erwecken. Historiker und Archäologen kennen eine scherzhafte Faustregel, nach der jeder Fund, der sich nicht anderweitig deuten lässt, dem Kultisch-Religiösen zuzuordnen ist. Gleichzeitig wird sich jeder Wissenschaftler, der diese Bezeichnung verdient, heftig hüten, Aussagen über Kult und Riten lange versunkener Kulturen zu treffen, die über Theorien hinausgehen.
Auel hat als Schriftstellerin freie Bahn, und diese Chance nutzt sie: nur leider nicht besonders einfallsreich. Ihre Geisterwelt wird von allerlei Muttergottheiten bevölkert, die im Einklang mit der Natur (und Gott ist für Auel definitiv eine Frau) schwingen und stets wissen, was am besten ist für Mensch und Tier. Hinter der Dunstwolke aufwändig geschilderter (und breit ausgewalzter) Zeremonien treten allerdings keine kosmischen Wahrheiten, sondern hausbackene Binsenweisheiten zutage: Vertragt euch; hört auf eure Mütter/Frauen/Priesterinnen; seid nett zu Kindern, Tieren und Neandertalern.
Wenn‘s dann trotzdem nicht klappt mit Friede, Freude & Eierkuchen, tragen ganz gewiss die nicht unbedingt bösen, sondern eher ignoranten und nie ganz erwachsenen (oder zurechnungsfähigen) Männer die Schuld: Die „Ayla“-Saga startete 1980 und ist in gewisser Weise selbst inzwischen zur historischen Quelle geworden: als (allerdings vielfach gebrochenes und trivialisiertes) Spiegelbild einer feministischen Weltsicht, wie sie einst en vogue war. „Die Vernichtung der weisen Frauen“ hieß ein typischer Sachbuch-Bestseller dieser Zeit, der die europäischen Hexenverfolgungen des 13. bis 18. Jahrhunderts als Verschwörung missgünstiger und um ihre Macht fürchtender Patriarchen gegen ein Netzwerk starker, kluger, heilkundiger, vor allem aber selbstständiger Frauen deutete. Diese Theorie hat sich inzwischen erledigt, und der Feminismus hat sich weiterentwickelt
Zurück blieb Ayla, die weiterhin die Fackel hochhalten muss, die Auels Leser/innen ins matriarchalische Utopia leiten soll, wie es in den 1970er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts beschworen wurde. Immerhin: Hübsch anzuschauen durfte Ayla trotzdem immer sein; so weit ging Auels schwesterliche Solidarität doch nicht, ihrem Publikum eine vierschrötige Höhlen-Walküre als realistische Heldin zu präsentieren. Den Rest erledigt popularisiertes New Age-Gewaber US-amerikanischer Prägung. Was sich in den Höhlen der Zelandonii abspielt, erinnert stets verdächtig an die Zeremonien, die sich die Medizinmänner (oder hier besser -frauen, die es ja auch gegeben hat) diverser Indianerstämme in der Vergangenheit ausgedacht haben. Erst hat man die nordamerikanischen Ureinwohner für Hollywood vom Pferd geschossen, nun werden sie von zivilisationsmüden Heilssuchern verkitscht, die sich aus dem reichen Mythengut herauspicken, was den Weg ins Nirvana angeblich abkürzt und dabei auch noch spannend unterhält.
Der Fluch des Erfolgs
Aber kann ausschließlich Jean M. Auel verantwortlich für das „Ayla“-Elend gemacht werden, das über die lesende Welt kommt? Die Verfasserin steht in einer langen, langen Reihe von Autoren, die eine Schnulze durch eine exotische Kulisse aufwerteten. Vor vielen Jahren gab Auel ihr Bestes als hoffnungsvolle Neu-Autorin und traf mit einem im Rückblick allenfalls mittelmäßigen aber durchaus lesenswerten Werk den Geschmack eines Publikums, das zu diesem Zeitpunkt auf „Ayla und der Clan des Bären“ gewartet zu haben schien. Binnen eines Monats ging dieser Titel mehr als 100000 Mal über die Ladentische. Ein Star war geboren, einem Stephen King oder einer Joanne K. Rowling durchaus vergleichbar – auch finanziell: 34 Millionen verkaufte Exemplare später kassierte Auel als Vorschuss (!) für die Ayla-Romane 4 bis 6 25 Mio. Dollar; nicht schlecht für eine Hobby-Autorin, die erst im Alter von 42 Jahren zum Schreibtisch fand.
Das Honorar ist wohl der eigentliche Schlüssel zu Aylas Wiedergängertum: 2002 spürte Auel nach zwölf aylalosen Jahren offenbar den Druck ihrer Geldgeber, endlich den versprochenen Nachfolgeband zu liefern. Diese Theorie würde das traurige Ergebnis jedenfalls erklären. Der Verlag bekam, was er wollte: kein Buch, das man einen Roman nennen dürfte, aber einen dicken Stapel beschriebenen Papiers, das sich unter dem eingeführten Markenzeichen „Auel“ als „Ayla V.“ prächtig vermarkten lassen würde.
Lesen würden diesen Schinken alle Ayla-Fans, aber kaufen sollten ihn noch viele, viele weitere Menschen. Die Strategie ist bekannt: Hinter dem multimedial begleiteten „Event“ kann der Anlass ruhig verschwindet. So wurde die Buchpremiere von „Ayla und der Stein des Feuers“ 2002 in Les Eyzies im Herzen Frankreichs als gigantisches Pressespektakel inszeniert. Hier lebten, liebten und litten einst Auels Hollywood-Cro-Magnons. Über 150 Journalisten fielen ein, um die Starautorin zu treffen. Diese erzählte die stets gern gehörten Geschichten ihrer Recherche-Touren, die sie nicht nur auf Aylas und Jondalars Spuren durch Russland, die Ukraine, Tschechien, Ungarn, Österreich, Deutschland und Frankreich führte, sondern die pflichtbewusste Autorin auch dazu animierten, Tiere in Fallen zu fangen, Steinwerkzeuge zu basteln, Matten zu knüpfen und natürlich Archäologen, Anthropologen oder Biologen zu befragen.
Elend mit Epilog
Das Buch hatten diese und andere Steigbügelhalter wohl nie gelesen, es war nicht erforderlich, da Veranstaltungen wie die in Les Eyzies ihren eigentlichen Zweck glänzend erfüllten. Die Schlagzeilen ebneten „Ayla V.“ den Weg zu neuerlichem Bestseller-Ruhm und Rekord-Auflagen. In Deutschland ging trotzdem lieber kein Risiko ein. Noch bevor sich womöglich jene Spielverderber zu Worte meldeten, die „Ayla und der Stein des Feuers“ tatsächlich lesen & für mies befinden würden, ließ man das Werk in einer Hauruck-Aktion von zwei simultan arbeitenden Übersetzern in unsere Muttersprache. Das Risiko war allerdings kalkulierbar gering: „Ayla V.“ wurde von 34 Verlagshäusern weltweit gleichzeitig in die Buchhandlungen gepresst!
Diese Prozedur wiederholte sich mit „Ayla VI.“ und wurde durch das Internet ergänzt. Abermals hatte Auel sich viele Jahre Zeit gelassen. „Ayla und das Lied der Höhlen“ wurde 2011 zum Offenbarungseid einer sichtlich ausgeschriebenen, kranken, alternden Autorin, die endlich zu Ende bringen wollte, wozu sie sich verpflichtet hatte. Selbst Hardcore-Auel-Fans konnten und wollten ihren Unmut über ein ‚Buch‘ nicht unterdrücken, das die bekannte Ayla-Rezeptur noch einmal aufkochte und dabei endgültig in Esoterik-Schwurbel versandete.
Seltsamerweise hielten sich Kino und Fernsehen bisher zurück mit der Verfilmung von Auel-Abenteuern. Zwar gibt es „Ayla und der Clan des Bären“ von 1985, ein unfreiwillig komisches B-Movie, in dem unsere Heldin durch Daryl Hannah zumindest optisch kongenial verkörpert wurde. Aber vielleicht sind wenigstens dieses Mal die oft und gern geschmähten Medienspezialisten die Klügerin, weil sie erkennen, dass sich aus einem 1000-seitigen Roman manchmal höchstens das Drehbuch für einen 30-Minuten-Kurzfilm destillieren lässt.
Zur Serie gibt es u. a. diese Website.
Taschenbuch: 984 Seiten
Originaltitel: The Shelter of Fire (New York : Crown Publishing Group 2002)
Übersetzung: Maja Ueberle-Pfaff u. Christoph Trunk
http://www.randomhouse.de/heyne
eBook: 1494 KB
ISBN-13: 978-3-641-07921-5
http://www.randomhouse.de/heyne
Hörbuch-Download: 2064 min. (ungekürzt, gelesen von Hildegard Meier)
ISBN-13: 978-3-8371-1091-3
http://www.randomhouse.de/randomhouseaudio/
Der Autor vergibt: 




You Higuri – Gorgeous Carat – Der Reiz der Finsternis (1)
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist in Paris nichts mehr so, wie es einmal war. Der Glanz der vergangenen Tage ist längst verschwunden, und vor allem die Adelshäuser müssen naturgemäß unter dem Fall der Aristokratie leiden. Von diesem Schicksal ist auch die ehemals wohlhabende und einflussreiche Familie Rochefort geplagt. Die Madame besteht aber dennoch darauf, den bekannten Lebensstatus und den damit verbundenen Luxus beizubehalten und ist nicht bereit, das wohlbehütete Familienjuwel herauszugeben, um durch den Verkauf wieder an Geld zu kommen. Ebenso verneint sie den Wunsch ihres Sohnes, der wie ein Mann aus der bürgerlichen Gesellschaft arbeiten möchte.
Auf einem Fest im eigenen Hause des Adelsgeschlechts taucht eines Tages der berüchtigte Pfandleiher Ray Balzac Courlande auf und bietet Madame Rochefort einen recht zweifelhaften Tausch an: einen Kredit gegen ihren Sohn Floréan. Und obwohl sie sich gegen diesen Gedanken wehrt, hat sie am Ende doch keine Chance, denn als Alternative zu Floréan akzeptiert er nur noch den Familienschatz, „Die Flamme von Mougale“, ein 120-Karat-Juwel, das die Dame auf keinen Fall herausgeben möchte.
Der Graf Courlande nimmt Floréan schließlich mit und versucht aus ihm den Aufeinthaltsort des Diamanten herauszupressen. Kurze Zeit später wird Floréans Mutter nach einem Anschlag auf ihr Haus tot aufgefunden; weil auch das Schmuckstück verschwunden ist, gibt man dem abwesenden Sohn die Schuld. Maurice, sein Onkel, versteckt ihn in seinem Haus, doch schon bald wird klar, dass er ganz andere Absichten verfolgt. Aber auch sein neuer Herr gibt ihm zunehmend Rätsel auf; der stolze Ray verbirgt einige mysteriöse Geheimnisse, treibt sich mit seltsamen Leuten herum und hat nur eines im Sinn: den jungen Floréan ganz und gar zu besitzen.
Mein Eindruck
You Higuri genießt in Insiderkreisen einen sehr guten Ruf, den sie auch mit dem Beginn ihrer aktuellen Reihe „Gorgeous Carat“ bestätigen kann. Die Geschichte aus dem Frankreich des späten 19. Jahrhunderts ist zwar im Prinzip sehr simpel aufgebaut, besticht aber durch eine kluge Inszenierung, die auch an Wendepunkten nicht geizt. Faszinierend dargestellt ist dabei die Figur das Grafen Courlande. Der Mann ist ein einziges Mysterium, dessen Motive zwar ansatzweise erkennbar, aber dennoch nicht ganz klar sind.
Hugori lässt den Leser noch im Dunkeln, ob Ray nun die gute oder doch die böse Seite charakterisiert – für beide Seiten gibt es Anhaltspunkte, aber keine klaren Indizien. Eindeutig ist letztlich nur sein Interesse an Floréan, desen Beziehung zu Courlande nach der anfänglichen Folterung durch seinen neuen Herren stetig besser wird, weshalb er sich nach einiger Zeit auch ein wenig heimisch fühlt.
Floréan entwickelt sich hingegen im Laufe der Geschichte immer mehr aus der Opferrolle heraus und gewinnt auch zunehmend an Selbstbewusstsein. Er hat eine Ahnung vom speziellen Interesse Courlandes, und dies spielt er dann auch im Auftreten gegenüber seinem Besitzer aus. Andererseits steht Floréan aber auch für Ray ein und entwickelt eine innere Verbundenheit, deren Ausmaße sich zum Ende des Buches zeigen.
Eine zunächst noch unscheinbare Rolle spielt die dunkelhäutige Laila, die sehr großes Interesse an Ray hat und in Floréan einen Widersacher sieht, der ihr auch die letzte noch vorhandene Aufmerksamkeit des mysteriösen Grafen nimmt. Bei Floréans Abwesenheit erkennt sie schließlich ihre Chance, um Ray ihre Zuneigung zu zeigen.
Der vierteilige Band ist in einzelne Sub-Plots unterteilt, die jedoch allesamt aufeinander aufbauen und jedes Mal ein wenig mehr über die Hauptfiguren preisgeben.
Die düstere Atmosphäre, die sich dabei durch die Geschichte zaubert, ist allerdings auch ziemlich atemberaubend. Angefangen bei der erhabenen Erscheinung von Ray Balzac Courlande über die verschiedenen Verschwörungen und Verstrickungen, zu denen die Autorin hier noch nicht allzu viel verrät, bis hin zu den insgesamt auch sehr dunklen Zeichnungen ergibt sich bei „Gorgeous Carat“ ein fast schon beklemmendes Bild, das durch die kühle Art der Hauptfigur Courlande noch einmal verstärkt wird.
Und obwohl der Plot jetzt nicht sonderlich komplex erscheint, so verbirgt sich doch ein gewisser Anspruch hinter diesem ersten Band, dessen Tiefgang sich jedoch erst mit dem Ende so richtig zeigt und der in uns schließlich auch das Verlangen auslöst, mehr über den mysteriösen Dieb Noir, Floréan, Laila und natürlich den Grafen Courlande in Erfahrung zu bringen.
Bis dahin bleibt eigentlich nur zu sagen, dass die Autorin ihrem fabelhaften Ruf wieder einmal gerecht geworden ist und „Gorgeous Carat“ eine weitere vielversprechende Serie zu werden scheint.
Williams, Tad – Shadowmarch: Die Grenze
Es schien wie in einem vergessenen Zeitalter, dass die Wesen jenseits des undurchdringlichen Nebels sich regten und die Lande der Menschen mit Krieg überzogen. Doch der Konflikt hatte nur ausgesetzt. Noch immer forderten die Elben die Gebiete zurück, die ihnen vor langer Zeit an die Menschen verloren gingen. Sie hatten sich nur hinter ihren Zauberwall aus Nebelschwaden und grausamen Illusionen zurückgezogen, um nun das zu beanspruchen, was in ihren Augen schon immer ihnen gehörte.
Die Menschen und auch die Funderlinge in der Südmark haben dabei ihre eigenen Probleme. Ihr Herrscher ist einer Hinterlist zum Opfer gefallen und wird gegen Lösegeld vom Lordprotektor von Hierosol festgehalten. Immer abenteuerlicher werden die Forderungen. Schließlich wagt es der Entführer, die Hand der Fürstentochter zu beanspruchen. Briony Eddon ist davon wenig begeistert und auch ihr Zwillingsbruder hält nicht viel davon. Doch was sind die Überlegungen von Kendrick, der als Stellvertreter seines Vaters über die Mark wacht? Die verschiedenen Berater, Vasallen und Verbündeten bedrängen den jungen Mann. Doch bevor er seine Überlegungen kundtun kann, wird er grausam ermordet. Ausgerechnet der Schwertmeister soll der Attentäter gewesen sein.
Schlimmer könnte es kaum kommen. Die Feinde vor den Toren der Stadt, die Intrigen im Reich und zwei junge Menschen, die sich den Thron und die schwere Bürde teilen müssen, den unmöglichen Aufgaben gerecht zu werden. Doch es |kommt| noch schlimmer.
Die Geschichte der Schattenmark beschäftigt sich nicht nur mit den Erlebnissen der Herrschenden, sondern bezieht eine Vielzahl von Figuren mit ein, deren Schicksal direkt, indirekt oder scheinbar gar nicht mit dem des Landes verbunden ist. Die Rollen der Protagonisten reichen von dem zwergenähnlichen Funderling Chert Blauquarz bis hin zu Qinnitan, der hundertsten Frau des mächtigen Herrschers des Reiches Xand.
Tad Williams begnügt sich nicht damit, die Geschichte einiger weniger Persönlichkeiten und ihres Landes zu erzählen, er zeichnet das Schicksal einer ganzen Welt in seiner neuen Serie. Der vorliegende erste Band ist nur der Anfang, aber ein ereignis- und umfangreicher.
Irritiert mag der geübte Fantasyleser von den „neu“ erfundenen Spezies sein, die doch so sehr dem typischen Zwerg oder dem typischen Dunkelelf oder sonst einer bekannten Fantasyspezies ähneln. Natürlich leben die Pseudozwerge unter der Erde, natürlich haben sie Steine lieb und auch das Gold und sind auch nicht besonders groß. Aber sie Zwerge zu nennen – so das Buch – wäre eine infame Beleidigung. Nach kurzem Nachdenken und einem amüsierten Kopfschütteln gewöhnt man sich daran, die Zwerge halt jetzt Funderlinge zu nennen.
Die Schilderung der Protagonisten ist dem Autor nur bedingt gelungen. Die psychischen Probleme des albtraumgeplagten Barrick kommen genauso wie die emanzipatorischen Wünsche von Briony nur hölzern und klischeehaft herüber. Das mag daran liegen, dass Williams einen strengen und regelmäßigen Wechsel zwischen den Handlungssträngen und Protagonisten durchzieht und gleichzeitig einen hohe Geschwindigkeit der Handlung vorantreibt. Da bleibt scheinbar wenig Raum für die glaubhafte und überzeugende Darstellung des Innenlebens der handelnden Personen.
Tad Williams ist, wie vorauszusehen war, ein sehr gutes, unterhaltsames und spannendes Buch gelungen. Doch stellt es inhaltlich und auch vom Stil her keine Besonderheit dar. Es ist ein gutes Fantasybuch geworden, das es in der Qualität und dem Einfallsreichtum vielfach auf dem Literaturmarkt gibt. Die Erwartungen an den Autor nach der grandiosen „Otherland“-Serie haben sich nur zum Teil erfüllt. Trotzdem kann man jedem Fantasyfan das Buch und vermutlich auch die Folgebände anraten, denn in Hinsicht auf gut lesbare Unterhaltung und Spannung bekommt man hier garantiertes Lesevergnügen geboten.
© _Jens Peter Kleinau_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.X-Zine.de/ veröffentlicht.|
http://www.shadowmarch.de
Ankowitsch, Christian – Dr. Ankowitschs kleines Universal-Handbuch
Nach dem „kleinen Konversations-Lexikon“ hat Christian Ankowitsch alias Dr. Ankowitsch nun einen weiteren Ratgeber herausgebracht, der einem wohl selbst in den prekärsten Lebenslagen aus der Patsche hilft. In „Dr. Ankowitschs kleines Universal-Handbuch“ hilft der Autor dem Leser selbst in den Situationen weiter, die einem im Normalfall ein Rätsel aufgeben würden.
Ein Beispiel: Man sitzt als Nicht-Mediziner mit weit geöffnetem Mund auf dem Folterstuhl beim Zahnarzt, und dieser gibt seiner Kollegin eine Reihe von Zahlen durch, die wohl für Zähne stehen. Die ganze Zeit fragt man sich, wovon genau der Mann da eigentlich erzählt, und in diesem Buch findet man nun endlich die Antwort.
Nächstes Beispiel: Man reist ohne Reiseführer in die entlegendste Republik und muss am Flughafen mal die Örtlichkeiten aufsuchen. Doch welche Aufschrift muss nun das Türschild haben, hinter dem sich die Stelle, an der man seine Notdurft verrichten darf, verbirgt? Dr. Ankowitsch hilft uns hier weiter.
Für den Online-Redakteur enorm wichtig: Wie führe ich ein Interview? Wie steige ich ins Gespräch ein, wo setze ich Schwerpunkte, wie nehme ich mir die Nervosität, wenn ein verehrter Künstler mit seinem Anruf droht? Nun, ich danke Ihnen, Herr Ankowitsch, erst vorgestern Abend hat ihr Ratgeber diesbezüglich die Bewährungsprobe bestanden.
Nächstes Szenario: Bundeswehr, man ist gerade aus Mamis Obhut entflohen und soll nun seine Hemden bügeln, damit der Kommandant einen nicht die Räumlichkeiten mit der Zahnbürste schrubben lässt. Aber wie falte und bügele ich jetzt ein Hemd richtig? Nun, es steht auf Seite 94 …
Man geht ins Edel-Restaurant, rundherum liegen zahlreiche Gabeln, und weil man sich an die Förmlichkeiten halten möchte, braucht man wohl irgendwie auch Unterstützung, um zu wissen, welche Gabel nun welchem Verwendungszweck zugeführt werden soll. Gut, wenn man dieses rote Büchlein mit sich führt.
SPAM allerorts, man verliert die Kontrolle über den Posteingang und hat absolut keinen Durchblick mehr. Was nun? Tja, auch hierauf hat Dr. Ankowitsch die passende Antwort.
„Dr. Ankowitschs kleines Universal-Handbuch“ ist ein echtes Schmuckstück und tatsächlich universell einsetzbar. Wegen seiner optimalen Größe kann der feine Ratgeber außerdem immer in der Jackentasche mitgeführt und im Problemfall ausgepackt werden. Man gerät also nie ins Schwitzen …
Aber mal im Ernst: Dieser Ratgeber enthält alles, was man von einem ebensolchen Buch erwartet: eine gesunde Prise Humor, umfangreiche Unterhaltung, nützliche Infos bis zum Abwinken und einen sehr strukturierten, übersichtlichen Aufbau. Die Idee scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich revolutionär zu sein, doch sobald man erst einmal in die logisch aufgebaute Welt des Christian Ankowitsch eingetaucht ist, wird man schnell bemerken, dass man etwas Vergleichbares noch nie zuvor vor die Lesebrille bekommen hat. Einzigartig, witzig und enorm hilfreich ist er, dieser Ratgeber, und wer noch ein richtig originelles Weihnachtsgeschenk sucht, landet hier einen Volltreffer – und bekommt eine umfassende Ansammlung von Argumenten, die dabei helfen, sein Gegenüber von der Richtigkeit des eigenen Handelns zu überzeugen …
Roberts, Nora – Dunkle Herzen
Die junge, erfolgreiche Bildhauerin Clare Kimball lebt in New York, wo sie gerade wieder eine erfolgreiche Ausstellung präsentiert hat. Seit ihrer Kindheit wird Clare von einem immer wiederkehrenden Albtraum gequält. In diesem düsteren Traum steht sie auf einem nächtlichen Friedhof und beobachtet, wie mit Tierköpfen und Kutten verkleidetete Männer satanische Rituale durchführen. In einem der Männer erkennt sie schließlich ihren geliebter Vater, der in ihrer Teenagerzeit durch einen Fenstersturz ums Leben kam. Sowohl der Albtraum als auch der ungeklärte Tod ihres Vaters lassen ihr keine Ruhe. Clare will Gewissheit haben und beschließt, in ihre Heimatstadt Emmitsboro zurückzukehren.
Emmistboro ist eine verschlafenen Kleinstadt in Maryland ohne spektakuläre Ereignisse, in denen sich alle Bürger untereinander gut kennen. Clares Rückkehr sorgt bei den Einwohnern für großes Interesse. Vor allem für den charmanten Sheriff Cam Rafferty, den sie noch aus ihren Jugendtagen kennt, entwickelt sie rasch Gefühle. Während sie viele ehemalige Freunde und Nachbran herzlich aufnehmen, machen sich einige der Bewohner über ihr Auftauchen Sorgen. Denn was Clare nicht weiß: Hinter der biederen Kleinstadt-Fassade verbirgt sich ein satanischer Zirkel, in den zahlreiche der scheinbar unbescholtenen Bürger verstrickt sind.
Kurze Zeit nach Clares Einzug in ihr Elternhaus geschieht ein grausamer Mord, der die Menschen jäh aus ihrer Idylle reißt. Grabschändungen, geschlachtete Tiere und ein entführtes Mädchen deuten darauf hin, dass Clares Träume der Wirklichkeit entsprechen. Je mehr sie sich an das Gesehene erinnert und je weiter sie in ihren Nachforschungen vordringt, desto gefährlicher wird sie für die Teufelssekte …
Schwarze Messen, brutale Morde und eine Gemeinschaft, die sich dem Bösen verschworen hat – die als Schnulzenautorin verschriene Nora Roberts geizt nicht mit allerleih grausigen Zutaten für ihren Horrococktail, der durchaus zu unterhalten weiß.
Dabei kann von Innovation an kaum einer Stelle des Romans die Rede sein. Die Charaktere sind teilweise klischeehaft und in keiner Weise wirklich spektakulär, jeder Figur ist man so oder so ähnlich schon in anderen Büchern begegnet. Die satanischen Rituale folgen exakt den landläufigen Vorstellungen der Leser und auch überraschende Wendungen sind im Grunde Mangelware. Dass der Roman trotzdem zu fesseln weiß, liegt an der souveränen Zusammenstellung all dieser Komponenten, die dem Leser zwar nichts Neues, aber Altbewährtes auf solide zubereitete Weise präsentieren.
|Altbewährter Schauplatz|
Die verschlafene Kleinstadt wird bekannterweise gerne als Schauplatz für ein Horrorszenario gewählt. Nirgends wirkt das Grauen so effektiv wie in einer scheinbar harmlosen Idylle, deren Friedlichkeit sich als trügerisch erweist. Je beschaulicher der Leser sein eigenes Leben führt, desto mehr wird er sich in diese Lage hineinversetzen und dementsprechend mitfiebern können. Auch Emmitsboro entspricht in jeder Hinsicht den gängigen Kleinstadt-Klischees. Die Menschen kennen sich untereinander gut, alles geht seit Jahrzehnten seinen gewohnten Gang, die Polizei kümmert sich größtensteils um Diebstähle und Ruhestörungen. Besonders prekär wird die Lage dadurch, dass Clare die meisten Bewohner seit ihrer Kindheit kennt und es besonders schmerzhaft ist, auf einmal befürchten zu müssen, dass einige unter ihnen schon damals ihre dunklen Machenschaften trieben und über all die Jahre eine Scheinwelt aufrecht gehalten haben. Das betrifft letztlich und vor allem ihren eigenen Vater. Je mehr Clare über den satanischen Zirkel und seine Anhänger herausfindet, desto offensichtlicher wird die quälende Tatsache, dass auch ihr Vater zumindest zeitweise darin verwickelt war. Für Clare, die immer seine Lieblingstochter war und die immer noch unter seinem frühen Tod leidet, bricht eine Welt zusammen. Doch als sie der Wahrheit zu nahe kommt, steht ihr der größte Kampf noch bevor …
In einem Psychothriller über Satanismus bleiben natürlich auch explizite Gewaltszenen nicht aus. Allerdings ist keine Schilderung so brutal, dass man als Leser Ekelgefühle befürchten müsste. Im Gegenteil existieren sogar Szenen, in denen die Gewalt nur angedeutet wird und hauptsächlich in der Vorstellung der Leser stattfinden muss. Beinahe schon etwas zu bieder geraten sind die Darstellungen der satanischen Rituale, die in keinem Punkt von den althergebrachten Vorstellungen abweichen, die der unbedarfte Leser vor der Lektüre besitzt. Die Jünger tragen schwarze Kutten und verbergen ihre Gesichter hinter Masken, frönen perversen Ausschweifungen, bringen Tier- und Menschenopfer und rufen in lithurgisch inszenierten Huldigungen Satan an. Sicher wären an der Stelle Abwandlungen der Klischees reizvoller gewesen, zumal gerade das Unbekannte und schwer Einschätzbare den Horroreffekt steigert.
|Schablonenartige Charaktere|
Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf Clare Kimball, die auf Anhieb sympathisch erscheint. Clare hat sich trotz ihrer knapp dreißig Jahre ein kindliches Gemüt bewahrt. Gleich zu Beginn erfährt man, dass Clare, wie es für eine Künstlerin typisch ist, stets im kreativen Chaos lebt. Die Haare werden achtlos zusammengebunden, ein ausgeleiertes Shirt erfüllt den Kleidungszweck, eine Großpackung Eis muss als Mittagessen vorhalten. So ergibt sich ein liebenswertes Bild: Auf der einen Seite die intelligente, erfolgreiche und selbstständige Künstlerin, auf der anderen Seite die chaotische und undisziplinierte Lebensart eines Kindes. Mit ihrer unverfälschten Art und ihrem ansteckenden Humor bezaubert sie nicht nur ihre Umwelt, sondern auch ihre Leserschaft. Sowohl Frauen als auch Männer werden diese gelungene Mischung aus Verletzlichkeit und Sensibilität mit Mut und scharfem Verstand zu schätzen wissen.
Sheriff Cam Rafferty präsentiert sich als der ideale Mann für Clare. Genau wie sie schätzt er Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, hält nichts von überflüssigen Etiketten, folgt seinem Gefühl und verstößt bereitwillig gegen den guten Ton der Gesellschaft. In jungen Jahren ein wilder Rebell, hat er sich auch als Polizeibeamter seine Polarität bewahrt. Während die einen Bewohner seine Aufrichtigkeit schätzen, ist er vor allem der biederen Gesellschaft ein Dorn im Auge.
Die meisten anderen Bewohner der Stadt erscheinen als bestenfalls einfache und schlimmstenfalls kleinkarierte Bürger mit beschränktem Horizont, von denen ein nicht unerheblicher Teil im Geheimen dem satanischen Zirkel angehört. Es sind typische Kleinstadt-Charaktere, wie man sie schon aus vielen anderen Romanen kennt: der langweilige Oberlehrer; die hübsche, handfeste Kellnerin; die Edelnutte, die vom Ausstieg und der weiten Welt träumt; die geistig zurückgebliebene Pennerin mit dem kindlichen Herzen; die hemdsärmeligen Farmer; die spitzzüngigen Damen der Kaffeeklatschgesellschaft.
Für diese Vorhersehbarkeit der Charaktere gibt es kleine Abzüge. Fast bei jedem neuen Charakter wird der Leser rasch über dessen Eigenschaften informiert, so dass man jede Figur sofort auf die „gute“ oder die „böse“ Seite stellen kann. Dabei fühlt man sich ein wenig bevormundet, als ob es uns der Autor nicht zutraute, ohne explizite Beschreibung den Charakter einzuschätzen. Und zum anderen hätte es die Spannung noch zusätzlich gesteigert, wenn man bei einigen Figuren zunächst im Ungewissen gelassen worden wäre. Stattdessen weiß man bei den meisten Personen sofort, ob Clare ihnen vertrauen darf oder nicht. Vor allem bei Sheriff Rafferty existiert bereits nach der ersten Begegnung mit Clare kein Zweifel mehr, dass sich zwischen beiden eine Beziehung entwickeln wird; erst recht nicht, als man erfährt, dass Clare ihn bereits in ihrer Jugend heimlich umschwärmte. Bei manchen der Satansjünger erfährt der Leser erst spät von ihrem Doppelleben, doch echte Überraschungen bleiben dabei vollends auf der Strecke. Das gilt auch für den Epilog des Romans, der beim Leser nicht den angestrebten Aha-Effekt erzielt, sondern wie eine nachträglich angefügte Pointe wirkt.
Die einzige Ausnahme bildet der rebellische Teenager Ernie, von dem man lange Zeit nicht mit Sicherheit sagen kann, ob er sich unwiderruflich der dunklen Seite verschreibt oder nicht. Davon abgesehen wäre es besonders bei Cam Rafferty der Spannung zuträglich gewesen, wenn man hin und wieder an seiner Solidarität an Claire hätte zweifeln können.
|Flotter Schreibstil|
Das Stilniveau geht zwar über den des Groschenromans hinaus, stellt aber dennoch keinerlei weitere Anforderungen an den Leser. Die klare Sprache und die übersichtlichen Sätze machen es zu einer Leichtigkeit, den mehr als 600 Seiten des Buches mühelos zu folgen. Wegen der weiblichen Hauptfigur und des Images der Autorin als Liebesromanschreiberin zieht das Buch vornehmlich Frauen als Leserinnen an, eignet sich aber grundsätzlich auch für Männer, ebenso wie für Jugendliche. Die Handlung verzichtet auf detaillierte Nebenstränge, so dass keine große Konzentration von Nöten ist. Als Urlaubslektüre oder als unterhaltsamer Zwischendurch-Roman ist das Buch daher definitiv zu empfehlen.
_Unterm Strich:_ Unterhaltsamer und sehr flüssig geschriebener Psychothriller über satanische Morde hinter der biederen Fassade einer Kleinstadt. Der Roman kombiniert altbewährte Zutaten zu einem angenehm lesbaren und über weite Strecken fesselnden Lesevergnügen für alle Freunde der Spannungsliteratur. Leichte Abzüge gibt es für die Vorhersehbarkeit und die klischeehaften Charaktere, denen etwas mehr Innovation nicht geschadet hätte.
_Nora Roberts_ ist eine der meistgelesenen Autorinnen der USA. Seit sie 1981 ihren ersten Roman veröffentlicht hat, sind mehr als hundert Bücher von ihr erschienen. Ihre Domäne sind vor allem romantische Liebesromane und Thriller.
Hayder, Mo – Tokio
Mo Hayder sah als Teenager ein Foto von einem japanischen Soldaten, der einen chinesischen Zivilisten enthauptet. Als sie dieses Bild Jahre später in Tokio wiederentdeckte und ihr selbst japanische Freunde nichts über das Massaker von Nanking berichten konnten, war ihr Interesse an einem Kapitel japanischer Geschichte geweckt, das bis heute von offizieller Seite mit Vorliebe verschwiegen wird. („Tokio“ soll nicht in Japan erscheinen!)
Auch die Protagonistin Grey in Hayders neuem Roman „Tokio“ hat in frühen Jahren ein Foto aus Nanking gesehen und ist, gerade weil ihre Umwelt die Existenz des Fotos wie auch die historischen Kriegshandlungen leugnet, besessen von der Idee, die Wahrheit herauszufinden. Grey, die den größten Teil ihrer Jugend in einer psychiatrischen Klinik verbracht hat, ist besessen davon, ihre Zweifel und die Ungewissheit zur Gewissheit werden zu lassen.
‚Geh und Beweise es‘, hatte ihr eine Zimmergenossin aus der Klinik mit auf den Weg gegeben. Und für Grey, die nach Jahren in der Psychiatrie die eigene Persönlichkeit als kranken Psycho-Freak mit perversen Neigungen wahrnimmt, sind die historischen, totgeschwiegenen Ereignisse inzwischen ebenso wichtig wie die eigene Heilung geworden; erst wenn sie beweisen kann, dass die Gräuel von Nanking nicht ihrer kranken Fantasie entsprungen sind, sieht sie eine Chance, in das Leben zurückzukehren.
Labil und voller psychischer wie physischer Narben reist Grey nach Tokio, um einen chinesischen Wissenschaftler aufzusuchen, der im Besitz eines Filmes sein soll, in dem das Massaker von Nanking dokumentiert ist. Shi Chongming, ein einstmals freigeistiger, inzwischen desillusionierter Intellektueller, arbeitet als Gastprofessor in Tokio. Er ist Opfer und Überlebender der japanischen Kriegshandlungen, die neben dem Film, in dessen Besitz er gelangt ist, auch in seinem Tagebuch aufgezeichnet sind. Diese Niederschrift eines (Kriegs-)Tagebuchs aus Nanking führt den Leser alternierend mit der Handlung der Gegenwart in den Winter 1937, in das von Japanern besetzte Nanking.
Für jeden Wissenschaftler ist es eigentlich eine Ehre, an der Todai-Universität, der berühmtesten Universität Japans, zu forschen und zu lehren; doch Shi Chongming hat neben seiner offiziellen Verpflichtung einen weiteren, sehr persönlichen Grund für seinen Aufenthalt in Japan. Das Auftauchen der ‚verrückten Fremden‘, die die Vergangenheit aufleben lassen will und ihn in ihrer Besessenheit ‚attackiert wie eine Hornisse‘, stürzt den alten Chinesen in eine tiefe Krise.
Gray arbeitet inzwischen aus Geldnot in dem Nachtclub |Some like it hot| als Hostess. Dort lernt sie den mächtigen Yakuza-Chef Fuyuki und dessen brutale, geheimnisvolle, geschlechtlich nicht zu identifizierende Krankenschwester Ogawa kennen. Diese Bekanntschaft öffnet ihr unerwartet die Türen zum abweisenden und widerstrebenden Chinesen Shi Chongming. Plötzlich schlägt dieser Grey einen Deal vor: Er wird auf ihr Anliegen eingehen und ihr den Film zeigen, wenn sie ihm ein Elixier bringt, ein Tonikum, dem Shi Chongming schon lange auf der Spur ist und dessen Geheimnis sich in Fuyukis Besitz befinden soll.
Grey scheint indes dem mysteriös abweisenden Charme Tokios und seiner Nachtclubs zu erliegen. Und auch ihr rätselhafter Mitbewohner Jason, der ihr mit seiner Vorliebe für Scheußlichkeiten seltsam nahe zu stehen scheint, lenkt sie von ihrer ursprünglichen Absicht ab, Shi Chongmings Film um jeden Preis zu sehen. Doch dann geschehen entsetzliche Dinge und Grey begibt sich in größte Gefahr. Dabei ist sie nicht nur außerstande, die Bedrohung, die sich immer enger um sie knüpft, richtig einzuschätzen, Grey kann nicht einmal ahnen, inwieweit die Tragödie ihres eigenen Lebens mit der grausamen Vergangenheit und der brutalen Realität der Gegenwart verwoben ist!
Mit „Tokio“ verlässt Mo Hayder den Londoner Schauplatz, wo ihre beiden Bestseller „Der Vogelmann“ und „Die Behandlung“ um Detective Inspector Jack Caffery angesiedelt waren, und wendet sich einem historischen Ereignis und einer fernöstlichen Kulisse zu. „Tokio“ ist ein atemberaubend dichter Thriller, in dem die Spannung Seite um Seite steigt.
Dabei erzählt Mo Hayder eher geruhsam, mit einer poetischen Trägheit, die sie in einem perfekt abgestimmten Tempo, das sich sachte über Anspielungen, Andeutungen, Vor- und Rückgriffe im Geschehen überaus brutal an Perversionen, Morde und skrupellose Gräuel annähert. Durch diese beeindruckende Ökonomie der Information, mit der Hayder optimal kalkuliert umzugehen weiß, aber auch durch eine traumhaft märchengleiche Kulisse eines nächtlichen Tokios spitzt sich die Spannung in jeder Szene weiter zu.
Mo Hayder, die früher einmal selbst in Tokioter Nachtclubs gearbeitet hat, ist für die Recherche zu „Tokio“ zwanzig Jahre später noch einmal in die Rolle einer Hostess geschlüpft, um dem mysteriösen und brutalen Mordfall an Lucie Blackman, einer in Tokio arbeitenden englischen gaijin (Hostess), nachzuspüren. Es liegt wohl an diesen persönlichen Erfahrungen, dass das traumähnlich gezeichnete Nachtleben Tokios so real wird. Eine Welt voller authentischer Sonderlinge, die alle am Rande der Gesellschaft leben: Mama Strawberry, die Nachtclubbesitzerin, die gern wie Marilyn Monroe aussähe, Ogawa, die sadistische Krankenschwester, oder Jason, der perverse Sonderling – all diese Figuren geben „Tokio“ einen Reiz, der sich aus Sympathie und Unverständnis, Faszination und Abscheu zusammensetzt.
Mo Hayder versteht es meisterhaft, auf dem schmalen Grat zwischen Abscheulichkeit und Faszination, dem Schönen und dem durch und durch Bösen zu wandeln. Sie lotet das Böse aus, lässt sich auf alle menschlichen Schattierungen von schamlos über verdorben bis auf wirklich böse ein – und das mit einer unübersehbaren Schwäche für Freaks. So durchschreitet Mo Hayder Grenzen, bringt uns Figuren und Ereignisse näher, die sonst so brutal und unmenschlich scheinen, dass wir uns eher schaudernd von ihnen abwenden. Schuld und Unwissenheit ziehen sich leitmotivisch durch den Text, eine meines Erachtens sehr konstruktive Kategorisierung, die das Böse nicht oberflächlich zu verurteilen aber zu orten scheint.
„Tokio“ ist ein sehr grausames Buch, das sich in seiner fiktiven Authentizität auf einer teilweise surreal anmutenden, dem Stil entspringenden Schönheit und Poesie trägt. Als Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit der Geschichte ist „Tokio“, das ein breites Publikum erreichen wird, bedeutsam. Als Literatur wie auch als Thriller ist „Tokio“ in seiner naiven Unschuld wie seiner abgrundtief pervers-brutalen Abscheulichkeit einfach umwerfend und Nerven aufreibend bis zum Finale!
© _Anna Veronica Wutschel_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.X-Zine.de/ & http://www.krimizeit.de/ veröffentlicht.|
http://www.mohayder.net
Weitere Rezensionen bei |Buchwurm.info|:
[Der Vogelmann 1632
[Die Behandlung 1635
Amila, Jean – Mond über Omaha
Jean Amila (1910-1995) war nach dem bekannten Léo Malet der zweite französischsprachige Autor der legendären Série Noire. Nach seinem vielbeachteten Debüt 1942 präsentierte ihn |Gallimard| 1950 zunächst unter dem Pseudonym John Amila. Es folgte ein Spitzenkrimi nach dem anderen. „Mond über Omaha“ zeigt ihn auf dem Höhepunkt seines Könnens.
_Story_
Normandie, Juni 1944: Die Allierten landen an der französischen Küste in Omaha Beach. In einer brutalen Schlacht, in der die US-Verantwortlichen ihre Soldaten als menschliche Zielscheiben in den Krieg schicken, entscheidet sich auch das Schicksal der beiden Infanteristen Reilly und Hutchins. Während der eine mitten in der Schlacht von den verteidigenden Deutschen scheinbar tödlich getroffen wird, wendet sich Hutchins auf eigene Faust zur Flucht und gerät in einen Hinterhalt.
Zwanzig Jahre später an gleicher Stelle: Reilly hat als Einziger seiner Abteilung den Krieg überlebt und lebt zusammen mit seiner viel jüngeren Frau Claudine als Friedhofswärter in Omaha Beach. Der Sergeant erachtet es als seine Pflicht, seinen ehemaligen Kameraden bis an sein Lebensende seine Ehre zu erweisen, ganz entgegen der Vorstellung seiner Frau, der das Leben auf dem riesigen Soldatenfriedhof mittlerweile völlig gegen den Strich geht.
Eines Tages stirbt der alte Misthändler und Betrüger Delois an den Folgen einer Krankheit. Reilly konnte den Mann nie besonders leiden, doch auch nach seinem Tod verfolgt ihn sein Einfluss noch. Als nämlich die beiden Söhne Georges und Fernand, die bislang nichts voneinander wussten, am Todestag vor Ort erscheinen und sich folglich über das Erbe streiten, stellt Fernand die Existenz eines Bruders in Frage. Nach und nach wird klar, dass Georges tatsächlich kein leiblicher Sohn des alten Delois gewesen ist und sich damals eine Geburtsurkunde von ihm hat fälschen lassen, um nicht als Deserteur der Allierten vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Bei einem Besuch auf dem von Reilly geführten Friedhof entdeckt Georges das Kreuz desjenigen Mannes, der er vor knapp zwanzig Jahren mal gewesen ist und der seitdem für tot erklärt wurde – Hutchins!
Reilly, der gerade selber vom rechten Weg abgekommen ist, weil ihn seine Frau verlassen hat, erkennt den ehemaligen Kameraden auf Anhieb, klagt desen Verhalten aber nicht an. Weil sie beide vom alten Delois betrogen worden waren, tüfteln sie einen Plan aus, damit Georges das Erbe des Verstorbenen alleine antreten kann, um so das Schmiergeld, das seine Frau jahrelang gezahlt hat, wieder zurückzuerlangen. Doch je weiter die Erpressung gedeiht, desto tiefer dringt Georges alias Hutchins wieder in seine Vergangenheit ein und ist nach all der Zeit endlich bereit, seine Tarnung abzuwerfen und sich von den Fesseln der Unsicherheit zu befreien …
_Meine Meinung_
Jean Amilas Erzählung beruht in erster Linie auf Kontrasten – Kontrasten in Bezug auf die unterschiedlichen Charaktere und ihre Lebenseinstellung, aber auch Kontraste hinsichtlich der Art und Weise, wie die Beteiligten mit ihrem Schicksal umzugehen pflegen.
Am schlimmsten hat es dabei den desertierten Hutchins getroffen. Nach seiner Flucht hat er bei der jungen Janine Zuflucht gefunden, an ihrer Seite ein neues Leben angefangen, eine Familie aufgebaut und seine Vergangenheit als Veteran völlig abstreifen können. Der einzige Wermutstropfen: das Geld, das Janine seither zahlt, um Georges‘ falsche Identität zu schützen. Doch mit dem Tod von Delois bricht eine alte Routine im Leben der beiden. Janines finanzielle Obhut und damit auch ihr Einfluss auf ihren Ehemann verschwindet, und als sich für ihn die Möglichkeit ergibt, die unbewusst verborgene Pein, die ihn seit dem Krieg begleitet, zu bekämpfen, nutzt er diese Gelegenheit – ganz zum Unmut seiner Gattin, deren Rolle als Beschützerin plötzlich überflüssig wird und die auf einmal in Georges nicht mehr den liebevollen, starken Mann sieht, sondern den Verräter, der Schwäche ausstrahlt.
Der genau entgegengesetzte Fall tut sich in der Beziehung von Reilly und seiner Ehefrau Claudine auf. Reilly will sein Leben lang die Rolle des Ehrenmannes behalten und merkt dabei gar nicht, wie sehr er sich von Claudine entfremdet. Im Gegenteil: Er glaubt, dass er ebenso stolz auf seine Verdienste ist, die schließlich alles sind, was sein Leben ausmacht. Claudine sehnt sich nach Freiheit und einem Leben, das nicht unmittelbar mit dem Tod und dem Krieg verbunden ist. Es scheint wie ein Schicksalsschlag, dass sich ausgerechnet Hutchins und die Frau von dessen altem Vorgesetzten begegnen und sich in ihrer kurzen Zusammenkunft so sehr zueinander hingezogen fühlen, aber damit habe ich vielleicht schon zu viel verraten …
„Mond über Omaha“ ist alles andere als ein typischer Krimi, auch wenn die bekannten Motive wie Erpressung, Betrug und die Flucht vor der Vergangenheit eine bedeutende Rolle spielen. Der Autor geht stattdessen auf das Innenleben der beiden verbliebenen Soldaten und deren Familie ein und beschreibt die konträren Entwicklungen. Während Hutchins sich bereits im Krieg von seiner Rolle hat befreien können, aber dennoch nicht mit dem Dasein als Deserteur leben kann, gelingt es Reilly nicht, sich von seiner Berufung zu lösen, auch wenn sein ganzes Umfeld darunter leidet. Erst als sich die beiden wiederbegegnen, lernen sie, einen Schlussstrich unter die Angelegenheit zu ziehen, der jedoch nicht milder ist als das, womit sie zwanzig Jahre lang gelebt haben.
Eine sehr bewegende Geschichte hat Amila da verfasst; die Schicksale der beiden Kriegsgeschädigten gehen unter die Haut und stehen in gewisser Weise auch sinnbildlich für so viele Seelen, die nach dem Krieg nicht mehr zur inneren Ruhe gekommen sind und seitdem auch von den Eindrücken verfolgt werden, die der Krieg hinterlassen hat. Besonders deutlich wird dies im Unverständnis der beiden Frauen, die viel zu spät einsehen, dass ihre Männer nicht die einzigen Begleiter sind, mit denen sie ihr Leben verbringen können. Auch die Schlacht, die sie geschlagen haben, wurde ‚mitgeheiratet‘, doch das realisieren sie erst in dem Moment, in dem die vergangenen Geschehnisse wieder an die Oberfläche drängen.
Kurz und prägnant hat Amila den Kern der Geschichte auf den Punkt gebracht, doch die Eindrücke, die er damit vermittelt hat, währen noch über diesen Roman hinaus. Die Grausamkeit der Nachkriegszeit und das ruhelose Leben ehemaliger Soldaten – der Autor hat es ziemlich direkt und beklemmend dargestellt, und genau das macht dieses Buch so lesenswert. Die Originalfassung von „Mond über Omaha“ ist nun schon über 40 Jahre alt; die darin erzeugte Dramaturgie ergreift uns aber auch noch heute. Sehr empfehlenswert!
http://www.conte-verlag.de/
Die drei ???-Kids – Im Bann des Zauberers (Band 24)
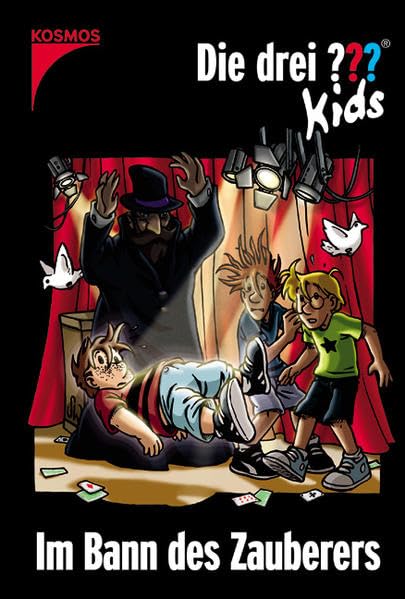
Die drei ???-Kids – Im Bann des Zauberers (Band 24) weiterlesen
Christoph Marzi – Lilith (Die Uralte Metropole 02)

Vier Jahre sind seit den Geschehnissen in „Lycidas“ vergangen. Emily hat sich daran gewöhnt, dass sie als Trickster eine besondere Gabe hat, die sie von den anderen Kindern an der Whitehall-Privatschule in London ausgrenzt und das Mädchen mit dem Mondsteinauge zu einer Außenseiterin macht. Doch Aurora Fitzrovia, die schon seit den Tagen im Waisenhaus von Rotherhithe ihre beste Freundin ist, hält auch weiter zu ihr.
Christoph Marzi – Lilith (Die Uralte Metropole 02) weiterlesen
Hohlbein, Wolfgang & Heike – Zauberin von Märchenmond, Die
Nach dem eigentlichen Ende der sehr erfolgreichen „Märchenmond“-Trilogie – seit dem Beginn der Serie 1982 gab es immerhin mehr als vier Millionen verkaufte Exemplare alleine in Deutschland – hat sich Wolfgang Hohlbein zusammen mit seiner Frau Heike ein Herz gefasst und doch noch einen vierten Teil nachgeschoben. Die in diversen Foren angemerkte Skepsis eingeschworener Fans ist dabei durchaus zu verstehen; schließlich konnte der Autor mit „Die Zauberin von Märchenmond“ trotz seiner Reputation auch nur verlieren, denn dass er an den Erfolg der alten Bücher anknüpfen würde, war nicht zu vermuten. Doch dann realisiert man irgendwann auch wieder, wer genau dieses Buch verfasst hat, und warum dieser Mann im Fantasy-Bereich einen schier übermächtigen Status hat – und schon muss man wieder zufrieden grinsend anerkennen, dass der Mann ganze Arbeit geleistet hat.
_Story_
Eigentlich hat Rebekka gar keine Lust darauf, zusammen mit ihren Eltern einen Urlaub auf dem Land zu verbringen. Und als sie in besagter Idylle ankommen, fühlt sich das pubertierende Mädchen auch bestätigt, denn der Zielort Craisfelden hat ihr nicht sonderlich viel zu bieten. Auch die Mädchen, mit denen Rebekka dort um die Häuser zieht, gefallen ihr nicht sonderlich, helfen aber zumindest, ihre Langeweile zu unterdrücken. Doch dann ändert Rebekka plötzlich ihre Meinung: In einem Kellergewölbe stößt sie auf das Tor in eine andere Welt, eine Welt, die sie in ihrer Kindheit schon einmal entdeckt hat, nämlich das Land Märchenmond. Allerdings ist dort nichts mehr so, wie es noch damals, bei ihrem letzten Besuch, war. Die träumerische Atmosphäre ist der Finsternis gewichen, und statt Zauberwesen trifft sie auf fiese Ungeheuer, die deren Stelle übernommen haben.
Und diese Ungeheuer werden auch zur größten Bedrohung für Rebekka, denn sie ist die einzige Person, die durch ihre Zauberkraft noch das Ende von Märchenmond abwenden kann. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden, dem Gräuel Schnapp, der stotternden Elfe Scätterling und den Zwillingen Torin und Toran lässt sie sich auf ein gefährliches Abenteuer ein, bei dem sie die Welt von Märchenmond vor dem Unheil retten muss, um wieder zurück nach Hause zu kommen.
_Meine Meinung_
Wolfgang Hohlbein hat einfach einen unheimlich schönen Schreibstil, der uns auch in diesem Buch wieder über die ein oder andere in die Länge gezogene Passage weiterhilft. Denn obwohl die Geschichte im Grunde genommen wieder sehr schön aufgebaut ist, lässt sich nicht leugnen, dass in den mehr als 800 Seiten des Buches so manche Passage enthalten ist, die man etwas kürzer hätte fassen können. Für meinen Geschmack hätte man sich auch in der einleitenen Geschichte um das Mädchen, dass keine Lust auf den langweiligen Urlaub hat, aufs Wesentliche beschränken können, denn im Gegensatz zur Handlung in Märchenmond ist die Erzählung zu Beginn noch ziemlich dröge, und man wartet irgendwann nur noch fiebrig auf den Moment, in dem Rebekka in die Welt eintaucht, die sie in ihrer Kindheit bereits mit ihrem Bruder Kim betreten hat. Andererseits: Zum besseren Verständnis und zur Identifikation mit den Eigenheiten der Hauptdarstellerin kann man den Einstieg durchaus akzeptieren.
Richtig gut wird der Roman dann aber erst, als Rebekka ihre neuen Freunde trifft, die ihr vom Schicksal Märchenmonds erzählen. Mit sehr einfachen Beschreibungen und Darstellungen – schließlich handelt es sich hier eigentlich auch ’nur‘ um Jugendliteratur – gelingt es dem Autor zusammen mit der ebenfalls beteiligten Heike Hohlbein, eine sehr schöne, fast schon märchenhafte (nomen est omen) Atmosphäre zu erschaffen, die einen schönen Unterbau zu den vielen Abenteuern, die Rebekka und ihre Gefolgschaft erleben, bietet.
Schade ist nur, dass es zwischenzeitlich schon einmal etwas unübersichlich wird, weil man trotz des durchaus vorhandenen Raums nicht näher auf Details eingeht und stattdessen einen Handlungsstrang bis zum Schluss hin unbeendet lässt. Hohlbein legt zwar sehr großen Wert auf ständige Veränderung durch die immer neuen Aufgaben, die gelöst werden müssen, vergisst aber zeitweise, einen Gedanken konsequent zu Ende zu führen. Dennoch bricht die Handlung aber nie in Hektik ab, und eigentlich sind die hier beschriebenen Mängel auch nicht so gravierend, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, aber trotzdem wünscht man sich, dass der Autor nicht schon auf das nächste Ziel blickt, wenn er die vorangegangene Etappe noch gar nicht gemeistert hat.
Kleine Schwächen, nicht viel mehr, denn ansonsten ist „Die Zauberin von Märchenmond“ ein sehr schönes Buch mit wirklich toll umschriebenen (teils auch schon bekannten) Charakteren und Landschaften, einer sich stets wandelnden Erzählung und durchgängig auf hohem Level angesiedelter Spannung. Ob Hohlbein damit rein erfolgstechnisch an besagte Trilogie wird anknüpfen können, wird sich zeigen, aber abgesehen von den flüchtig auftretenden Kritikpunkten gibt es eigentlich keinen Grund, sich als Fan der Reihe nicht auch den vierten Teil zuzulegen. Hohlbein ist nunmal Hohlbein, und dies zeigt sich gerade in einem solchen Buch, wo das prinzipiell nicht ganz so geniale Resultat durch den tollen Schreibstil wieder weitestgehend kaschiert werden kann. Und erst das macht einen Autor der Extraklase aus …
http://www.maerchenmond.de/
Wolfgang Jeschke – Das Cusanus-Spiel
1997 erschien mit „Meamones Auge“ der letzte Roman Wolfgang Jeschkes. In den folgenden Jahren erschienen Kurzgeschichten in diversen Magazinen und Anthologien, zuletzt „Das Geschmeide“ in Andreas Eschbachs „Eine Trillion Euro“. Mit „Die Cusanische Acceleratio“ veröffentlichte Jeschke 1999 bereits ein Kapitel aus dem groß angelegten Roman, der schon vor seinem Erscheinen als Meilenstein der deutschen Science-Fiction gehandelt wurde.
Wolfgang Jeschke gilt als Großmeister der deutschen Phantastik und arbeitete bis 2001 als Lektor für die SF-Reihe des Heyne-Verlags. Ihm gebührt Hochachtung als Förderer und Mentor der deutschen phantastischen Literatur, die er selbst mit zahlreichen Kurzgeschichten und prämierten Romanen bereicherte – so erschien im Herbst 2005 sein Roman „Der letzte Tag der Schöpfung“ als erster Roman deutschen Ursprungs in der Heyne-Reihe „Meisterwerke der Science Fiction“.
Das Cusanus-Spiel
Eigentlich „Globusspiel“ genannt, ist es ein ausgesprochenes Geduldsspiel, zu dem es jeder Menge Fingerspitzengefühl bedarf. Nicolaus Cusanus war ein Vertrauter und Kardinal des Papstes im 15. Jahrhundert. Außerdem ist er für die Botanikerin Domenica Ligrina die faszinierende Persönlichkeit überhaupt.
Domenica lebt im Rom der Jahre um 2050, in einer Zukunft, in der die Erdölvorräte ausschließlich vom Militär und von Gangsterorganisationen beherrscht werden, nachdem große Kriege für die endgültige Ausbeute der natürlichen Reservoire gesorgt hatten. Im Grunde besteht wieder die Macht des Stärkeren, die Regierungen sind völlig korrumpiert und haben meist als Militärregierung die Demokratien abgelöst. Ein dramatischer Klimawandel bedroht Europa von Süden und Deutschland wurde großenteils Opfer einer schweren Strahlungsseuche.
Domenica schließt sich nach ihrem Studium einer päpstlichen Organisation an, die über so genannte Solitone Reisen in die Vergangenheit unternimmt, um zum Beispiel biologische Proben zu retten und in der Folge die Ökosphäre der Erde zu reparieren.
Die Probleme, die dabei entstehen, sind nicht technischer Art, sondern ziemlich paradox: Das Wissen der Zeitreisenden bedroht die Integrität des Universums und in manchen vergangenen Zeiten auch die Reisenden selbst – so verschlägt es Domenica in die Zeit Kardinal Cusanus‘, die Zeit der beginnenden Hexenverfolgung …
Ratten, Engel, Vergewaltiger
Was als erstes auffällt (nämlich auf der ersten Seite) ist der Gebrauch der überholten Rechtschreibregeln, umso stärker, als dass es sich bei diesem Roman eindeutig um einen Science-Fiction-Roman handelt, dem Zukunftsorientiertheit quasi im Namen steht. Wenn der Leser also mittlerweile an neuere Regeln gewöhnt ist, wird er ab und zu – und natürlich leider an den spannendsten Stellen – aus dem Lesefluss gerissen. Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass Jeschke sich um eine möglichst detailierte Schilderung der Zukunft bemüht. In allen Bereichen hagelt es Beschreibungen, sei es nun in der Umwelt oder bezüglich der Charaktere; die Protagonistin ist außerdem Botanikerin, so dass sie ein besonderes Augenmerk auf die Pflanzenwelt richtet und uns an ihrer Kenntnis aller möglichen botanischen Fachbegriffe teilhaben lässt.
Wie bereits erwähnt, wurde der Roman im Vorfeld hoch gepriesen, aber man konnte einigen Stimmen durchaus vertrauen, wie den Aussagen Andreas Eschbachs. Es zeigt sich allerdings, dass derartige Hymnen oft mehr schaden als nutzen, denn durch sie steigt die Erwartungshaltung in Höhen, die das tatsächliche Lesevergnügen erstmal erreichen muss. Andererseits erhält der Roman dadurch eine größere Beachtung, was sich sicherlich auf die Verkaufszahlen auswirkt.
Unzweifelhaft fabuliert Jeschke ein hochinteressantes Thema neu und spickt es mit Ideen und Lösungswegen großer Kreativität. Die Reise in die Vergangenheit, ohne die Möglichkeit, große Zeitparadoxa herbeizuführen – ein Thema, an dem sich schon viele Autoren den Kopf zerbrachen. Bei Jeschke existiert zu der Reise an sich keine Maschine, sondern ein anscheinend natürliches Phänomen. Solitone, das sind Wellen in der Zeit, die sowohl in Richtung Vergangenheit als auch Richtung Zukunft laufen und die Reisenden auf sich „surfen“ lassen, wobei komplizierte Bedingungen jede Reise zu einem Wagnis machen und die Richtung festlegen, so dass die veränderliche Zukunft weiterhin unerreichbar bleibt.
Vordergründige Geschichte des Cusanus-Spiels ist die Frage: Könnte man durch Reisen in die Vergangenheit die Fehler des Menschen (wie die Monokulturisierung großer Erdbereiche) beheben oder zumindest Informationen und Materialien (wie Samen) gewinnen, um sie zu korrigieren? Wie ein paar Nebenepisoden zeigen, lassen sich bestimmte Ereignisse rückgängig machen, andere wiederum scheinen zu stark in der Struktur des Universums verankert zu sein, so dass kein Reisender in zeitlicher Nähe vom Soliton abgesetzt wird.
Was Jeschke hervorragend gelingt, ist die Zusammenführung offener Fäden und Beantwortung verwirrender Fragen, die sich im Laufe der Geschichte ansammeln. Leider drängen sich einige dieser Details gegen Ende des Romans und stehen dadurch im Gegensatz zu den sehr ausführlich geschilderten Passagen, die sich später als nebensächlich erweisen. Trotzdem beschwört Jeschke wundervolle Elemente herauf, in denen sich seine große Meisterschaft zeigt, und gerade in den kürzer gefassten Kapiteln wird die Erzählung stark und mitreißend. Dem obligatorischen SF-Leser scheint der Schwerpunkt falsch gesetzt, mehr zur Normalität auf der Suche nach einer rationalen Erklärung. Die Gratwanderung zwischen den Genregrenzen beraubt den Roman seiner großartigen Möglichkeiten: Unwichtig erscheinen die Darstellungen in den ersten zwei Dritteln des Romans, wo Jeschke zwar mit plakativer Sprache und teilweise obszöner Deutlichkeit ein vorstellbares Bild der menschlichen, nicht allzu fernen Zukunft zur Zeit der letzten Ölvorkommen entwirft, deren Einzelheiten der Geschichte aber wenig Substanz hinzufügen. Ein kurzes Kapitel um den Wendepunkt der Solitone (am Ende der Zeit) wirft ein faszinierendes Schlaglicht auf den Hintergrund, den Jeschke dem Leser weitgehend vorenthält. Möglicherweise rückten Details bei einer zweiten oder dritten Lektüre das Bild zurecht und zeigten es in seiner Vollkommenheit, aber dazu ist es einfach zu umfangreich.
Nebenbei setzt sich Jeschke stark mit ethischen und sozialen Fragen auseinander; so wählt er ja als Handlungsort das Mittelalter, wo die Kirche in hoher Macht steht und die Hexenverbrennungen gerade anlaufen. Einer der wirklich wichtigen Charaktere, jener, den manche Zeitheimische ‚Engel‘ nennen, könnte durchaus Jeschkes moderne Interpretation eines Engels sein. Seine Flügel – nun ja, Geschmacksache. Neben Gott behandelt er auch mehrfach und bildgewaltig das Thema der Vergewaltigungen und verknüpft das mit der Dynamik großer Menschenmassen, die sich schnell von Abscheulichkeiten erregen lassen. Eines Teils ist das ein hoffentlich utopisch bleibender Aspekt seiner Geschichte, mit dem Jeschke das Bild der zerstörten Zukunft noch deutlicher schildert, andererseits lässt er sich auf das unerklärliche Vergnügen der Menschen an dem Leid anderer Menschen beziehen, dem durch die Möglichkeiten des Internet neuer Boden verfügbar gemacht wurde. Trotzdem wirkt diese moralische Note störend, denn sie lässt sich nicht als unabdingbarer Bestandteil der Geschichte ansehen.
Der Titel „Das Cusanus-Spiel“ lässt sich aus einer Textpassage abgeleitet übersetzen:
„[…] wenn wir uns bemühen und es mit Geduld angehen, können wir unserem Ziel doch recht nahe kommen.[…]“
Das Cusanus-Spiel, Kapitel VI „In Vincoli“, Seite 108
In obigem Zitat geht es um den Sinn des Cusanus-Spiels, und übertragen auf den Roman und seine Handlung bedeutet das, dass alles Mühen der Menschheit und des Menschen speziell dem Streben nach Vollkommenheit dient, die nie erreicht werden kann. So betrachtet, gewinnt der Roman in jeglicher Beziehung eine neue Facette. Wichtiges Detail: Domenica, die zum Ende hin fast die Vollkommenheit (zumindest in Bezug auf die Zeitreisen) erreicht, schwindet aus der „realen“ Welt der Zeitheimischen und lässt dadurch wichtige Aspekte ihres Anspruchs zurück.
Übrigens: Was passiert, wenn es Zeitreisen wirklich gibt? Vorstellbar ist, dass es dann überall und zu jeder Zeit nur so von Reisenden wimmeln müsste. Einen kleinen Ausblick darauf liefert Jeschke auch gegen Ende des Romans, aber nicht in voller Konsequenz.
Fazit
Der Knackpunkt zur Bewertung: Wenn ein 700-seitiger Roman trotz einer sichtbaren hervorragenden Thematik bis zur Hälfte nicht in die Gänge kommt, entspricht er nicht einem weit verbreiteten Anspruch an die Qualität von Unterhaltungsromanen. Hier muss man deutlich sagen, dass zu viel drumherum erzählt wird, was uns einen möglichen Zukunftsspiegel vor das Gesicht hält, dem Geschichtsfluss aber nur abträglich ist. Erst in den letzten Kapiteln wird Jeschke seinem Ruf als „Meister der Phantastik“ wirklich gerecht, doch der Part ist zu schade für dieses Buch.
Klaus Jürgen Schmidt – Trommeln im Elfenbeinturm. Interaktiver Thriller
Der Autor
Klaus Jürgen Schmidt, geboren 1944, lernte als Kind Junge-Pionier-Arbeit und „Völkerfreundschaft“ à la DDR kennen, später in der Bundesrepublik Deutschland „Straßenrevolution“ à la 1968 und das Ringen um Dritte-Welt-Solidarität beim Redakteursmarsch über Korridore öffentlich-rechtlicher Funkhäuser. Als Radio-Reporter sammelte er Erfahrungen in Indochina, der Pazifischen Inselwelt, Südostasien, Lateinamerika, Nordafrika und Arabien.
Anfang der Achtziger startete er ein Projekt, bei dem Menschen aus Nord und Süd per Satellitenübertragung miteinander ins Gespräch gebracht werden sollten, im Zuge öffentlicher Radiopräsenz. Seither ist es ihm ein besonderes Anliegen, den Menschen aus Afrika eine Stimme zu geben, was er schließlich in Form von „Radiobrücke Übersee“ in Deutschland und „Radio Bridge Overseas“ in Simbabwe, einer Multimedia-Initiative mit Trainingsofferten für junge Journalisten aus Nord und Süd, auch realisierte. Auf der EXPO 2000 in Hannover stellte er sein Projekt erstmals vor.
Klaus Jürgen Schmidt lebt und arbeitet in Harare (Simbabwe) bzw. im niedersächsischen Dolldorf.
Story
Als die dunkelhäutige Lainet zusammen mit ihrer deutschen Freundin mit einem Schlauchboot über den Sambesi paddelt, ahnen sie noch nicht, dass sie schon sehr bald aufgrund verschiedener Schicksalsfügungen auseinandergerissen werden. Beim Baden nahe ihres Ankerplatzes werden sie von einem Verbund von Rangern entdeckt, deren Anführer Lainet eröffnet, dass er sie gerne wiedersehen möchte. Nach einem Streit begibt sich Lainet für einige Zeit in die Wildnis und trifft dort tatsächlich diesen Ranger wieder. Eddington, so sein Name, hängt schwer verletzt an einem Baum und kann Lainet gerade noch mitteilen, dass sie beide von diesem Ort verschwinden müssen, weil Gefahr droht. Lainet schleppt den viel schwereren Ranger bis zum nächsten Dorf und lässt ihn dort in der Heimat ihres Vaters pflegen. Doch der Mann braucht professionelle Hilfe, und als schließlich ein Hubschrauber herbeigeschafft werden kann, um Eddington ins nächste Krankenhaus abzutransportieren, geraten die beiden in eine Falle …
Derweil ist Gertrud von Wilderern geschnappt worden, die ihr aber nicht feindlich gesinnt sind. Getrud bietet ihnen einen dicken Batzen Geld für ihre Lebensgeschichte und verspricht, diese in Deutschland zu publizieren. Bei ihrer Wanderung mit der zweiköpfigen Gruppe stößt sie jedoch auf ein bekanntes deutsches Gesicht, das anscheinend Mitglied einer Schmugglerbande ist. Zurück in Hamburg, berichtet die Journalistin ihrer Agentur von ihrer Entdeckung, woraufhin sie sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Stefan Sager zurück nach Simbabwe begibt, um den anscheinend korrupten Intrigen auf die Spur zu kommen. Doch schon bald werden die beiden getrennt, und während Gertrud in Simbabwe nach ihrer Freundin und den Hintergründen für den groß angelegten Schmuggel sucht, forscht Sager auf verschiedenen Kontinenten nach den Machenschaften, die über die Landesgrenzen Simbabwes hinaus langsam das Rätsel zu einer politischen Verschwörung offenbaren …
Meine Meinung
Im begleitenden Info wird „Trommeln im Elfenbeinturm“ als interaktiver Thriller angepriesen und darauf verwiesen, dass man die verschiedenen Schauplätze der Handlung auch im Internet unter http://www.radiobridge.net verfolgen kann. Dort kann man dann auch näher in die Traditionen des simbabwischen Volkes eintauchen und generell das hier von Klaus Jürgen Schmidt dargestellte, fundierte Hintergrundwissen zur politischen Lage sowie zur Kultur im afrikanischen Staat noch einmal gebündelt überblicken.
Das soll aber nicht heißen, dass das Buch ausschließlich in dieser Form funktioniert – aber auch nicht, dass „Trommeln im Elfenbeinturm“ tatsächlich ein Thriller im klassischen Sinne ist. Vielmehr zeichnet der Autor hier ein Bild von fiktiven Einzelschicksalen in der Dritten Welt, die sich sehr gut in das realistische Geschehen der dortigen politischen Lage im Jahre 1989 – zu diesem Zeitpunkt spielt das Buch – einordnen lassen. Aber all das geschieht im Rahmen einer spannenden, stetig an Dramaturgie gewinnenden Handlung, die sich in viele verschiedene Unterpunkte gliedern lässt.
Zunächst einmal wären da die beiden Hauptakteure Lainet Musora und Gertrud Steiner, die mitten in einen Konflikt geraten und im Laufe der Handlung unbewusst Eigenschaften annehmen, die für die jeweils andere Kultur typisch sind. Gertrud denkt immer mehr im ‚afrikanischen‘ Sinne, während Lainet sich gerade im Hinblick auf ihr Schamgefühl und in ihrer generellen Rolle als Frau westlich orientiert. Im Verlaufe der Geschichte entwickelt sich zwischen ihnen eine sehr warme Beziehung, die den beiden Karrierefrauen gerade in den Momenten bewusst wird, in denen sie von der jeweils anderen Part befürchten, dass sie während der nach einem Zwist entstandenen Trennung umgekommen sei.
Der Plot wechselt daher auch von Kapitel zu Kapitel die Schauplätze und beschreibt einerseits Lainets schier hoffnungslose Suche nach entsprechender Versorgung für den Ranger Eddington, bei der es zu einer sehr speziellen Begegnung kommt, als Lainet ihre Vergangenheit vergisst und ihr Schamgefühl besiegt und mit dem bewusstlosen Ranger Geschlechtsverkehr hat. Dass die Frau auf diese Art und Weise schwanger wird, ist zwar etwas abgehoben dargestellt, erweitert aber das Drama, das sich um den schwer verletzten Ranger und die mit sich selbst ringende Lainet entwickelt hat. Hinzu kommen schließlich das gespaltene Verhältnis zu ihrem Vater und die verschollenen Erinnerungen aus ihrer Kindheit, die Lainet langsam wieder aufzuarbeiten beginnt, und die sie im Nachhinein auch seelisch schwer belasten.
Auf der anderen Seite wittert Gertrud den beruflichen Durchbruch mit einer sensationellen Story und kehrt mit Unterstützung der Redaktion ihres Magazins zurück nach Simbabwe. Auf der Suche nach Lainet entdeckt sie immer mehr Fakten, die darauf schließen lassen, dass höchste Institutionen und Politiker in eine internationale Konspiration verwickelt sind, und beginnt schließlich, auf eigene Faust zu ermitteln. Doch sie gerät selber in die Schusslinie und wird von der Jägerin zur Gejagten, aber wie der Zufall es so will, trifft sie schließlich wieder auf ihre alte Freundin, mit der sie schließlich die noch fehlenden Zusammenhänge erkundet – stets verfolgt von unbekannten Mächten, denen bekannt ist, dass Gertrud bereits mehr weiß, als sie wissen sollte.
Die Entwicklung der beiden Damen ist im Laufe des Buches jedoch unterschiedlich. Lainet ist sehr mit ihrem Seelenleben beschäftigt und setzt sich mit ihren Verlusten auseinander, während es Gertrud vornehmlich darum geht, Korruption aufzudecken und mit einer Sensationsstory die Verantwortlichen zu entlarven. Doch gerade diese Mischung funktioniert im Endeffekt sehr gut und kombiniert schließlich innerliche Zerrissenheit und Emotionalität mit einer spannungsvollen, aber auch ziemlich komplexen Handlung, bei der es sich letztendlich sicher lohnt, die auf der Homepage vorgestellten Informationen zu verarbeiten, weil es speziell im zweiten Teil des Buches zunehmend schwerer wird, das gesammelte politische Wissen adäquat zu überschauen.
Dies ist nämlich auch der einzige Punkt, an dem „Trommeln im Elfenbeinturm“ Probleme bereitet; Klaus Jürgen Schmidt führt sehr oft verschiedene Ereignise, die mit diversen politischen Begebenheiten in Zusammenhang stehen, ziemlich ausfühlich aus und schmeißt dabei mit Spezialwissen um sich, die man, ohne mit der Materie vertraut zu sein, nicht direkt wird einordnen können. Zwar bemüht er sich merklich um Transparenz, doch gerade wenn er auf Geschehnise aus der afrikanischen Politik zu sprechen kommt, gerät die Geschichte bisweilen schon mal aus den Fugen. Darunter leidet schließlich auch die eigentliche Story, sprich die große Verschwörung, denn zum Ende hin wird die Handlung vor Ort in Afrika dermaßen komplex, dass der Autor versäumt, den Punkt zu treffen, oder besser gesagt den Aufbau eines endgültigen Höhepunkts verpasst.
Deshalb muss man nun auch sehen, aus welcher Perspektive man das Buch betrachtet: Möchte man einen echten Thriller mit logischem Aufbau und klarer Struktur, wird man in „Trommeln im Elfenbeinturm“ kein geeignetes Objekt finden; möchte man aber ein Stück Zeitgeschichte aufsaugen, einen sehr tiefgängigen Blick in die afrikanische (und speziell in die simbabwische) Kultur erhaschen, tolle Beziehungsgeflechte entdecken und realitätsnahe Schicksale erleben, dann ist dieses Buch eine echter Schatz.
386 Seiten
ISBN-13: 978-3833429606
Jonathon King – Tödliche Fluten
Anfang der 1920er Jahre versuchten Cyrus Mayes und seine beiden Söhne Steven und Robert Geld beim Bau des ersten Highways durch die Sümpfe der Everglades im Süden des US-Staats Florida zu verdienen. Sie gerieten in eine stickige grüne Hölle, in der brutale Aufseher die Arbeiter wie Sklaven misshandelten. Die Gewalt regierte hier, wo das Gesetz abwesend war. Wer die Flucht versuchte, wurde vom firmeneigenen Lohnkiller John William Jefferson als ‚Deserteur‘ betrachtet, verfolgt und umgebracht, denn niemand sollte wissen, was in den Everglades vor sich ging.
Auch Mayes und seine Söhne wurden offenbar ermordet. Ein Urenkel hat Briefe gefunden, die auf diese Familientragödie hinweisen. Er wünscht Aufklärung und engagiert den Anwalt Billy Manchester, der wiederum seinen Freund, den Privatdetektiv Max Freeman, mit den Ermittlungen beauftragt. Manchester entdeckt, dass die Firma Noren, die einst mit den Straßenbauarbeiten beauftragt war, im PalmCo-Konzern aufgegangen ist, einem der größten Bauunternehmer in Florida. Jonathon King – Tödliche Fluten weiterlesen
Bánk, Zsuzsa – Schwimmer, Der
Ungarn, 1956: Auch Ungarn wurde nach 1945 dem Ostblock angegliedert. Sowjetische Truppen besetzten das Land und der Große Bruder in Moskau nahm fortan die Geschicke des Landes in die Hand. Es folgte eine der radikalsten Bodenreformen nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der 35 Prozent der Bodenfläche des Landes verteilt wurden. Moskau versuchte, die eigenen Methoden auch in Ungarn anzuwenden: Landwirtschaft und Wirtschaft wurden nach dem sowjetischen Modell umstrukturiert, doch die Planwirtschaft versagte. Der damalige Staatschef Rákosi, ein Stalinist, fiel nach Stalins Tod 1953 in Moskau in Ungnade. Er wurde durch Nagy ersetzt – ein Fehler, denn Nagy setzte sich für den Reformkommunismus ein: Freilassung der Internierten, Abschaffung der Zwangsmaßnahmen, ja sogar die Ermächtigung zur Auflösung der Kolchosen. Natürlich konnte er sich mit dieser Politik nicht lange halten. 1955 erlangte Rákosi wieder die Oberhand und übernahm das Amt. Mit dem Tauwetter in Polen setzten auch in Ungarn 1956 Unruhen ein. Drei Jahre nach Stalins Tod machten sich Schriftsteller, Journalisten und Künstler öffentlich Luft und protestierten zunächst gegen Spielplanänderungen und Zensur. Im Oktober schlossen sich dann auch die Studenten an und formulierten ihren Traum von einem zwar kommunistischen, jedoch unabhängigen und neutralen Ungarn. Der Stein kam ins Rollen: Der Aufstand griff aufs Land über, der Machtapparat brach zusammen und Nagy erschien wieder auf dem Spielfeld. Zu diesem Zeitpunkt allerdings beschloss Moskau bereits, in das Geschehen einzugreifen und hielt Ungarn mit Versprechungen hin, bis sie ihre Truppen geordnet hatten. Am 4.11.1956 war es dann so weit. Sowjetischen Truppen stürmten Budapest und schlugen den Aufstand nieder. Der kurze Traum von einem unabhängigen und demokratischen Ungarn war ausgeträumt. Doch flüchteten in der kurzen Zeit der Unruhen mehr als 19000 Ungarn in den Westen.
All das wird in Zsuzsa Bánks Debütroman „Der Schwimmer“ nicht erzählt. Vor dieser sehr politischen Kulisse spielt ihr absolut unpolitischer Roman. Die Ereignisse aus dem Jahr 1956 schwingen im Hintergrund mit, offen thematisiert werden sie jedoch nicht. Zu Beginn des Romans befinden wir uns in eben jenem Jahr 1956. Die kleine Kata lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf. Ganz plötzlich, ganz unerwartet brechen diese politischen Ereignisse auf einer sehr persönlichen Ebene in Katas Lebenswelt ein. Ihre Mutter gehört zu jenen 19000 Menschen, die während des Aufstands in den Westen geflohen sind. Ihr Vater und damit auch Kata erfahren all dies nur aus zweiter Hand. Auf einmal ist die Mutter weg, unerreichbar fern und alles, was von ihr bleibt, ist kurze Zeit später ein kleiner verschlüsselter Gruß über das Radio Freies Europa. In einen Zug gestiegen sei sie, einfach so, mit ihrer Freundin Vali. Nichts habe sie bei sich gehabt und erst in der Mitte des Buches erfährt der Leser, dass sie bis zum letzten Dorf in Ungarn gefahren sind, um von dort zu Fuß und bei Nacht über die grüne Grenze zu laufen. Ein Führer hat sich ihnen angeboten und Katas Mutter bezahlte ihn mit ihrem Ehering.
Nicht nur Katas Leben bringt dieser unerwartete Verlust durcheinander. Auch ihr Vater scheint aus der Bahn geworfen. Seit seine Frau verschwunden ist, verfolgt er kein Ziel, scheint keine Träume zu haben, keine Ansprüche an die Zukunft. Nur manchmal, da „taucht er ab“, wie Kata und ihr Bruder Isti das nennen. Er liegt einfach auf dem Sofa und starrt an die Decke. Tagelang, manchmal sogar für Wochen. Er schleppt seine beiden Kinder zunächst nach Budapest, dann in einen kleinen Ort, dann an den Balaton, wo sie länger bleiben. Als sie dort wegmüssen, geht es wieder an einen namenslosen Ort – immer kommen sie bei Verwandten unter und nie scheint sich in ihrem Leben etwas zu verändern. Kata und Isti gehen nicht zur Schule. Ihr Vater hat fast nie einen Job. Zeit spielt keine Rolle, Geld spielt keine Rolle – es geht nur darum, weiterzuexistieren.
Damit hat „Der Schwimmer“ auch nicht wirklich eine erzählbare Handlung. Vielmehr erschließt sich das Buch durch Personen, denen Kata begegnet, durch Figuren, die in einzelnen Kapiteln näher beleuchtet werden. Die Ich-Erzählerin Kata beschreibt nicht aus der Zeit heraus, aber trotzdem mit kindlicher Wahrnehmung. Sie beobachtet, nimmt wahr, schaut hin und hört genau zu. Was aus ihren Zeilen durchschimmert, ist eine unterschwellige Verzweiflung aller Beteiligten, die Gewissheit, dass nichts vorwärtsgeht. Die Melancholie ergreift alle: Den Vater, wenn er „taucht“, Kata, wenn sie vor dem Radio wacht, in der Hoffnung, noch einen Gruß ihrer Mutter abzufangen. Und auch Isti, der nur glücklich ist, wenn er im See schwimmen kann; immer nur schwimmen.
Zsusza Bánk ist selbst die Tochter von ungarischen Eltern, die nach Deutschland ausgewandert sind. 1965 wurde sie in Frankfurt/Main geboren und lebt auch noch heute dort. Sie studierte Publizistik, Politik und Literatur und „Der Schwimmer“ ist ihr Debütroman, der gleich mit mehreren Preisen, z. B. dem „Aspekte“-Literaturpreis, ausgezeichnet wurde. Und das zu Recht. Bánks poetische Sprache ist so dicht und fesselnd, dass man pro Tag nur ein oder zwei Kapitel genießen sollte. „Der Schwimmer“ ist auf keinen Fall ein Buch, das dadurch gewinnt, dass man es in einer Tour liest. Es ist leise, aber es bleibt im Gedächtnis. Es macht schwermütig, ist aber nicht erdrückend.
„Der Schwimmer“ ist ein uneingeschränkt empfehlenswertes Debüt. Wenn man auf die leisen Töne Wert legt, wenn man nicht unbedingt eine fesselnde Handlung braucht, sondern sich mit den faszinierenden Gedanken eines kleinen Mädchens zufrieden geben möchte, dann sollte man dem Buch seine Aufmerksamkeit schenken.
Ritter, Ulrike – Tuonuove II – Mering und die Nibelungen
Im mittelalterlichen Nibelungenepos wird die Ortschaft Mering in Schwaben namentlich genannt. Mering galt als Inbegriff einer erfolgreichen Kultivierung der mittelalterlichen Urlandschaft, welche die durchziehenden Nibelungen in fataler Weise missachteten. Die Künstlerin Ulrike Ritter hat dies zum Thema ihrer Bilder gemacht und legt eine experimentelle Dokumentation vor, in der sie die illustrativen Elemente eines Ausstellungskataloges mit der inhaltlichen Intensität wissenschaftlicher Forschung verbindet. Sie stützt sich in ihren Recherchen vor allem auf die Geschichte des Grafengeschlechts Ilsung von Möringen, das als Stifterfamilie der Hundeshagen`schen Nibelungenhandschrift in Frage kommt.
Das Nibelungenlied lässt die Burgunden genau die „tuonuove“ erreichen, wo die Südseite der Donau von der Paar als kleinerem Nebenfluss und moorigen oder auch schon damals kultivierten und landwirtschaftlich genutzten „Inseln“ bestimmt wird. Mit der Durch- und Überquerung von Donau und Paar, der Tuonuove, einer Art kleineres Zweistromland, mit Hilfe des Schiffes des erschlagenen Fährmanns und durch ihre kriegerische Auseinandersetzung mit dem Markgrafen Else und seinem Bruder wird das Vorhaben „Nibelungen“ negativ in einen blindwütigen Kriegszug verkehrt, der voraussichtlich allen das Leben kostet.
Der Markgraf Else, der im Gegensatz zu seinem Bruder Dankwart nicht von den Burgundern erschlagen wird, weist schon wegen seines schnellen Anritts aus Möringen eindeutig auf die Grafen Ilsung hin, auch wegen einer berühmten Kaiserurkunde, eine der Donauinseln betreffend, die Graf Adalbero Ilsung von Möringen und dessen „Moringa“ nennt. In der weiteren Recherche ihrer Familienchronik spricht noch mehr für die Zusammengehörigkeit der erforschten Familien zum Nibelungenlied. Aus einer alten Urkunde aus dem Besitz des Adelsgeschlechts Gossenbrot wurde eine Falzverstärkung für das Hundeshagen`sche Folio erstellt. Eine andere dortige Adelsfamilie, die Gumpenbergs, kaufte im Jahre 1554 die Ortschaft (Probstei) Pförring, die in den Nibelungen ebenfalls namentlich erwähnt wird.
Kriemhild überquert die Donau bei Pförring. Anhand der lang anhaltenden Beziehungen der Ilsungs zu der Hundeshagen`schen Handschrift um 1200, der frühesten der bekannten Handschriften (bis ins 16. Jahrhundert im Besitz der Ilsungs), geht die Künstlerin und Autorin auch auf wesentliche Inhalte des Nibelungenliedes ein. Diese Handschrift wurde im 15.Jahrhundert wahrscheinlich von Sigismund Ilsung neu gebunden. Die Rolle von Markgraf Else und seinem Bruder Dankwart ist in der gesamten Handlung sehr gering, dafür aber hochgradig signifikant. Wie der Bischof von Passau, der ebenfalls nicht mit einem historisch korrekten Namen benannt ist und eine wichtige, historisch-reale Randfigur darstellt, ist der Markgraf Else (für Ilsung) aus Möringen „fast“ korrekt betitelt und damit als Stifterfigur indiziert. Sie komm bei ihrer Untersuchung nebenbei auch zum Resultat, dass der häufig gemachte Unterschied zwischen der Klage als christlichem und dem Nibelungenlied als weltlichem Text nicht nachvollziehbar ist und aufgrund ihrem Hintergrund einer falschen Theorie entspricht. Angefügt sind dann die Bilderserie der Künstlerin in einer radikalen Stilmischung sowie eine CD-Rom.
|74 Seiten, 27 Farbabbildungen, 22 S/w-Abbildungen, mit CD-Rom (Bilder und Texte)
Format 29 cm x 20 cm, Paperback|
http://www.electroniclandscape.de/