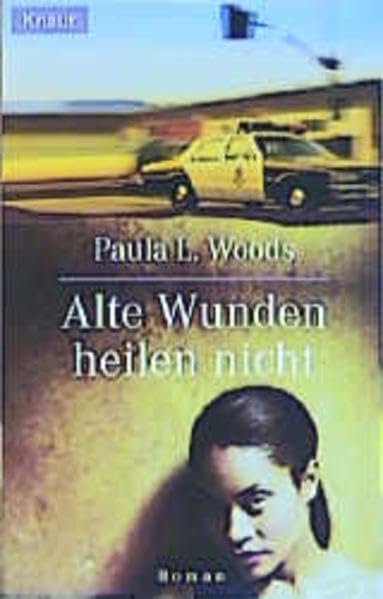Los Angeles ist 1992 eine Stadt im Rassenkrieg. Nachdem Angehörige der Polizei einen schwarzen Bürger brutal zusammengeschlagen haben und dafür vor Gericht unbehelligt blieben, ist der schwelende Konflikt zwischen Weiß und Schwarz aufgeflammt. Besonders in den Gettos brennen ganze Straßenzüge. Plündernd und prügelnd zieht der wütende Mob durch die Stadt. Die Polizei ist beinahe machtlos weil heillos in der Unterzahl.
Mitten im Getümmel: Charlotte Justice, Detective im Los Angeles Police Department. Sie gehört zur Elite, die bei Raub und Mord ermittelt, doch intern hat sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Justice ist schwarz und arbeitet als einzige Frau in einer Truppe, die seit jeher für ihren Rassismus und Sexismus bekannt und berüchtigt ist. Die Unruhen stellen die mühsam vorgegebene Toleranz für sie und ihre Kollegen auf eine harte Probe.
Als sei die Situation nicht dramatisch genug, wird Justice während eines Einsatzes verletzt, weil sie einen Unschuldigen vor den eigenen Polizeikollegen schützen muss. Doch Lance Mitchell, das Opfer, ist ein angesehener schwarzer Arzt. Justice paukt ihn heraus. Wenig später wird Mitchells Geldbörse bei einer Leiche gefunden.
Charlotte Justice kennt Robert „Cinque“ Lewis, das Mordopfer, sehr gut. Vor 14 Jahren hat er, einst ein Führer der militanten „Black Freedom Militia“ ihren Ehemann und ihr Kind umgebracht. Dann ist er untergetaucht und wurde niemals gefunden. Ist Justice dies nun gelungen, hat sie endlich Rache genommen? Hat ihr Dr. Mitchell dabei geholfen? Das sind Fragen, die Polizei, Staatsanwaltschaft und natürlich die Medien stellen. Justice wird in die Enge getrieben und muss mehr oder weniger heimlich in eigener Sache ermitteln. Dabei gerät sie einer Korruptionsaffäre auf die Spur. Die sie dabei zu enttarnen droht, schlagen brutal zu …
Ein niemals geschlossener Riss
Die Rodney King-Affäre ist längst Geschichte aber keineswegs vergessen oder gar vergeben. Nichts ist verwerflicher als eine mit großer Macht ausgestattete Institution, die ihre Privilegien missbraucht und die ihr Anvertrauen terrorisiert, statt sie zu schützen. Der 1992 in Los Angeles ausbrechende Sturm entfachte die größten Rassenunruhen seit den 1960er Jahren und strafte die Illusion der US-amerikanischen Idealgesellschaft wieder einmal Lügen.
Das ist die Kulisse, vor oder besser gesagt in der Paula L. Woods ihren Debütkrimi spielen lässt. „Alte Wunden heilen nicht“ ist der platte, wenn auch den Kern dieser Geschichte treffende deutsche Titel. Er lässt sich mehrfach deuten, erinnert an Charlotte Justices persönliches Drama ebenso wie an das schwierige Verhältnis zwischen weißen und schwarzen US-Amerikanern, das eher einem Waffenstillstand gleicht. Da wird – durchaus auf beiden Seiten – viel Groll gehegt, der in der Krise hässliche Folgen zeitigt. Für Schwermut – den „Inner City Blues“ des Originaltitels – gibt es deshalb Gründe genug.
Leider überwuchert er immer wieder die durchaus spannende Handlung. Die Alltagsarbeit einer Polizei in der Krise wird anschaulich, nüchtern (oder ernüchternd) dargestellt. Charlotte Justices Revier stellt sich als Hort und Schlangengrube dar, in der Ehrgeiz, üble Nachrede und Überarbeitung eine ungute Mischung eingehen.
Die alltägliche Diskriminierung überragt turmhoch das Geschehen. Jeder wache Moment im Leben eines schwarzen Menschen ist nach Woods ein Kampf gegen die Unterdrückung, die ‚weiße Welt‘ eine stetig sprudelnde Quelle kleiner und großer Kränkungen. Ist das die Realität? Aus der Entfernung und als nicht Betroffener ist es schwer zu beurteilen. Wie Woods es darstellt, liest es sich allerdings recht moritatenhaft.
Blindheit benötigt keine Farben
Sie forciert diesen Eindruck, indem sie Justices zahlreiche Familienangehörigen im Rückblick ständig an den Brennpunkten diverser Rassenunruhen seit ca. 1935 auftreten lässt. Statt Denkanstöße zu geben verärgert solcher Übereifer eher, auch wenn oder gerade weil er im Dienst einer guten Sache geschieht. (Es mag in diesem Fall aber auch daran liegen, dass der Justice-Clan nicht für diesen Krimi geschaffen wurde, sondern bereits 1992 in der Anthologie „Merry Christmas, Baby“ auftaucht, die sich um die Wahrung bzw. Schaffung einer „schwarzen“ Weihnachtstradition bemüht.)
Charlotte Justice wurde von ihren Eltern nicht vorsätzlich mit einem Namen bedacht, der ihr quasi den Status eines weiblichen Ritters für die Gerechtigkeit aufzwingt. Ihre Familie hätte niemals damit gerechnet, dass sie als schwarze Frau ausgerechnet zur Polizei geht: Vorurteile sind – notorische Weltverbesserer hören das nicht gern – durchaus kein rein weißes Privileg, wie uns am Beispiel der allzu ehrgeizigen Justice-Kollegin Cortez verdeutlicht wird, die weder von schwesterlicher noch von minderheitlicher Solidarität allzu viel hält.
Ständig lastet auf Charlotte der Druck, vorbildhaft ‚schwarz‘ zu sein, wobei keineswegs Einigkeit darüber herrscht, was das eigentlich bedeutet. Dass auch Schwarze nur Menschen sind, zeigt sich u. a. sehr deutlich an der Uneinigkeit, die innerhalb dieser ohnehin nur verschwommen zu differenzierenden Rassengruppen herrscht. Woods macht keinen Hehl daraus, dass die schwarze Bevölkerung von L. A. sich keineswegs grün (ein Kalauer, ich weiß) und einig im edlen Kampf gegen den diskriminierenden „Feind“ ist.
Übliche Zutaten für ein simples Rezept
Justice ist schließlich das beste Beispiel dafür. Die Arbeit als Kriminalistin ist für sie auch Therapie, nachdem sie ihre Familie durch Mord verlor. Eltern, Geschwister und Freunde sparen nicht mit Kritik an dieser Entscheidung. Besonders die ursprüngliche Familie Justice ist Hafen und Hölle zugleich: eine Blutsbande im buchstäblichen Sinn. Diese Interpretation würde Woods vermutlich missfallen. „Alte Wunden …“ endet mit einem kitschigen Grill- und „Hab‘-dich-lieb“-Treffen des Justice-Clans.
Verquickt mit der Handlung wurde – wie es heute fast schon üblich ist – eine gar komplizierte Liebesgeschichte. Justice trifft ihre Jugendliebe Dr. Aubrey Scott – eine Art Sidney Poitier-Verschnitt – wieder und schmachtet ihn erst aus sicherer Entfernung und dann offen an. Das liest sich genauso langweilig wie es in der Realität auf Unbeteiligte wirken würde: ein subjektives Urteil, das andere Leser (oder Leserinnen) möglicherweise nicht unterschreiben.
Die übrigen Darsteller: solide charakterisiertes Fußvolk, wie es jeder Krimi braucht: schluchzende, empörte, anklagende Angehörige; sarkastische, ausgebrannte Polizisten, publicitygeile Medienhaie usw. – wir kennen sie aus vielen, vielen TV-Krimis zur Genüge. Sie tragen ihren Teil zu diesem Kriminalroman bei, der mehr als Durchschnitt sein will aber nicht ist.
Autorin
Paula L. Woods (*1953), ist keine hauptberufliche Schriftstellerin, sondern leitet eine Beraterfirma in ihrer Heimatstadt Los Angeles, Kalifornien, die sie ab 1988 mit aufgebaut hat. Zuvor war sie Vizepräsidentin eines Pharmazieunternehmens, nachdem sie in der Verwaltung diverser Einrichtungen des Gesundheitswesens gearbeitet hatte. Noch heute sitzt sie in den Aufsichtsräten vieler Institutionen.
Daneben gibt es eine Paula L. Woods, die einen Universitätsabschluss in Englisch besitzt und sich für den Kriminalroman interessiert; dies zunächst akademisch: Woods ist die Verfasserin einer viel beachteten Geschichte des „schwarzen“ Krimis („Spooks, Spies, and Private Eyes“, 1995). Mit der für sie offenbar typischen Energie begann sie nach ausführlichen Recherchen zum Alltag der Polizei in Los Angeles mit der Niederschrift ihres ersten eigenen Romans. „Inner City Blues“ stand auf der Bestsellerliste der „Los Angeles Times“ und gewann den „Macavity Award for Best First Mystery“.
Taschenbuch: 432 Seiten
Originaltitel: Inner City Blues (New York : W. W. Norton & Company 1999)
Übersetzung: Christine Gaspard
http://www.droemer-knaur.de
Der Autor vergibt: