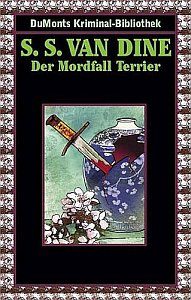
Das geschieht:
In seinem von innen verriegelten Schlaf- und Arbeitszimmer sitzt Archer Coe, der bekannte Sammler wertvoller chinesischer Keramik, mit einem Loch in der Schläfe, das von dem Revolver rührt, den er noch in der Hand hält. Eine klare Sache also, nur dass niemand, der Coe kannte, an einen Selbstmord denkt, denn der Verstorbene war ein Widerling, der zumindest das eigene Leben liebte. Familienangehörige (Brisbane Coe, Bruder; Hilda Lake, Nichte), Gäste (Raymond Wrede, Kunstliebhaber und Verlobter von Hilda; Eduardo Grassi, Fachmann für orientalische Altertümer) und Bedienstete (Butler Gamble; Koch Liang Tsung Wei) schurigelte er dagegen mit Behagen, und als Sammler war er dafür berüchtigt, andere Porzellanfreunde übers Ohr zu hauen.
Zumindest ein Rätsel löst sich, als Polizeiarzt Doremus die Leiche unter die Lupe nimmt: Coe wurde mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen, erstochen und erst anschließend ‚erschossen‘. Wie hat er es trotzdem geschafft, sich in seinem Raum einzuschließen? Ein Fall für Meisterdetektiv Philo Vance, den John F.-X. Markham, sein Studienfreund und nun Bezirksstaatsanwalt des Staates New York, sogleich heranzieht.
Vance sieht sich vor einige Rätsel gestellt, die sich sogleich vermehren. In einem Winkel des Hauses findet sich ein kleiner Scotchterrier, der von unbekannter Hand übel verletzt wurde. Woher kommt der Hund, denn im Coe-Haushalt sind Tiere nicht gestattet?
Zumindest ein Verdächtiger lässt sich bald ausschließen: In einem Garderobenschrank wird die Leiche von Brisbane Coe entdeckt, er wurde erdolcht wie sein Bruder. Die Mordinstrumente tauchen an eigentlich unmöglichen Stellen auf. Wieso ist eine kostbare Vase aus Archers Sammlung zerbrochen? Der Detektiv kommt nach Sichtung der Indizien zu dem Schluss, dass ein ausgeklügelter Mordplan schief gegangen ist und der in Panik geratene Mörder seither im Wettlauf mit der Polizei versucht, seine Spuren zu verwischen: ein Katz-und-Maus-Spiel, das Vance zu gewinnen gedenkt …
Verwirrung ist Trumpf
Der Mord im geschlossenen Raum ist heute ein Klischee, das die Mehrheit der Verfasser von Kriminalromanen tunlichst vermeidet. Als diese Idee erfunden wurde, kam sie freilich rasch in Mode und entwickelte sich zu einer Herausforderung, der sich die meisten Autoren des Genres mindestens einmal stellten. S. S. Van Dine tat es sogar mehrfach, denn er war ein entschlossener Repräsentant des ‚ehrlichen‘ Rätselkrimis. Wer war der Täter, wie hat er sein Verbrechen begangen? Dies waren Yin und Yang, um das seine Thriller kreisten.
Die Beweggründe des Täters wurden durchaus nicht ausgespart, aber die „Whodunit“-Frage stand im Vordergrund, seine gleichzeitig möglichst exotische wie ‚logische‘ Auflösung stand im Mittelpunkt des Finales, das von der Handlung vorbereitet wurde. „Mordakte Terrier“ bildet keine Ausnahme. Van Dine hat sich selten freiwillig einer solchen Herausforderung gestellt. Mit beinahe masochistischem Vergnügen verwirrt er die Fäden im Mordfall Coe so stark, dass man als Leser keinen Pfifferling mehr auf ein nachvollziehbares Entwirren setzen will. Nicht nur der unmögliche Mord im besagten Raum fordert Philo Vances Aufmerksamkeit. Auch außerhalb des Todeszimmers türmen sich die mysteriösen Indizien: zerschlagenes Geschirr, ein erstochener Bruder, ein halbtoter Hund …
Aber S. S. Van Dine kriegt im entscheidenden Moment die Kurve, auch wenn er dieses Mal nicht nur die übliche Skizze des Tatorts benötigt, sondern deren zwei, außerdem eine Zeichnung des Mordzimmerschlosses, das der Schurke fast zauberhaft von außen schließen konnte. Daran muss Van Dine lange getüftelt haben, aber das Ergebnis überzeugt.
Das gilt auch für die Geschichte selbst. Natürlich spielt sie sich quasi jenseits von Raum und Zeit in einem Märchenland ab, das in sich selbst ruht bzw. in einem Haus wohlhabender Nichtstuer spielt, deren Leben um eine Sammlung chinesischen Porzellans kreist. Die Polizei unterwirft sich dem Diktat eines Amateurs, das Schicksal übernimmt praktischerweise die Bestrafung des Täters. Realismus ist Van Dines Feind, sie sicherte ihm kurioserweise jedoch die Unsterblichkeit des Klassikers, denn heute sind seine Philo Vance-Thriller pure Nostalgie und Zeugen einer Epoche, in der „fair play“ im Kriminalroman mehr als eine Phrase war.
Bewundernswert klug aber unbeliebt
„Philo Vance / Needs a Kick in the Pants“ lästerte der Poet und Van-Dine-Zeitgenosse Ogden Nash in den späteren 1930er Jahren. Dies kündet eindringlich davon, dass Mr. Vance sich keiner ungeteilten Beliebtheit erfreute. Seine auf altem Geld & vornehmer Erziehung beruhende, altmodische Lässigkeit wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Schlimmer noch: Vance meint seine herablassende ‚Freundlichkeit‘ Ernst; er hält sich tatsächlich für etwas ‚Besseres‘ – und womöglich hat er Recht! Dies wurde ihm nicht verziehen, als die Weltwirtschaftskrise im Gefolge des „Schwarzen Freitags“ von 1929 die USA in einen wirtschaftlichen Abgrund stürzte und handfeste, ehrliche und hart arbeitende Männer auch den Kriminalroman eroberten.
Doch Philo Vance blieb sich treu und schwer erträglich selbst heute noch. Er ist von fast unerträglicher Gelehrsamkeit auch in den seltsamsten Fachgebieten, ein Dilettant in der positiven Bedeutung des Wortes, d. h. ein Mann, der sich viel Wissen erworben hat, ohne davon leben zu müssen. Deshalb hatte Vance es niemals nötig, sich diplomatisch zu verhalten. Weniger kultivierte und ‚dumme‘ Menschen haben deshalb wenig zu lachen aber viel zu springen, wenn der Meister die Szene betritt.
Vance spielt meisterhaft auf dem Instrumentarium der Selbstverherrlichung. Ständig ergeht er sich bei den Ermittlungen in bedeutungsvollen Anspielungen, weigert sich aber diese auszuführen, bevor er sich ‚seiner‘ Sache wirklich sicher ist. Dabei merken wir genau, dass er schon deutlicher früher weiß, wie der Hase läuft, er aber abwartet, bis er ihn publikumswirksam aus seinem Hut ziehen kann. An solche Arroganz sollte sich der Leser also gewöhnen.
Nischen einer exotischen Vergangenheit
Die dummen Fragen stellt nicht Vances stummer Chronist S. S. Van Dine, der Verfasser, der angeblich auch der Chronist dieses Falles ist, sondern Staatsanwalt Markham. Er gibt sich zwar skeptisch, agiert aber nur geringfügig wenig selbstherrlich als sein Freund und Berater. Da Männer wie Sergeant Heath die Polizei vertreten, bringen wir dafür freilich Verständnis auf: Für die Exekutive des Staates New York Hier arbeiten offensichtlich nicht die geistig fähigsten Vertreter der Gattung Mensch.
Was wiederum gar nicht so weit entfernt ist von der historischen Realität. Um 1930 konnte man ganze Polizeireviere als Brutnester korrupter Haudraufs bezeichnen, die einer komplexen Ermittlung nicht gewachsen waren. Insofern wirkt Heath überzeugend, wenn er sogleich den „messerstechenden Ithaker“ oder das „schleichende Schlitzauge“ verhaften und unter Einsatz eines Gummischlauches ‚verhören‘ will. Rassismus und Diskriminierung sind an diesem Ort und zu dieser Zeit hässliche Alltags-Realität. Van Dine (dieses Mal ist der ‚richtige‘ Verfasser gemeint) kann sich ihrer politisch völlig korrekt bedienen; die (neue) Übersetzung hat dies erfreulicherweise nicht vertuscht. Für Nostalgie gilt es manchmal einen Preis zu zahlen!
Andererseits hat sich Van Dine nicht dazu herabgelassen, sämtliche zeitgenössischen Klischees zu bedienen. Sein Liang Tsung Wei ist kein radebrechender „Chink“, sondern ein belesener, kultivierter Mann, den gut nachvollziehbare Vorsicht zu seiner Zurückhaltung in einem Land veranlasst, das den ‚Fremden‘ nur als Dienstboten schätzt. Auch Eduardo Grassi ist kein grimassierender, schleimiger italienischer Frauenhand-Küsser, wie ihn die US-Amerikaner noch heute gern (gutmütig?) belachen, sondern ein Gentleman mit nicht ganz kompatiblen, aber ausgeprägten Manieren, der unschuldig ist und schließlich sogar eine gute amerikanische Maid heiraten darf, wenn Philo Vance die verworrenen, einander widersprechenden Spuren schließlich auf üblich geniale und unterhaltsame Weise zusammengeführt und den Fall gelöst hat.
Autor
S. S. Van Dine wurde als Willard Huntington Wright am 15. Oktober 1888 in Charlottesville, Virginia, geboren. Er besuchte diverse Colleges und schließlich die renommierte Harvard University. Dort wurde er als bester Student in den Fächern Anthropologie und Ethnologie ausgezeichnet. 1907 wechselte Wright in die Literaturredaktion der „Los Angeles Times“ und schrieb Kritiken zu Büchern und Theaterstücken. Ab 1915 arbeitete Wright als Kunst- und Musikkritiker. Daneben verfasste Wright eine Reihe von Büchern über Kunst, Literatur und Musik, die in Fachkreisen als Standardwerke galten. 1916 entstand auch ein erster Roman.
1925 wurde Wright krank. Zwei Jahre ans Bett gefesselt, vertiefte er sich in das Studium sämtlicher bis dato erschienener Kriminalromane. Was er las, missfiel ihm meist, und er beschloss, dem Genre höchstpersönlich Logik und Klasse einzuhauchen. Diese Fassung der Wrightschen Biografie wird immer noch gern nacherzählt; die Wahrheit ist profaner: Der gelehrte Mann war seiner Leidenschaft für Alkohol und Drogen erlegen und darüber arbeitslos und pleite geworden.
„The Benson Murder Case“ (dt. „Der Mordfall Benson“) markiert den Auftritt des reichen, unabhängigen, hochintelligenten Privatgelehrten und Amateurdetektivs Philo Vance. Um seine wissenschaftliche Reputation zu schützen – so streng waren die Sitten einst – wählte Wright vorsichtshalber ein Pseudonym als Verfassernamen: Van Dyne war der Name seiner Großmutter mütterlicherseits.
Philo Vance schlug buchstäblich ein. Binnen kurzer Zeit war Wright finanziell saniert und konnte im Luxus leben wie sein Detektiv. Er hütete zunächst seine Identität, die schließlich doch gelüftet wurde, als Wright sich literaturwissenschaftlich auch dem Krimi widmete und u. a. Gebote für seine schreibenden Kollegen formulierte, die sämtlich einen nachvollziehbaren Plot einforderten.
Wright schrieb insgesamt zwölf Philo Vance-Romane, die sämtlich verfilmt wurden. Auch für das Radio wurden sie bearbeitet. Seinen Reichtum genoss Wright in vollen Zügen. Als er am 11. April 1939 in New York City an einem Herzanfall starb, belief sich sein Erbe auf gerade noch 13.000 Dollar.
Taschenbuch: 271 Seiten
Originaltitel: The Kennel Murder Case (New York : Charles Scribner’s Sons 1933)
Übersetzung: Manfred Allié
http://www.dumont-buchverlag.de
Der Autor vergibt: 




