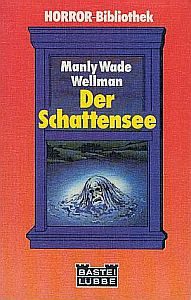
Das geschieht:
Sky Notch ist ein kleiner Flecken in den Appalachen, einem Mittelgebirge im Osten Nordamerikas. Knapp 250 Bürger führen ein beschauliches Leben abseits der modernen Hektik. Man kennt einander; dazu gehört, dass man die Eigenheiten des Nachbarn respektiert und keine neugierigen Fragen stellt. Abseits von Sky Notch und noch abgelegener auf einem Hügel liegt die Kolonie der „Kimber“, einer Sekte, die mit den Dorfbewohnern einen freundlichen aber distanzierten Umgang pflegt. Die Ankunft eines neuen Bürgers ist in Sky Notch eine Sensation. James Crispin, ein Kunstmaler, sucht die ländliche Ruhe, um neue Eindrücke zu sammeln. Von den Bürgern wird er gastlich empfangen, er fügt sich gut in diese Gemeinschaft ein.
Leider ist Crispin ein Betrüger. Er gehört zur menschlichen Vorhut einer Invasion, die Wesen aus einem fremden Universum planen. Eine Art Dimensionsriss hat sich ausgerechnet an dem Höhlensee gebildet, in dem die Kimber ihre rituellen ‚Taufen‘ zelebrieren. Die Fremden tragen schwere metallene Anzüge, die sie vor der für sie tödlichen Erdatmosphäre schützen. Sie sind auf die Unterstützung menschlicher Kollaborateure angewiesen, die sie mit der Zusicherung von Reichtum und Privilegien ködern. Notfalls greifen sie mit unheimlichen Waffen selbst ein.
Mark „Gander Eye“ Gentry aus Sky Notch lernt die ungebetenen Gäste zuerst kennen. Er ist es auch, der Verdacht schöpft, als James Crispin die Bürgern des Städtchens dazu überredet, gewisse Veränderungen zulassen und unterstützen: Sky Notch soll zu einer „Relaisstation“ ausgebaut werden, durch welche die Fremden in Scharen auf die Erde dringen wollen. Gentry plant den Widerstand, aber die Schattenwesen und ihre Verbündeten haben Sky Notch hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt. Wer nicht für sie ist, gilt als Feind und wird als solcher behandelt. Gewalt entlädt sich, als der Kampf um die Freiheit der Erde beginnt …
Kleine, harte aber heile Welt
Es gibt Bücher, die man nur liest, weil man unbedingt wissen möchte, wie sie enden – dies nicht, weil sie so spannend sind, sondern weil man fasziniert ist von einer irrwitzig wirren Handlung, von bohnenstrohdummen Figuren oder einem Schreibstil, der gegen jegliche Regeln der Unterhaltungsliteratur verstößt. „Der Schattensee“ gehört definitiv zu diesen Büchern. Dem Leser wird das leider erst recht spät klar, denn die Story beginnt verheißungsvoll. Sein Leben lang beschäftigte sich Manly Wade Wellman mit der Folklore der südlichen Vereinigten Staaten. Das dabei gewonnene Wissen ließ er in seine Geschichten einfließen, was ihnen Authentizität und eine überzeugende Hintergrundstimmung verlieh. So streut Wellman auch in „Der Schattensee“ u. a. Liedtexte ein, die Zusatzinformationen über Land & Leute vermitteln. Die Bewohner von Sky Notch wirken nie wie beschränkte Hillbillys, sondern sind sympathisch als leicht verschrobene, aber in sich und in ihrer kleinen Welt ruhende Individuen.
Die Geschichte selbst fängt einfach aber klassisch an. Wellman stellt Sky Notch und seine Bewohner vor; ganz ruhig führt er in die Handlung ein. Die mag nicht gerade komplex sein – Außerirdische greifen die Erde an und werden zurückgeschlagen –, aber dies ist noch kein Hinweis darauf, was der Autor aus der Ausgangsidee macht.
Trash as Trash Can
Nachdem Wellman zwei Drittel des Textes niedergeschrieben hatte, haben ihn anscheinend Inspiration und Interesse simultan verlassen. Anders lässt sich das Fiasko, das er nunmehr anrichtet, schwer erklären. Halten wir fest: Zwei Universen treffen in den Bergen von Sky Notch aufeinander. Ein Portal öffnet sich, fremde Wesen werden aufmerksam, ihnen gelingt der Übergang. Was wollen sie hier? Welchen Sinn macht es, die Erde zu erobern, auf der sie nicht leben können? Diese einfache aber kluge Frage stellt auch eine der Figuren. Die Antwort fällt unklar aus; demnach wollen die Wesen einfach die Menschheit unterjochen.
Dass sie scheitern, erscheint nur gerecht, da sie sich ausgesprochen dämlich anstellen. Sie können sich nur schwerfällig und in schwerer Panzerung in der giftigen Erdenluft bewegen. Ein Flintenschuss reicht aus, diesen Schutz zu durchlöchern, worauf die Wesen tot umfallen. Als menschliche Helfershelfer stellen sie ausschließlich kriminelle und/oder hirnschwache Strolche an. Das müssen sie auch, wie wir sogleich verstehen, wenn wir sie dabei beobachten, wie sie neue Söldner anheuern: Sie werfen ihnen Goldklumpen vor die Füße. Auf welche Weise sie anschließend präzise Anweisungen geben, darüber schweigt sich Wellman aus; in Sky Notch bleiben die Fremdlinge jedenfalls stumm.
So ist es wahrlich kein Wunder, dass die große Attacke auf die Erde auf uramerikanische Art mit einigen Bleikugeln abgewehrt wird. Auf der Strecke bleiben nicht nur die Außerirdischen, sondern auch Story und Leser, denn während die eine sich in Luft auflöst, bleiben die anderen verblüfft – und verärgert – zurück.
Loblied auf das einfache Leben
Das einfache Leben schafft zufriedene Menschen, und zufrieden bleiben sie, solange ihr Leben einfach bleibt – der perfekte Ringschluss oder die Quadratur des Kreises, den die Bürger von Sky Notch entdeckt haben, während die hektischen Stadtmenschen ihn weiterhin vergeblich suchen. „Gander Eye“ Gentry und seine Freunde haben es sogar versucht in der Fremde; sie sind nicht immun gegen die Verlockungen guten Lohns und lockerer Frauen. Doch die Luft ist schal, das Wasser schmeckt nicht, die Menschen jagen dem schnöden Dollar nach: Nein, am schönsten ist’s doch zu Haus, wo man sich einen Hirsch zum Mittagessen schießt und abends mit seinen Freunden uralte Volkslieder spielt und singt. Wie schon gesagt wirken Wellmans Figuren nicht lächerlich. Ihre Bedürfnisse sind einfach, doch sie sind keine fremdenfeindlichen Hinterwäldler. Selbst die Kimber entpuppen sich als religiöse Fundamentalisten, die fähig sind zu lernen und einzusehen, dass sie Fehler machen.
Mark Gentry und James Crispin bilden die beiden Hauptpersonen dieser Geschichte. Sie könnten Brüder sein, sie konkurrieren um dieselbe Frau, sie sind – ob als Musiker oder Maler – tief in der Kunst verwurzelt. Doch Crispin ist gleichzeitig Gentrys dunkles Spiegelbild, denn er hat seine Ideale verraten und sich kaufen lassen. Erst spät – und für ihn zu spät – kehrt er zu ihnen zurück und findet wenigstens seine Selbstachtung wieder.
Plan B nach Schema F
Profillos bleiben die Nebenfiguren. Da haben wir den weisen, alten Doktor, der in heikler Lage stets ein As aus dem Ärmel zu zaubern weiß, Gentrys fröhlich-unbedarfte Saufkumpane, den bauernschlauen Ladenbesitzer sowie selbstverständlich die Dorfschöne, die maßvoll emanzipiert ist doch vor allem nach Mr. Right sucht. Auf der anderen Seite steht Struwe, ein Bösewicht wie aus der Kinderstunde, der nicht Furcht verbreitet sondern lachhaft wirkt mit seinen Andeutungen und Drohungen, hinter denen letztlich nichts Konkretes steckt. Noch schlimmer sind seine (glücklicherweise nur kurz auftretenden) Spießgesellen, die mit hochmodernen Uzi-Maschinenpistolen durch Sky Notch schleichen und von Gander Eye Gentry mit seiner musealen Muskete über den Haufen geschossen werden.
So ist „Der Schattensee“ ein wenig zu deutlich das Werk eines Schriftsteller-Haudegens, der sein Handwerk in den Pulp-Magazinen der 1920er und 30er Jahre gelernt und wenig dazugelernt hat. „Der Schattensee“ entstand 1977, wirkt aber sehr viel älter bzw. altmodischer. Zum Klassiker ist dieser Roman nicht geadelt; die Chancen, dass dies noch geschehen wird, stehen schlecht. Insofern ist eine Lektüre interessant, wenn man das Paradebeispiel eines zu Recht vergessenen Buches kennen lernen möchte. Nur: Ist das eine Motivation, die unter den Lesern eine Mehrheit findet?
Autor
Manly Wade Wellman wurde am 21. Mai 1903 in Kamundongo geboren, das zu diesem Zeitpunkt zum portugiesischen Kolonialreich in Westafrika gehörte. (Heute liegt es in Angola.) Sein Vater war dort Missionsarzt, der Sohn verlebte eine faszinierende Kindheit, die viel Stoff für spätere Abenteuergeschichten bot. Wellmans Wanderlust blieb akut, nachdem er in den 1920er Jahren in die USA ging und dort Schule und College besuchte.
Beruflich wurde Wellman als Journalist tätig. Die Große Depression kostete ihn den Job; im Rahmen eines Arbeitsbeschaffungsprogramms wurde er in führender Position für das „New York Folklore Project“ tätig. Seit 1927 veröffentlichte Wellman phantastische Kurzgeschichten in den Pulp-Magazinen seiner Zeit. Darüber hinaus schrieb er Comics. Nach dem II. Weltkrieg zog es ihn mit seiner Familie in den Süden der USA, wo er seine folkloristischen Studien und seine schriftstellerische Arbeit fortsetzte. Bis ins hohe Alter blieb Wellman aktiv. Anfang 1986 verletzte er sich bei einem Sturz so unglücklich, dass er nicht mehr gesundete und am 5. April starb.
In sechs Jahrzehnten hatte er Romane und Storys in praktisch allen Genres der Unterhaltungsliteratur geschrieben. Die meisten Werke waren für den schnellen Konsum gedacht und können heute nicht mehr fesseln. Doch Wellmans Talent, sein historisches und folkloristisches Wissen zu nutzen, verband sich manchmal mit einem Stoff, der genau dies zum Tragen kommen ließ. 1946 gewann er den „Ellery Queen Mystery Magazine Award“ und deklassierte einen indignierten William Faulkner, der sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben musste. (Immerhin verlieh man ihm drei Jahre später einen Nobelpreis …)
Über M. W. Wellmans Leben und Werk informiert diese liebevoll aufgemachte und informative Website.
Taschenbuch: 188 Seiten
Originaltitel: The Beyonders (New York : Warner 1977)
Übersetzung: Eva Schwarz
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: 




