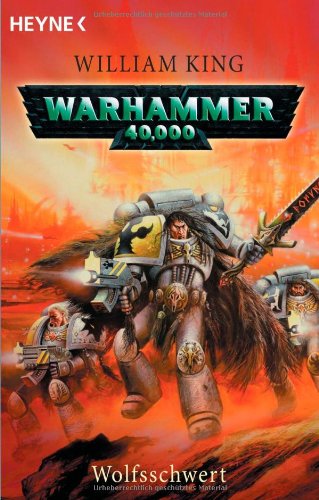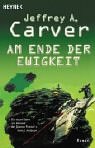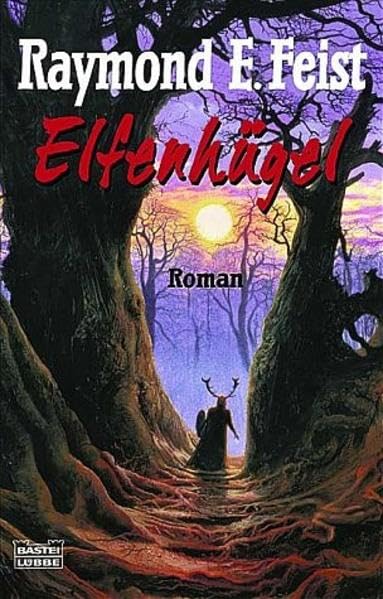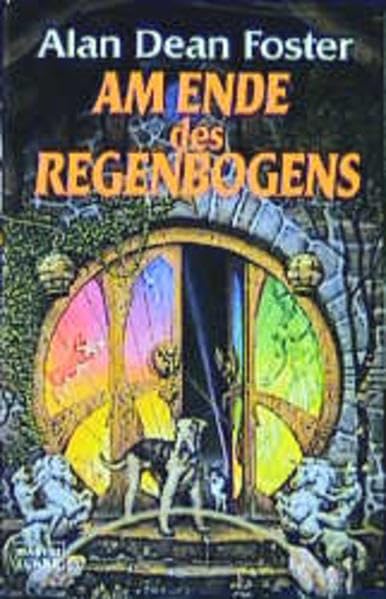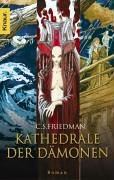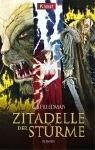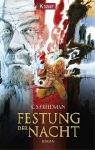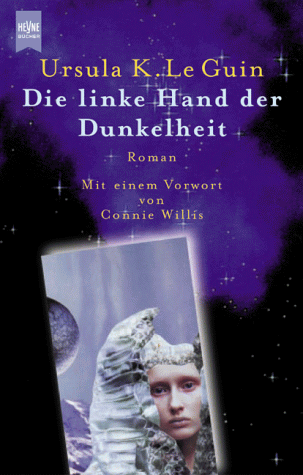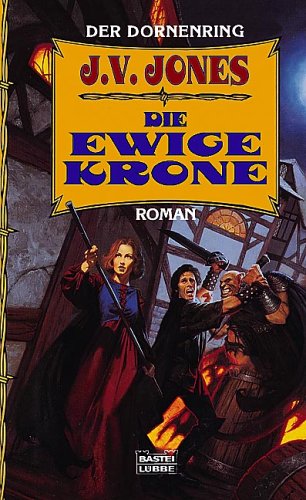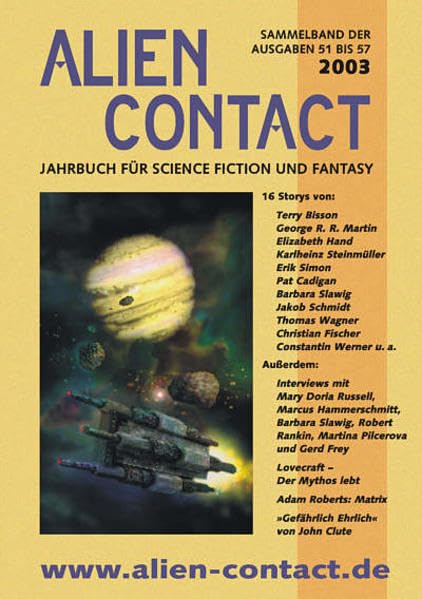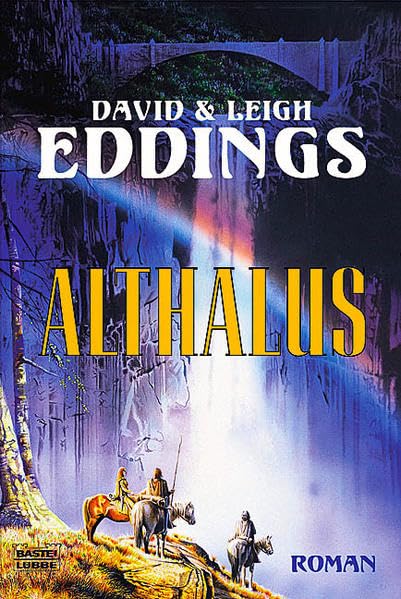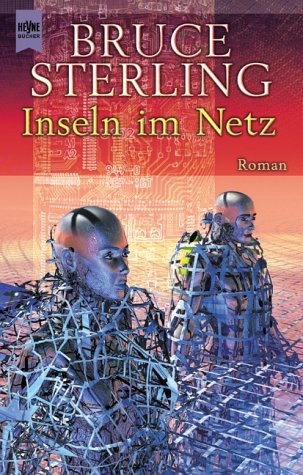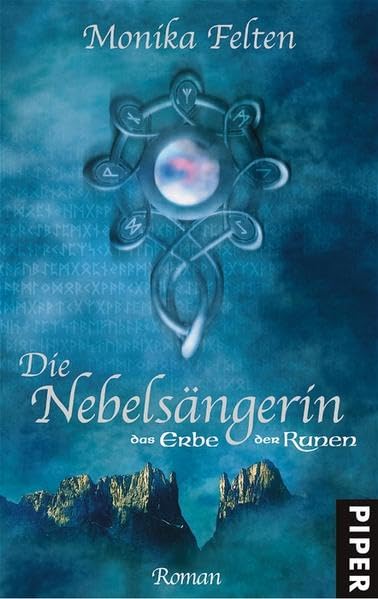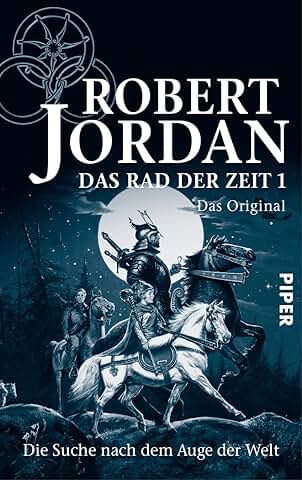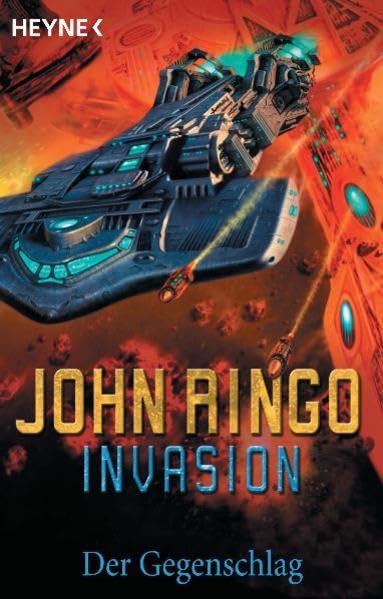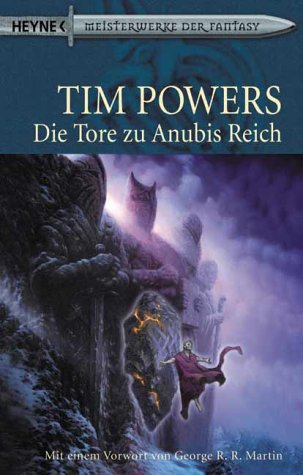Ragnar ist bei den Wolflords von Fenris in Ungnade gefallen, nachdem er im Kampf gegen Magnus, den Primarchen der Thousand Sons, den heiligen Speer des Russ eingebüßt hat. Dennoch erscheint die Strafe, die ihm auferlegt wird, im ersten Moment vergleichsweise milde: Er wird auf den Heimatplaneten der Menschheit, Terra, abkommandiert, um dort in den Reihen der Wolfsklingen dem Navigatorenhaus Belisarius, das durch jahrtausendealte Verträge eng mit dem Orden der Space Wolves verbunden ist, zu Diensten zu sein.
Doch wie so oft trügt der erste Anschein. Zwischen den Häusern Belisarius und Feracci herrscht seit langem ein Krieg, der im Verborgenen mit Verrat, Intrigen und Attentaten geführt wird. Während des Transits zum Heimatplaneten kann Ragnar im letzten Moment den Mord an Gabriella Belisarius verhindern und am Ziel seiner Reise – Terra – muss er erfahren, dass die Wiege der Menschheit in keiner Weise dem glorreichen und ruhmreichen Bild in den Erzählungen seines Ordens entspricht: Moralische Verkommenheit und Dekadenz auf der einen Seite und die gnadenlose Ausbeutung von Menschen in den ewig-dunklen und verseuchten Schluchten der Makropolen auf der anderen lassen die harten Bedingungen auf Fenris geradezu friedlich und paradiesisch erscheinen; die Clans der Space Marines werden von den normalen Bürgern gehasst und auch die Wolfsklingen, der zynische Torin und der fette Haegr, scheinen weit von den Idealen seines Ordens entfernt.
Als ein Auftrag sie gegen religiöse Fanatiker führt, erkennen die drei Marines, dass der Arm der Verräter weit in das verbündete Haus reicht und sie froh sein können, wenn sie mit dem Leben davonkommen. Angesichts einer Übermacht aus Hunderten Zeloten und einem mächtigen Psioniker, bleibt ihnen nur die Flucht auf die untersten Ebenen der Makropole und die Hoffnung, dass es ihnen gelingen wird, sich an die Oberfläche zurückzukämpfen. Angewiesen auf die Hilfe von Menschen, die ihnen misstrauen, und verfolgt von zahllosen Feinden beginnen sie ihren Aufstieg, während sich oben die Schlinge um den Hals der Celestarchin Lady Juliana Belisarius immer weiter zusammenzieht.
Einmal mehr beweist King, dass er sein Handwerk beherrscht und in der Lage ist, sowohl das komplexe WH40k-, als auch das WHFB-Universum zum Leben zu erwecken.
Die actionbetonte Handlung ist in gewohnt routinierter Art und Weise verfasst, Kings Schreibstil ist so gefällig und flüssig, dass der Leser gerne über kleine Schwächen in der Charakterisierung von Protagonisten und in der Dramaturgie hinwegsieht.
Haegr wirkt im wahrsten Sinne des Wortes überdimensioniert, seine obelixhaften Fressgelage vollkommen überzeichnet und selbst unter Berücksichtigung der außerordentlichen Space-Marine-Physiologie unglaubwürdig. Die Wortgefechte mit Torin sind zwar anfangs unterhaltsam, stellen aber mit Fortgang des Romans den Leser mehr und mehr auf die Geduldsprobe.
Etwas größeren Augenmerk hätte King auf den geheimnisvollen, übermenschlichen Assassinen Xenothan und dessen Verbindungen zur Inquisition richten können; hier verschenkt er einiges an Potenzial und vergibt die Möglichkeit, einen starken Antagonisten aufzubauen.
Dafür gewinnt Ragnar im Vergleich zu den ersten Romanen durchaus an Tiefe, wächst in seiner Auseinandersetzung mit dem bis ins Mark korrupten System Terras und der menschenverachtenden und intriganten Politik sowohl der Navigatorenhäuser im Besonderen, als auch des Imperiums im Allgemeinen. Selbst wenn er nach wie vor treu seinen mörderischen Dienst leistet, so beginnt doch der Zweifel in seinem Herzen zu nagen. Der Autor umschreibt diesen Sachverhalt sehr gelungen mit „Sünde der Relativierung“, wonach es keine per se wertvolleren Menschen gibt und die Leistung des Individuums immer im Kontext seines Umfeldes beurteilt werden muss. Ein kleiner Untersekretär der dritten Klasse in der Imperialen Fabrik Nummer sechs wäre demnach ebenso viel „wert“ wie ein Space-Marine-Veteran. Und diese Erkenntnis steht im fundamentalen Widerspruch zur grundsätzlich faschistischen Ideologie nicht nur der Space Wolves, sondern aller Orden.
Hinsichtlich der Dramaturgie scheint es im ersten Moment bedauerlich, dass der Ausgang des Konfliktes teilweise dadurch vorweggenommen wird, dass die eigentliche Geschichte eine Rückblende, eine Erinnerung Ragnars ist und die ursprüngliche Zeitebene des Prologs in einer unbestimmten Zukunft liegt. Andererseits bediente sich King schon in seinen ersten drei Ragnar-Romanen dieses nicht-linearen Konstruktionsprinzips, trägt also hier nur dem einheitlichen Erscheinungsbild der Reihe Rechnung. Und letztendlich verliert dieser Aspekt angesichts der mitreißenden Action und fesselnden Atmosphäre ohnehin an Bedeutung, weil es King mühelos gelingt, den dystopischen Charakter des Warhammer-40k-Szenarions einzufangen. Zwar reizt er nicht den zentralen Aspekt der Geschichte – die Intrigen zwischen den Navigatorenhäusern – bis in den letzten Dialog und die kleinste Szene aus, dennoch ist sich der Leser auf Grund einiger geschickt gesetzter Akzente der moralischen Verderbtheit jederzeit bewusst. Auch in der Schilderung der unmenschlichen Lebensbedingungen auf den unteren Ebenen beweist er genügend Augenmaß, um den Leser nicht mit einer Aneinanderreihung beschreibender Passagen zu langweilen, sodass dieser mit „Wolfsschwert“ einen zwischen Action und Stimmung sehr gut ausbalancierten Roman in den Händen hält.
Etwas, wofür nicht der Autor verantwortlich zeichnet, ist das schlechte Coverbild von Geoff Taylor. Daran, dass die Gestaltung der neueren Warhammer-40k-Romane grundsätzlich keine künstlerische Offenbarung darstellt, hat man sich ja schon gewöhnt, dieses Machwerk jedoch stellt alles bisher Gesehene in den Schatten: schlampige Ausführung, ohne Sinn für Perspektive, Proportionen und dynamisches Posing, sowie ein völliges Versagen in der Gestaltung von Gesichtszügen. Das ist insofern schade, als dieses stereotype, schlecht gearbeitete Bild durchaus potenzielle Leser vom Kauf eines unterhaltsamen Buches abschrecken könnte.
Fazit: Eine atmosphärisch dichter, temporeicher Warhammer-40.000-Roman, der sich in seinen düsteren Abschnitten durchaus mit den großartigen WH40k-Büchern Ian Watsons messen kann, der allerdings auch gute Kenntnisse des allgemeinen WH-Backgrounds voraussetzt.
|Originaltitel: Wolfblade
Übersetzer: Christian Jentzsch|
_Frank Drehmel_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/ veröffentlicht.|