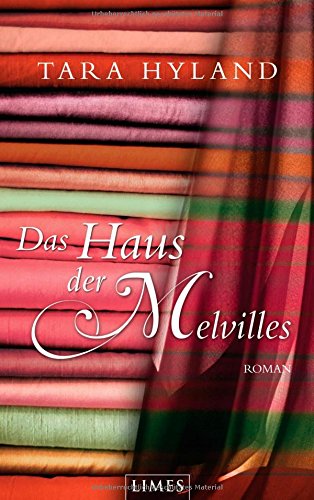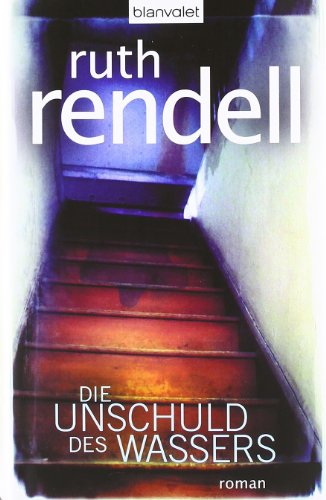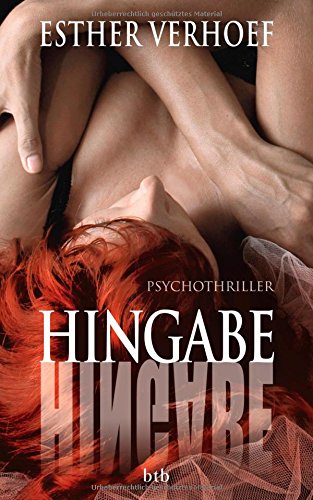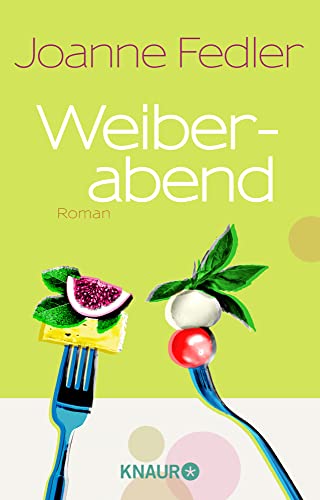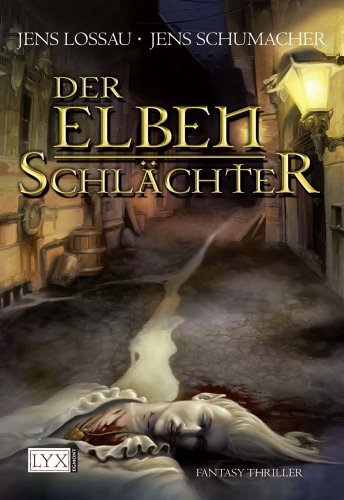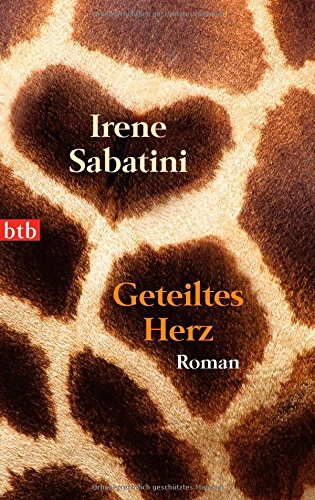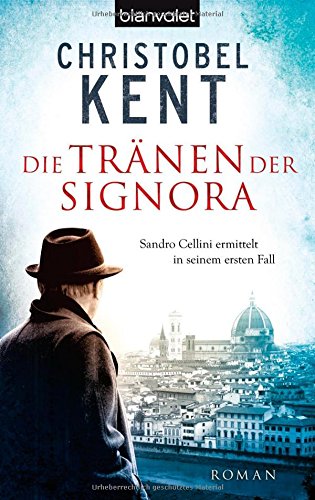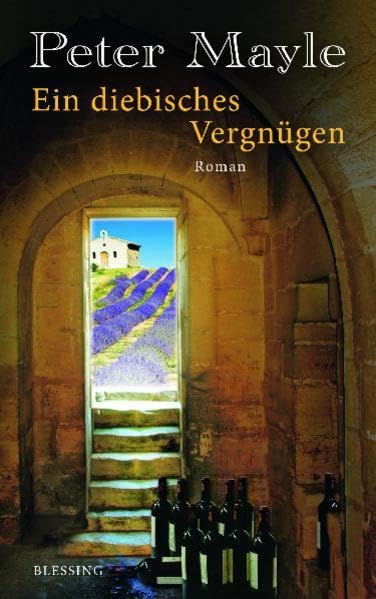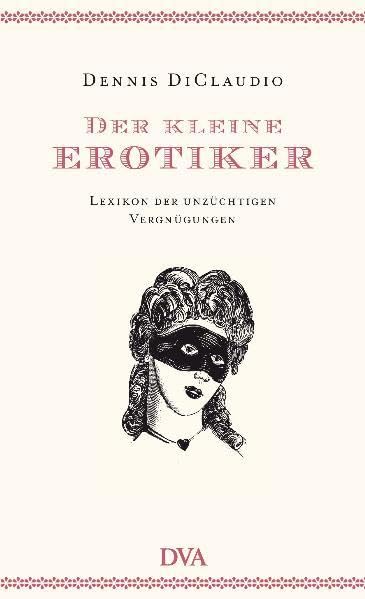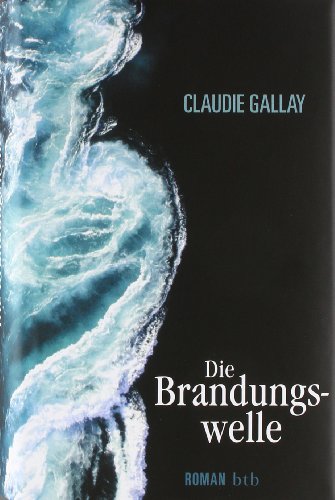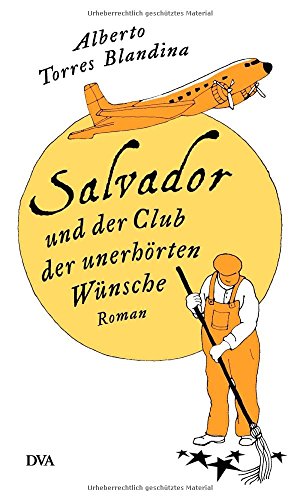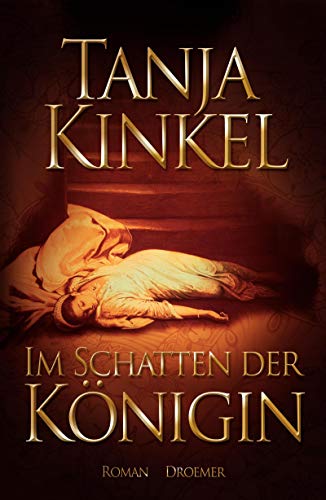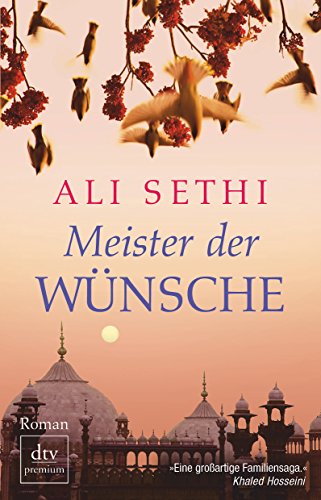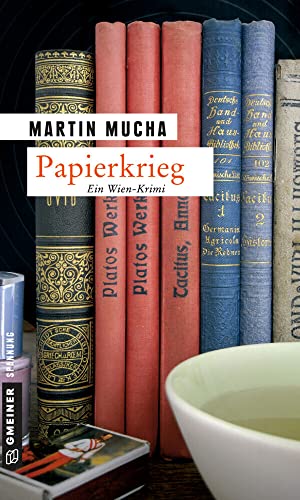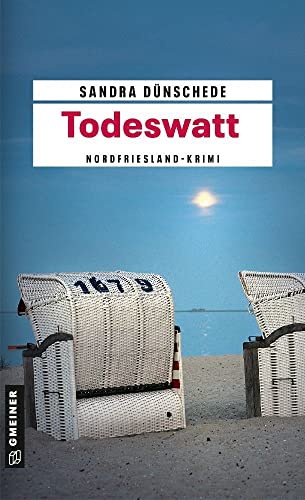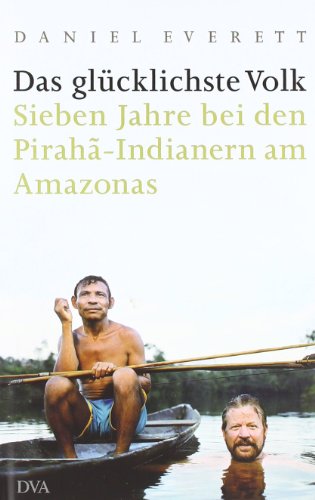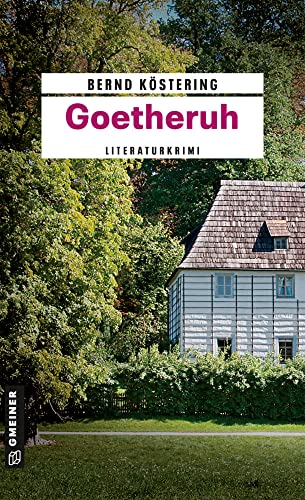_Inhalt_
Die junge Irin Katie O’Dwyer ist glücklich, einen Job als Verkäuferin in dem mondänen Modehaus Melville bekommen zu haben – doch sie kann nicht ahnen, dass diese Arbeit ihr Leben für immer verändern wird: Sie lernt den Besitzer William Melville kennen und lieben. Und obwohl sie genau weiß, dass eine Affäre mit einem verheirateten Mann und Familienvater für sie nur schlecht ausgehen kann, kann sie dem Charisma Williams nicht widerstehen.
Das erwartete Ende folgt auf dem Fuße. Schwanger und einsam kehrt Katie nach Irland zurück, um ihr Kind allein aufzuziehen. Anderthalb Jahrzehnte später ist sie tot und hinterlässt eine fünfzehnjährige Tochter, die noch völlig traumatisiert von ihrem unbekannten Vater nach London geholt wird: In ein fremdes, großes Haus, zu einer fremden Frau, zu zwei fremden Schwestern. Caitlin ist einsam, die drei Mädchen grundverschieden. Sie durchlaufen dieselbe Schulausbildung, doch dann werden die Weichen neu gestellt. Ihre Lebenswege ähneln sich kaum, wenn auch alle auf dem Weg zu ihrem jeweiligen Traum durch verschiedene Höhen und Tiefen müssen. Niemand hätte gedacht, dass sich die Wege aller Familienmitglieder später so schicksalhaft wieder kreuzen würden – und doch besteht eine unnennbare Verbundenheit zwischen den Melvilles, eine Bereitschaft zum Kampf Schulter an Schulter, mit der die Initiatoren einer niederen Intrige nicht gerechnet haben …
_Kritik_
Tara Hyland ist eine beachtliche Erzählerin. Sie schafft es, eindrückliche Bilder heraufzubeschwören, ohne bis ins letzte Detail zu beschreiben, so dass der Phantasie des Lesers genug Raum zur freien Entfaltung bleibt. Die Unterschiede in den Charakteren der drei Mädchen sind reizvoll, vor allem, weil sie alle drei letztendlich eines verbindet: Die Suche nach Anerkennung und Liebe. Dass die fast krankhaft ehrgeizige Elizabeth, die zutiefst verkorkste, kreative Caitlin und die leichtfertige Grenzgängerin Amber sich gänzlich verschiedene Wege zum Glück suchen, ist folgerichtig und meist auch nachvollziehbar dargestellt. Und wenn man doch mal über eine Entscheidung der Charaktere stolpern sollte, dann macht das nichts, denn die Geschichte spült die Zweifel schnell wieder fort: Es geschieht nur, was geschehen muss.
Dass das Böse sich mit freundlichem Gesicht nähert, ähnlich natürlich präsent ist wie die Schlange im Garten Eden, erklärt das Vertrauen, mit dem alle annehmen, dass es keine Bedrohung am Horizont gibt außer den ganz persönlichen Sorgen und Ängsten, von denen ja auch jeder sein Bündel zu tragen hat. Dass die Geschichte der Melvilles sich vor dem Hintergrund des riesigen, mondänen, gefährdeten Modeunternehmens abspielt, macht die Familiengeschichte noch reizvoller. Hier gibt es Nischen für jeden und unzählige Ausgangspunkte für neue Seitenarme der Saga.
Schließlich und endlich bleibt zu sagen, dass Tara Hyland sich eines angemessenen Stils bedient: Sie erzählt sicher und sauber, ohne in wilde Wortakrobatik oder in Slang zu verfallen; ihr Schreibstil ist das perfekte Gerüst für einen spannenden, romantischen, schrecklichen, schönen Sommerschmöker.
_Fazit_
Es gibt keinen Grund, aus dem man „Das Haus der Melvilles“ nicht lesen sollte. Hier vereinen sich Spannung, Skandale, Tragödien, Romanzen, Enttäuschungen, wilde Entschlossenheit, Hoffnung, Tränen, Familienbande und -zwistigkeiten sowie wirklich hinreißende Beschreibungen von Kleidern (Hallo, Mädels!) zu einer perfekten Erzählung für den Strand. Oder wahlweise die kuschelige Wolldecke auf dem Sofa, wenn der Sommer sich von seiner regnerischen Seite zeigt.
Ich wage zu prophezeien, dass wir von Tara Hyland noch länger hören werden. Sie hat das Talent, in epischer Breite zu erzählen, ohne langatmig zu werden oder in endlose Introspektionen zu verfallen. Man darf gespannt sein, ob ihre nächsten Ideen wieder so viele ausgefeilte Charaktere beinhalten werden, denn das Imperium, das sie mit der Melville-Firma und der Familie erschaffen hat, ist schon von beträchtlicher Größe. Hut ab!
|Gebundene Ausgabe: 608 Seiten
Originaltitel: Daughters of Fortune (01)
Aus dem Englischen von Christoph Göhler
ISBN-13: 978-3809025825|
[www.randomhouse.de/limes]http://www.randomhouse.de/limes
[www.tarahyland.com]http://www.tarahyland.com