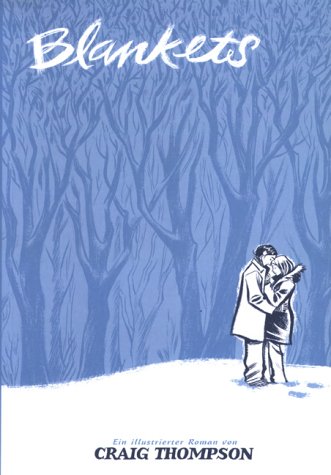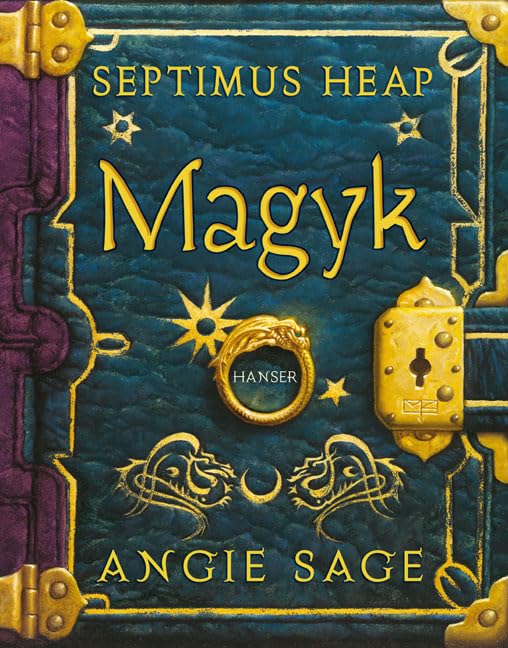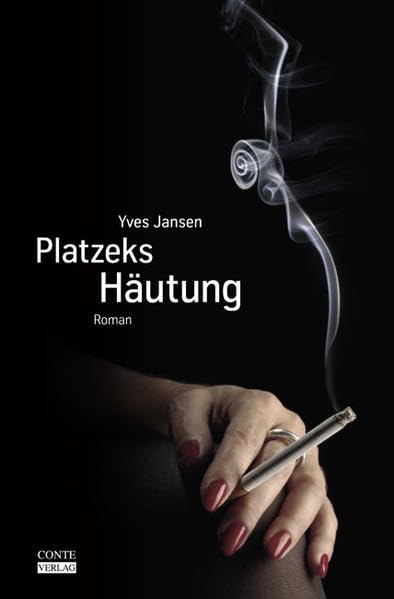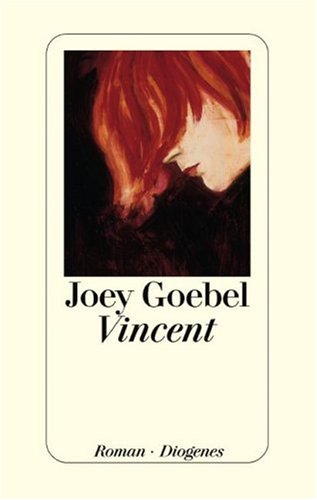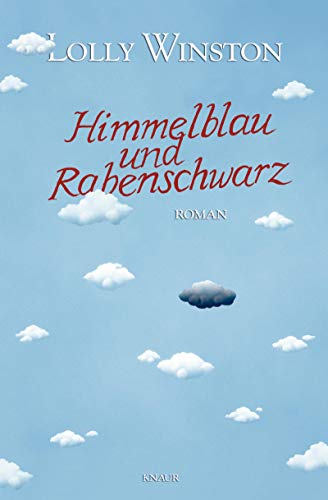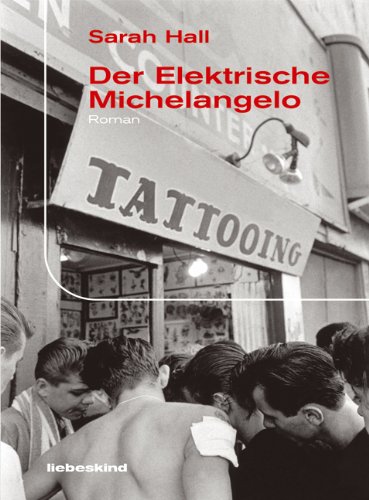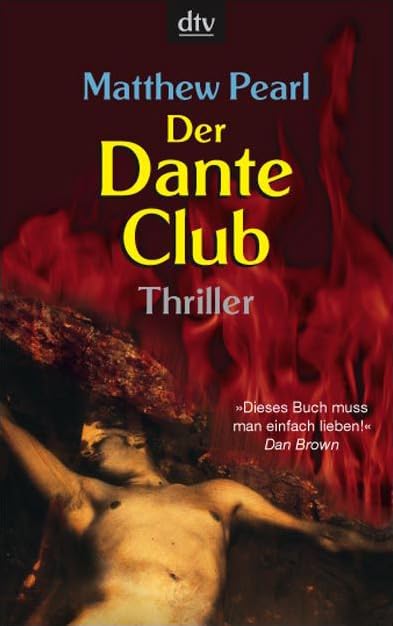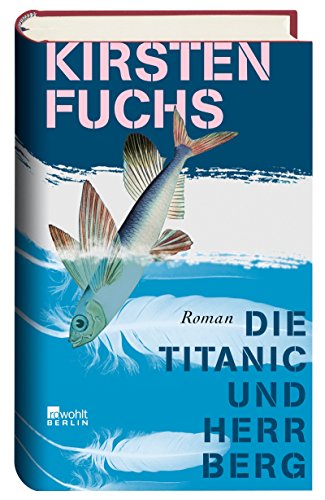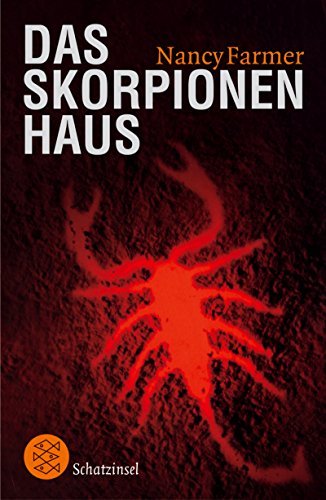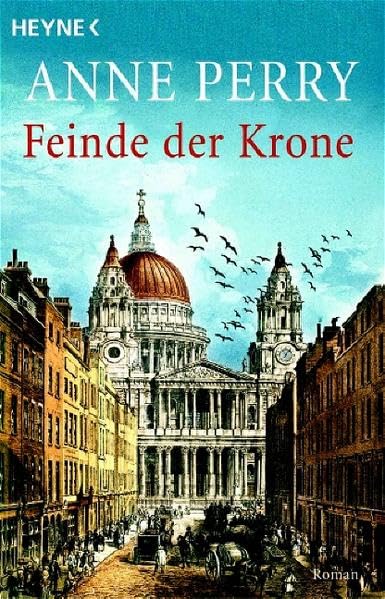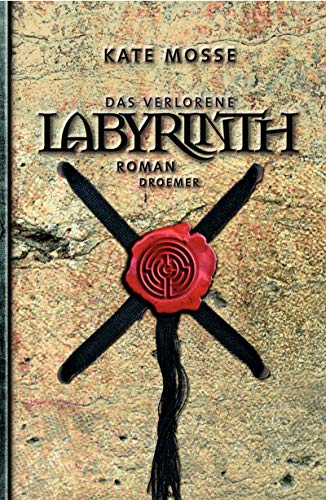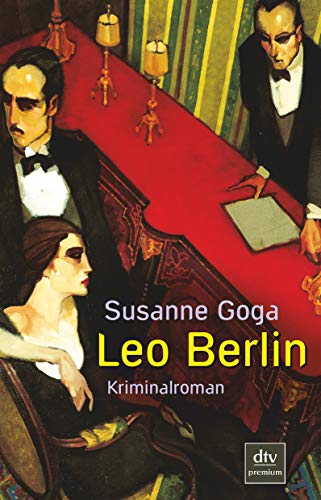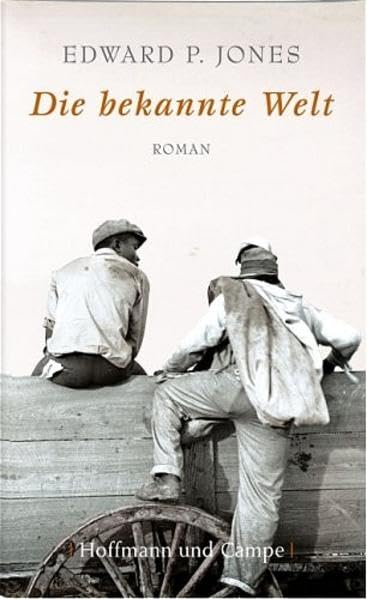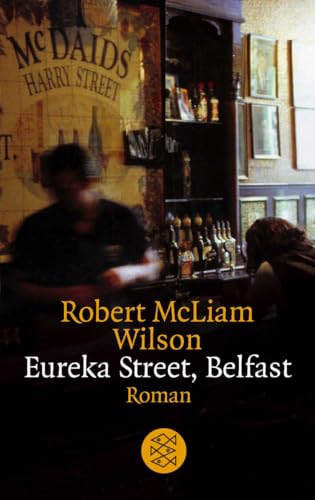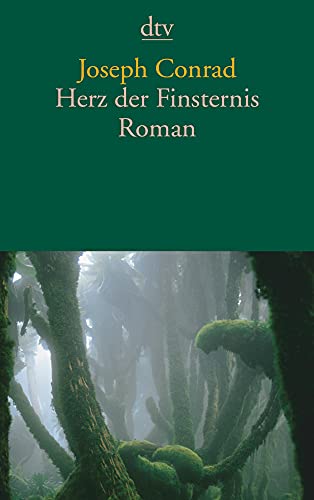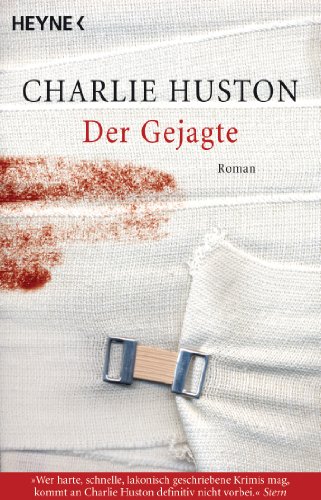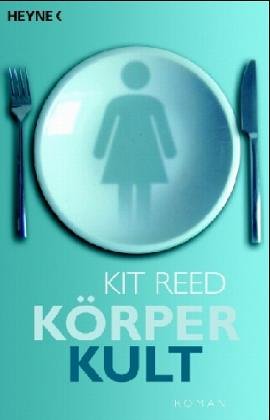Smells like teen spirit – „Blankets“ ist eine autobiographisch gefärbte Geschichte. Craig Thompson wurde 1975 geboren und erzählt seine Jugendgeschichte in Wisconsin, Anfang der 90er Jahre. Es ist die Zeit von |Nirvana|, die Zeit der ersten Partys, die Zeit des ersten Joints und der ersten Liebe. Doch an Craig zieht vieles davon mehr oder weniger spurlos vorbei. Er scheint ein Mensch ohne rechte Leidenschaft zu sein. Er ist ein Außenseiter, der sich stets zurückzieht und in irgendeiner Ecke auf seinem Notizblock vor sich hinzeichnet, während seine Mitschüler sich mal wieder über seinen Haarschnitt lustig machen.
Craig hat keine Freunde und auch das Leben in seinem Elternhaus ist nicht wirklich die reinste Freude. Die Thompsons sind strenggläubige Christen und spätestens seit der Ära George W. Bush weiß man auch hierzulande, wie man sich strenggläubige Christen im Mittleren Westen der USA vorzustellen hat. Craig und sein Bruder Phil werden christlich-fundamentalistisch erzogen (Gewalt ist okay, aber Sex ist böse!).
Craigs Kindheit ist keine leichte, aber er macht niemandem einen Vorwurf dafür. „Für meine Familie, in Liebe“ steht als Widmung auf der ersten Seite. Eine Widmung, die einen seltsamen Kontrast zu den Szenen aus Craigs Kindheit bildet. Durch die Intensität der Zeichnungen und die bildhafte Art Gefühle darzustellen, wirkt Craigs Kindheit besonders bedrückend und trist. Craig steht schon in jungen Jahren mehr oder weniger am Rand, kann sich weder zu Hause noch in der Schule wirklich heimisch fühlen und flüchtet sich in seine Träume. Gemäß seiner christlichen Erziehung hat Craig schon in jungen Jahren mit seinem Leben mehr oder weniger abgeschlossen und hofft stattdessen darauf, dass im Himmel alles besser wird.
Als ein winterliches (natürlich christliches) Ferienlager ansteht, ist die Situation wieder die Gleiche: Craig bleibt außen vor, steht als Beobachter abseits, während die anderen Snowboarden und Sprüche über ihre Fortschritte beim weiblichen Geschlecht klopfen. Und doch wird in diesem Ferienlager alles anders für Craig. Er, der Außenseiter, trifft andere Außenseiter und ist zum ersten Mal in seinem Leben nicht allein. Und dann wäre da noch Raina aus Michigan. Sie sorgt für einige Turbulenzen in Craigs ansonsten so unspektakulären Leben. Sie verbringen viel Zeit zusammen, funken offensichtlich auf einer Wellenlänge und bleiben auch über das Ferienlager hinaus in Kontakt. Zwischen dem schüchternen Craig und der bezaubernden Raina entstehen die zarten Bande einer tiefen Freundschaft, die auch über die Distanz zwischen Wisconsin und Michigan Bestand hat.
Als dann Craigs Eltern auch noch wundersamerweise erlauben, dass er Raina in Michigan besucht, beginnen die zwei schönsten Wochen seines bisherigen Lebens. Raina weckt ungeahnte Gefühle in Craig und die zwei Wochen im verschneiten Michigan sind wie einer der Träume, die er immer gehegt hat. Doch auch die zwei Wochen sind irgendwann vorbei und Craig muss wieder zurück in das provinzielle Wisconsin …
Die Geschichte einer ersten Liebe, die mehr erahnt, als wirklich ausgelebt wird, vor dem Hintergrund einer christlich-fundamentalistisch geprägten Erziehung in der tiefsten amerikanischen Provinz – das ist der Kern von „Blankets“. Thompsons Zeichnungen stecken so voller Leben, die Geschichte wird so ehrlich und offen erzählt, dass man sie mehr fühlt als liest. „Blankets“ geht einem wirklich nah, und das schon nach wenigen Seiten. Kein Wunder, dass Thompson für sein Werk schon so manchen Kritikerpreis abstauben konnte. Jüngst folgte im Rahmen der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt die Auszeichnung als Comic des Jahres – völlig verdient, denn „Blankets“ dürfte eine der wichtigsten Underground-Comic-Veröffentlichungen des letzten Jahres sein.
Und das obwohl (oder gerade weil?) der Comic dem Äußeren nach recht schlicht gehalten ist. Einfache, skizzenhafte Schwarz/Weiß-Zeichnungen, wenig Text, teilweise großformatige Szenen, mal ganz realistisch, mal emotional und abstrakt. Thompson ist sicherlich einer der wenigen Comiczeichner, die mit ganz wenigen Strichen komplexe Emotionalitäten darstellen können, egal ob er seine Gefühle für Raina zeichnet oder sein Verhältnis zum christlichen Glauben visualisiert.
Thompsons Gespür für Bilder weiß zu fesseln, aber man muss es mit eigenen Augen gelesen/gesehen haben, um es wirklich zu begreifen. Ist man erst einmal eingetaucht in die Atmosphäre, die Geschichte, die Figuren, kommt man so schnell nicht mehr davon los. Und gerade weil Thompsons Zeichnungen so intensiv und ausdrucksstark sind, könnte man gleich vorne wieder anfangen zu lesen, wenn man am Ende angekommen ist. Man kommt von „Blankets“ einfach nicht los, so faszinierend intensiv ist die Welt, die Thompson mit so wenigen Strichen aus dem Hut zaubert.
Allein in der Textur der Striche tauchen bei „Blankets“ so facettenreiche Emotionen auf, eine so erstaunliche Tiefe, dass man nur staunen kann. Mal wirken die Bilder ganz weich und zärtlich, mal wütend und aggressiv und mal tieftraurig und unsicher. Schwarz/Weiß-Zeichnungen sind in der Beziehung wesentlich ausdrucksstärker und emotionsgeladener als die kolorierten Zeichnungen der Hochglanz-Comics vom Kiosk. Die Gesichter, die Thompson zeichnet, sind einfach und mit wenigen Strichen skizziert. Umso erstaunlicher, dass er es schafft, diese Gesichter so intensiv mit Emotionen auszustatten. Die Eigenarten und die Grundstimmung jeder Figur werden schon nach wenigen Szenen deutlich und nach ein paar Seiten sind sie einem richtiggehend vertraut.
Die Geschichte, da sie nun einmal als Comic erzählt wird, wirkt viel direkter und unmittelbarer und dadurch letztendlich auch nachhaltiger. Gerade als Medium für autobiographische Themen scheint sich der Comic außerordentlich gut zu eignen (weitere Beispiele wären „Maus“ oder „Barfuß durch Hiroshima“). Gefühle werden durch die Zeichnungen (besonders auch durch die für Underground-Comics oft typische, etwas skizzenhafte Darstellung) viel plastischer und besser bzw. schneller begreifbar. Der Comic stellt Dinge dar, die sich mit Worten nur schwer beschreiben oder erklären lassen. Er vereinfacht.
Was einem in der zeichnerischen Darstellung bei „Blankets“ einleuchtend und durch und durch nachvollziehbar erscheint, lässt sich, obwohl man genau spürt, was der Autor ausdrücken will, kaum adäquat mit Worten wiedergeben. Der Comic hat mit seiner visuellen Herangehensweise einen ganz anderen Ansatzpunkt beim Leser als ein Roman. Ein Umstand, der besonders auch bei „Blankets“ sehr deutlich wird und wohl der wichtigste Grund dafür ist, dass einem die Geschichte so nah geht. Als Roman erzählt, wäre sie vermutlich nicht halb so fesselnd. Daraus entsteht letztendlich eine scheinbare Widersprüchlichkeit: Der Comic vereinfacht einerseits, übermittelt andererseits aber komplexere Dinge, als man ihm zutraut – einfach, weil er direkter ist.
Die Geschichte selbst hat, abgesehen von Craigs Besuch bei Raina, einen eher episodenhaften Charakter. Thompson skizziert Bruchstücke seiner Kindheit, die zusammengesetzt ein Bild des Menschen zeichnen, der später im Ferienlager Raina kennen lernt. Auch die späteren Ereignisse werden eher episodenhaft dargestellt. Craigs Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder wird ebenso beleuchtet wie die Weiterentwicklung im Elternhaus. Auch Craigs Verhältnis zum christlichen Glauben wird immer wieder thematisiert und bildgewaltig dargestellt. Thompson erzählt die Geschichte als eine wirklich runde Sache. Man schlägt am Ende zufrieden, aber auch wehmütig das Buch zu. Anfangs- und Endpunkt, der gesamte Handlungsbogen – alles wirkt geradezu perfekt und bis ins Detail stimmig.
Dass seine Geschichte mit recht wenigen Worten auskommt, ist sicherlich auch seinem zeichnerischen Talent zuzuschreiben, aber dass die wenigen Worte, die er wählt, jedes Mal den Nagel auf den Kopf treffen und für jede Szene wie geschaffen sind, das offenbart auch ein gewisses Erzähltalent. Die Liebesgeschichte von Craig und Raina ist so erfrischend ehrlich und unkitschig erzählt, dass einem bei der Lektüre richtig warm ums Herz wird. Nichts wirkt überzeichnet oder gekünstelt, nichts wirkt aufgesetzt oder unpassend – man muss einfach glauben, dass die Geschichte bis ins kleinste Detail so und nicht anders passiert ist. Sie wirkt so offenherzig, frei von der Leber weg erzählt, dass man wirklich spüren kann, wie die erste Liebe sich anfühlt – mit dem Schmerz, der dazu gehört.
„Blankets“ bewegt nicht nur auf visueller, sondern auch auf erzählerischer Ebene. Die Geschichte geht einem nah, die Figuren wirken unglaublich lebensecht und Craig Thompson erzählt die Geschichte einer bedrückenden Kindheit und der ersten großen Liebe vor dem Hintergrund einer streng christlichen Erziehung offen, ehrlich und mit abgeklärtem Blick. Definitiv der beste Comic, den ich seit langem gelesen habe.
Ich halte nun wirklich nichts von übertriebener Lobhudelei, geize üblicherweise mit einer persönlichen Höchstwertung und hasse Empfehlungen, die Bücher als sogenannte „Pflichtlektüre“ abstempeln, aber in diesem Fall kann ich nur den Imperativ verwenden: UNBEDINGT LESEN!
Und das meine ich sogar ernst. Auch die vermeintlichen Comic-Hasser sind angesprochen! Eigentlich jeder, der Lust auf ein Buch randvoll mit großen, ehrlichen Gefühlen und die Muße, sich darauf einzulassen, hat …
|“Alles, was im Leben schief geht in dieser Geschichte von Familie und erster Liebe funktioniert als Kunstwerk tadellos. Mr. Thompson hält sich angenehm zurück, während er uns langsam mit seinem Können überwältigt. Seine Erzählkunst, sein Gespür für Worte, Bilder und beredtes Schweigen, fesselt beim Lesen und wirkt lange nach. So etwas nenne ich Literatur.“| Jules Feiffer (Pulitzer-Preisträger)
Leseproben unter [www.speedcomics.de]http://www.speedcomics.de