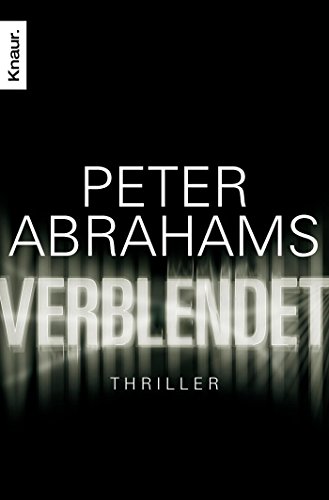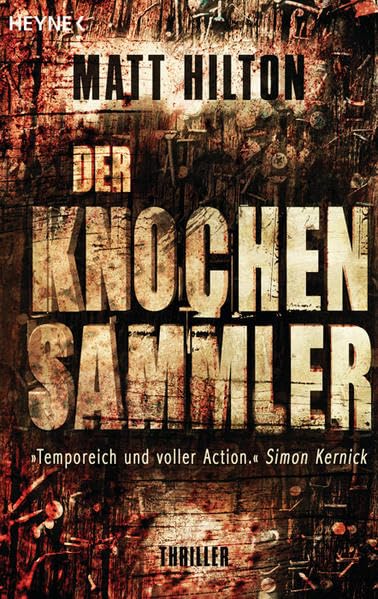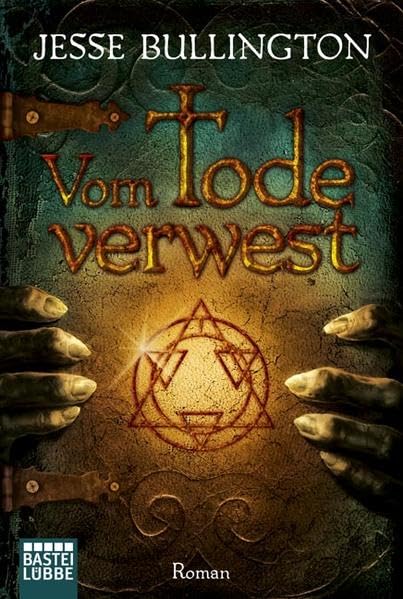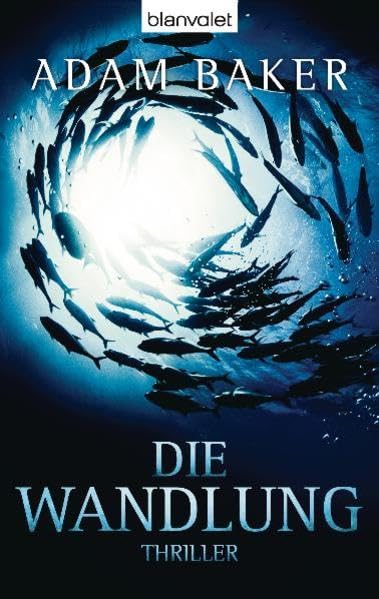_Das geschieht:_
Nur wenige Abgeordnete des englischen Parlamentes sind begütert genug, eine eigene Wohnung in London zu unterhalten, um während der Sitzungsperiode unterzukommen. Für die weniger privilegierten Mitglieder wurde deshalb das „Parliament Hostel“ erbaut – ein Gästehaus, das 500 Abgeordneten ein Dach über dem Kopf bietet. Das neue Gebäude ist der Stolz seines Architekten und eine Herausforderung für Hilda Langdale, die das „Parliament Hostel“ leiten wird und sich auf eine anspruchsvolle und anstrengende Klientel einstellen muss.
Mitte Oktober und zwei Wochen vor dem Ende der Parlamentsferien sind erst sechs Abgeordnete abgestiegen, die im Dachgeschoss untergebracht werden. Das gewaltige Dach ist flach und begehbar, was immer wieder unerlaubte Gäste lockt, die hier oben die Aussicht genießen. Es gehört zu den Pflichten des Hausdieners Robert Binsey, dies zu unterbinden. Dabei muss es dieses Mal zu einem Zwischenfall gekommen sein, denn ein Polizist findet Binseys zerschmetterte Leiche im Hinterhof des Gästehauses.
Chefinspektor Julian Rivers und Inspektor Lancing von Scotland Yard übernehmen den Fall. Die Untersuchung ergibt, dass Binsey bereits tot war, als er vom Dach geworfen wurde. Nicht nur das Personal, sondern auch sämtliche Gäste sind verdächtig und die Ermittlungen deshalb kompliziert, denn englische Abgeordnete genießen Sonderrechte und sind auch sonst recht empfindliche Zeitgenossen. Zudem lauert die Presse auf Sensationen, sodass Irrtümer die Polizei teuer zu stehen kämen.
Es ist klar, dass Binsey etwas gesehen hatte, dass er auf keinen Fall sehen oder weitererzählen sollte. Überhaupt wusste der aufmerksame und gedächtnisstarke Hausdiener nicht nur über die Gäste des „Parliament Hostel“ mehr, als denen lieb sein konnte, sodass der Kreis der Verdächtigen einfach nicht schrumpfen will …
_Der größte „locked room“ der Kriminalliteratur?_
Wer einen Krimi der Marke „Whodunit“ schreibt, achtet darauf, dass sein Schauplatz übersichtlich und das Figurenpersonal überschaubar bleibt. Auf diese Weise hält der Autor die Fäden so fest wie möglich in der Hand. Außerdem ist ein Mordrätsel reizvoller, wenn auch der Leser Ort und Personen im Blickfeld behalten kann. Zu guter Letzt verhindert die Isolation den Einsatz unfairer Handlungselemente: Das Rätsel muss innerhalb der vom Verfasser gezogenen Grenzen gelöst werden. Einmischung von außen ist unerwünscht.
Natürlich ist das auf diese Weise geschaffene Ambiente alles andere als innovativ. Genau dies stachelte zumindest die Ehrgeizigen unter den Kriminalautoren immer wieder an, die Regeln des „Whodunit“ auf die Probe zu stellen und neu zu interpretieren. Carol Carnac versucht es in „Mord im Gästehaus“, indem sie den weiterhin klassischen, weil eigentlich unmöglichen Mord nicht in einem allseits gesicherten Raum und hinter einer von innen verschlossenen Tür begehen lässt. Der Tatort ist ein fußballfeldgroßes Flachdach mit fünf Zugängen, und dieses Dach deckt ein Haus mit 500 Gästezimmern.
Obwohl das „Parliament Hostel“ damit zur denkbar zugänglichen Mordstätte wird, ist „Mord im Gästehaus“ zunächst ein typischer Rätselkrimi. Elementarer Teil der Handlung ist die systematische Bestandsaufnahme der theoretischen Täter, ihrer Motive und Möglichkeiten im Rahmen von Ermittlungen. Der Reiz besteht dabei in der Herausforderung, Haupt- und Nebeneingänge, Fahrstühle, Zimmerbelegungen u. ä. Faktoren in jenen ganz bestimmten Zusammenhang zu bringen, der den Mord auf dem Dach logisch erklärt.
|Ganz besondere Verdächtige|
Nachdem die Hälfte unserer Geschichte auf diese Weise verstrichen ist, bricht die Verfasserin plötzlich und vollständig mit der Isolation. Die aufwändig eingeführten Figuren rücken in den Hintergrund oder finden überhaupt keine Erwähnung mehr. Selbst das „Parliament Hostel“ spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. In den Mittelpunkt rücken stattdessen die Polizisten Rivers und Lancing. Aus dem „Whodunit“ wird ein „Police Procedural“, das sich allerdings sehr britisch, also unter Aussparung polizeilicher Privatangelegenheiten, abwickelt. Erstaunlicherweise geht dieses Konzept auf.
Der Mord im Gästehaus entpuppt sich als Glied in einer ganzen Kette von Verbrechen, in die das „Parliament Hostel“ nur zufällig eingehakt wurde. Carnac weitet die Handlung auf ganz London aus. Plötzlich geraten wir in die Ermittlungen gegen eine Bande von Posträubern, die irgendwie in den Mord an Binsey verwickelt sind. Das verbindende Element wird sehr geschickt aus der bekannten aber oft nicht berücksichtigten Wahrheit geknüpft, dass der Mensch in der Anonymität verschwindet, sobald er eine Uniform trägt.
Auf diese Weise wird der Perspektivensprung logisch erklärt, während die Handlung eine ebenfalls unerwartete Dynamik gewinnt. Über viele Seiten beschreibt Carnac die wilde Verfolgungsjagd auf einen fallrelevanten Lieferwagen. Diese führt in die Region um die Docks an der Themse, ein seit jeher gefährliches Pflaster und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs quasi sich selbst überlassen; eine Öde, die von vergessenen Pfaden, heimlichen Anlegestellen, verlassenen Unterständen, verschütteten Kellern und ähnlichen Schleichwegen und Schlupfwinkeln geprägt ist. Diese Umgebung verleiht dem Geschehen einen eigenen Reiz, zumal Carnac sehr ortskundig das Optimale aus diesen Schauplätzen herauszuholen in der Lage ist.
|Die Stützen des Systems|
Während die eigentümliche Mischung aus Rätselkrimi und Gauner-Thriller auch wegen der vielen seither verstrichenen Jahre ausgezeichnet funktioniert, hinterlässt die Figurenzeichnung einen zwiespältigen Eindruck. Lange scheint das übliche exzentrische, geradlinige, treuherzige Personal die Handlung zu tragen. Mit mildem Spott charakterisiert die Autorin zudem die Abgeordneten, die vielleicht parteipolitisch bitter verfeindet sind, sich aber ‚außer Dienst‘ gern auf einen Drink treffen. Es geht in diesem Jahr 1954 selbst in der Politik noch gemächlich zu, obwohl Carnac die moderne Gegenwart keineswegs ignoriert. Immer wieder geht sie auf die Veränderungen ein, die London nach dem II. Weltkrieg erfuhr, und schwelgt dabei keineswegs in den Klischees einer besseren, alten Zeit.
Ähnlich gemütlich gestalten sich die polizeilichen Ermittlungen. Rivers und Lancing scheinen über alle Zeit dieser Welt zu verfügen, um den Mord am Dienstmann Binsey aufzuklären. Zwischenzeitlich rückt die Polizei einmal aus, um einen Bandenstützpunkt auszuheben; dieses Unternehmen wirkt bei Carnac wie ein Einsatz der „Keystone Cops“, die im Hollywood der Stummfilmzeit für komödiantische Verwirrung sorgten. Immer bleibt ein ruhiges Stündchen für eine gute Mahlzeit und einen Schwatz, der thematisch natürlich streng auf den anstehenden Fall beschränkt bleibt.
Darüber hinaus präsentiert uns die Autorin einen bunten Reigen geistig leicht beschränkt wirkender Angehöriger der arbeitenden Schichten; hinzu kommen pittoreske Gestalten wie ein teilzeitbettelnder Vogelhändler oder ein ‚rasender Reporter‘, dessen ‚raffinierte‘ Methoden heute rührend antiquiert wirken. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich klaglos ins bestehende System einfügen, fleißig dafür arbeiten und die Obrigkeit vielleicht kritisieren aber nicht gegen sie aufbegehren.
|Der Untergang des Abendlandes|
Für die jüngeren Generationen sieht Carnac freilich schwarz. Zwar hält sie keinesfalls damit hinter dem Berg, dass in der Welt des 20. Jahrhunderts die Frau gleichberechtigt ist oder sein sollte. Dies verkörpern Figuren wie die altgediente Abgeordnete Seathwaite, die sich noch gut der Zeiten erinnert, als die Frauen noch gar nicht (bis 1919) oder nur eingeschränkt (bis 1928) wählen durften, oder den weiblichen Sergeanten Cartmel, deren Existenz verdeutlicht, dass selbst eherne Männerfesten wie Scotland Yard ins Wanken geraten sind.
Schlimm steht es dagegen um die Nachkriegsgeneration. Mit dem allmählichen wirtschaftlichen Aufschwung sieht sie nicht den Sinn ihres Lebens darin, den Eltern und Großeltern von der Wiege bis zur Bahre nachzueifern. Die Freizeit nimmt zu, mehr Geld steht zur Verfügung: Die Jugend geht eigene Wege und wird dabei von den Älteren misstrauisch beobachtet: Kontrolle geht über Vertrauen, Verständnis ist Schwäche. Lancing schildert seinem Kollegen einen dieser traurigen Fälle: |“Renwick ist in Ordnung, … aber die Tochter ist ein schlechtes Frauenzimmer und der Sohn ein Lümmel … Renwicks Unglück [ist], dass er nicht in der Lage war, sie alle zu verprügeln. Er war zu weich.“| (S. 129)
So bilden sich in quasi unausweichlicher Konsequenz Banden krimineller Halbstarker, die untätig herumlungern und das Empire schwächen. Oder wie |“Polizeimann Brown“| es zusammenfasst: |“Aber das ist die Technik dieser jungen Rowdies, die von Arbeitslosenunterstützung und Krankengeld leben. Die arbeiten ja nicht – sind nicht dafür gebaut, wie man so sagt. Der Gedanke allein schon macht mich wütend!“| (S. 146)
Dieser Tenor verdirbt ein wenig die Freude an einem sonst zu Unrecht vergessenen, weil dicht geplotteten, spannend geschriebenen und überraschend aufgelösten Kriminalroman. Man sollte freilich solche Töne (oder die kurios-steife Übersetzung, die durchweg von „Herrn X“, „Frau Y“ oder gar „Fräulein Z“ spricht) als zeitgenössischen O-Ton interessiert zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen, dass solche Vorurteile einen historischen Generationskonflikt belegen.
_Autorin_
Carol Carnac (1894-1958), geboren (bzw. verheiratet) als Edith Caroline Rivett-Carnac, muss man wohl zumindest hierzulande zu den vergessenen Autoren zählen. Dabei gehörte sie einst zwar nicht zu den immer wieder aufgelegten Königinnen (wie Agatha Christie oder Ngaio Marsh), aber doch zu den beliebten und gern gelesenen Prinzessinnen des Kriminalromans.
Spezialisiert hatte sich Lorac auf das damals wie heute beliebte Genre des (britischen) Landhaus-Thrillers, der Mord & Totschlag mit der traulichen Idylle einer versunkenen, scheinbar heilen Welt paart und daraus durchaus Funken schlägt, wenn Talent – nicht Ideen, denn beruhigende Eintönigkeit ist unabdingbar für einen gelungenen „Cozy“, wie diese Wattebausch-Krimis auch genannt werden – sich mit einem Sinn für verschrobene Charaktere paart.
|Taschenbuch: 224 Seiten
Originaltitel: Murder Among Members (London: Collins/The Crime Club 1955)
Übersetzung: Evelyn Neumann|
_Carol Camac bei |Buchwurm.info|:_
[„Der Tote im Feuer“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7541