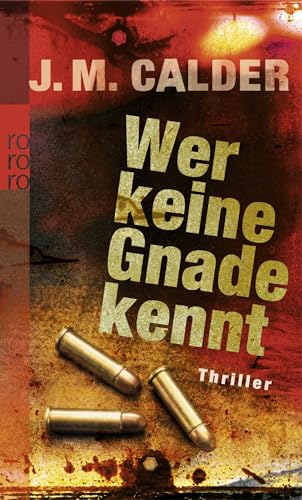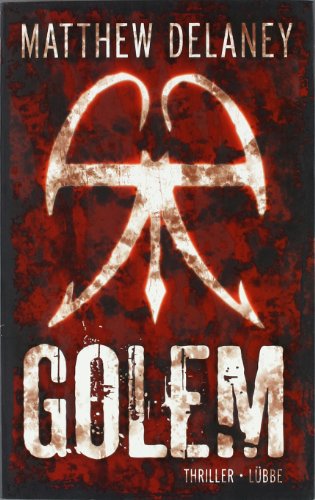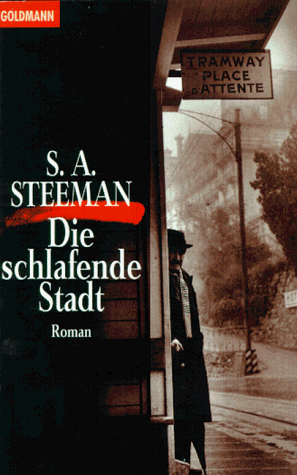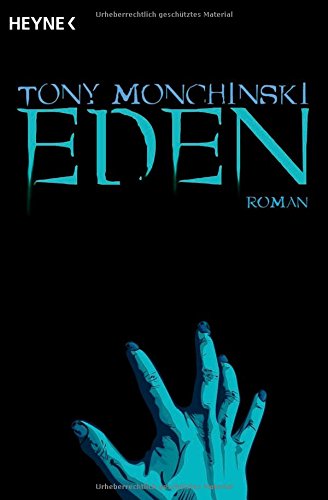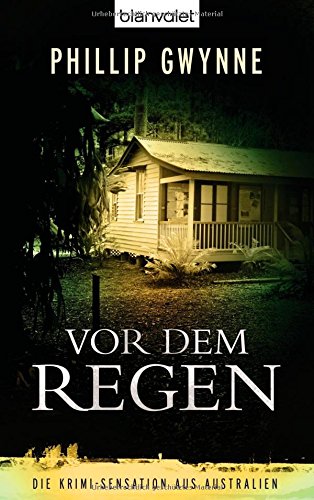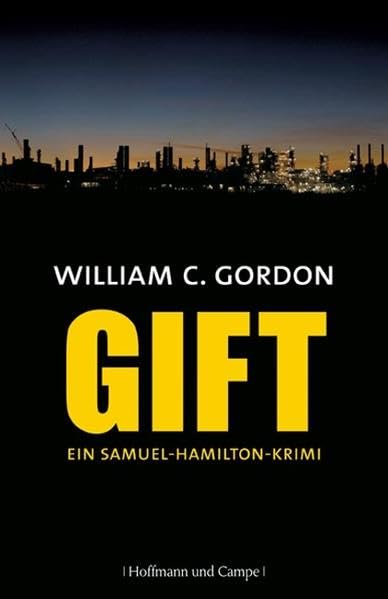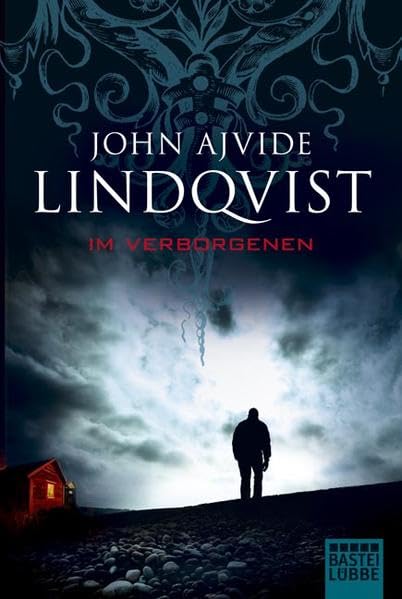_Das geschieht:_
Wie es sich gehört, sind Lieutenant Solomon „Solly“ Glass von der Mordkommission und Staatsanwältin Tuesday Reed damit beschäftigt, die Straßen von New York vom Abschaum zu säubern. Aktuell grämt sie sich, weil es ihr misslang, den Drecksack Mallick möglichst lange hinter Gittern zu bringen; er hatte bei einem Überfall dem braven Studenten Nick Stevens hohnlachend einen Schraubenzieher ins Genick gejagt und ihn dadurch vom Kopf abwärts gelähmt; ein weichlicher Richter brummte Mallick nur fünf Jahre auf. Cop Glass ermittelt im Fall des Mafia-Schlägers Benny Salsone, der mit Kugeln förmlich gespickt wurde, obwohl weder ein Gangsterkrieg tobt noch bevorzustehen scheint. Auch Malone, Glass‘ junger Partner, ist gut beschäftigt mit dem Mord am Kinderschänder und Ex-Sträfling Gordon Jacobs, den auf einem Parkplatz mehrere tödliche Kugeln trafen.
Die Arbeit fällt doppelt schwer, weil a) Tuesday sich in ihrem Job aufreibt und von ihrem nichtsnutzigen Gatten betrogen wird, b) Solly mit seinen Gefühlen ringt, die er der schönen Staatsanwältin heimlich entgegenbringt (was schlechten Gewissens – Tuesday ist ein gutes Mädchen! – erwidert wird) und c) Malone ein Dummkopf ist.
Wenigstens arbeitet das Polizeilabor zufriedenstellend. Es stellt fest, dass Jacobs und Salsone durch Kugeln fielen, die aus derselben Waffe abgefeuert wurden. Während längst der dümmste Leser weiß, was dies bedeutet, grübelt Glass noch manche Seite, bis auch er erkennt: Vigilanten gehen um und üben Selbstjustiz! Da es nur Pack trifft, das den Tod verdient hat, müssen noch einige Strolche ins Gras beißen, bis der unbestechliche Glass und der trottelige Malone einem organisierten Kopf-ab-Zirkel auf die Spur kommen, der im Namen der Gerechtigkeit zu korrigieren versucht, was verblendete Gutmenschen angerichtet haben …
_Verbrechen kann so langweilig sein!_
Klingt die oben einleitende Einführung in den Handlungsinhalt ein wenig gallig? Gut, denn sie spiegelt damit wider, was der Rezensent während jener Plackerei empfand, zu der seine Lektüre dieses Mal ausartete. Selbst der Vielleser trifft nicht oft auf einen Roman wie diesen, dessen Verfasser wahrlich keine Gnade kennt und sein Publikum mit einem Machwerk traktiert, das nur aus Klischees, Geschwafel und Psycho-Gebrabbel besteht. Es liegt nicht am eingefädelten Verbrechen. Selbstjustiz geht als Thema völlig in Ordnung. Erst in der Umsetzung trennt sich die Spreu vom Weizen. J. M. Calder drischt – um im Bild zu bleiben – nur leeres Stroh. Selten liest man einen Thriller, der in Handlung, Figurenzeichnung und Stimmung so deutlich abpaust, was fähigere Autoren mit echtem Leben füllen konnten.
Natürlich liegt es nahe, die selbst dem deutschen Leser auffällige Unkenntnis des US-amerikanischen Polizei- und Justizalltags der Herkunft des Verfassers anzulasten, der im fernen Australien lebt und arbeitet. Indes zeigen Autoren wie Lee Childs, dass es durchaus möglich ist, trotz ausländischer Herkunft überzeugende Thriller zu kreieren, die in den Vereinigten Staaten spielen. Dies ist nicht nur eine Frage der Recherche, sondern auch des Talents sowie der Entscheidung, was man eigentlich schreiben möchte: einen Krimi, eine Liebesgeschichte oder eine Klage über das Diktat des Bösen in einer vor ihm kapitulierenden, hoffnungslos dysfunktionalen Gesellschaft.
|Papiertiger & Pappkameraden|
Der Leser muss sich durch endlose Passagen kämpfen, in denen Calder die Biografien seiner Protagonisten aufrollt. Diese haben mit dem Geschehen wenig oder gar nichts zu tun und sind vor allem blasse Kopien jener einschlägigen Jammergeschichten, die wir aus tausend TV-Krimis kennen – und zwar aus den schlechten ihrer Art. Ohne Sinn für Verhältnismäßigkeit begräbt Calder die Figuren förmlich unter Klischees. Solly hat nicht nur einen Hang zur klassischen Literatur, die er gern selbstgefällig zitiert, um seine Kollegen wie Deppen dastehen zu lassen, sondern er ist 1) Jude und muss sich u. a. von fiesen Mafia-Paten rassistisch beschimpfen lassen, hat 2) seine über alles geliebte Gattin tragisch verloren, ist 3) darüber zeitweise verrückt geworden, vegetiert 4) als notorischer Sauertopf in selbst gewählter Einsamkeit, obwohl ihn sogar deutlich jüngere Kolleginnen anhimmeln, wird 5) von seiner Mutter unter Druck gesetzt, endlich wieder zu heiraten und eine Familie zu gründen, und muss 6) die infantilen Witze seines dümmlichen Bruders ertragen, ohne dabei in Gelächter auszubrechen (was aufgrund der Bartlänge dieser Scherze keine grundsätzliche Herausforderung darstellen sollte). Die Liste ist keineswegs vollständig; der Verfasser addiert immer neue Plagen dazu.
Ähnlich ergeht es der armen Tuesday Reed, die nicht nur betrogen wird und heimlich liebt, sondern Tag und Nacht arbeitet, deshalb die Familie vernachlässigt, darüber ein schlechtes Gewissen bekommt, obwohl sie dem Gatten dennoch eine bereitwillige Liebhaberin sowie dem Töchterlein eine gute Mutter ist und trotzdem die knappe Freizeit aufwendet, um den Opfer des Justizsystems tröstend zur Seite zu stehen. Auch hier folgen weitere Misslichkeiten, die Calder seinem Publikum ganz wichtig im pseudo-dramatischen Tonfall und vor allem ausführlich darbietet.
Wenn dem Verfasser überhaupt etwas gelingt, so ist es die Zeichnung zweier Figuren, die unsympathischer kaum sein könnten. Weniger Aufwand treibt Calder mit den Nebenfiguren. Malone ist und bleibt ein Handlanger, der mit offenem Mund die genialischen Einfälle seines Meisters registriert und dessen illegalen Eigentouren deckt. Besonders lächerlich misslingt die Figur des Paten Caselli, den Calder wohl in einer Mafia-Geisterbahn – sollte es so etwas geben – aufgetan hat. Darüber hinaus dürfen Pechvögel, die von Gangstern gepiesackt wurden, Leidensgeschichten hart am Rande der absoluten Lächerlichkeit erzählen.
|Strolche tilgen & damit durchkommen|
Der Selbstjustiz-Thematik unserer Geschichte verdanken wir nicht nur ein dickes Bündel weiterer Klischees, sondern auch einen schamlos aus dem Hut gezogenen Schlusstwist, den kein Leser erwarten kann oder möchte, weil er absolut logikfrei ist sowie hässliche Ausfälle gegen eine Justiz reitet, die Lustmörder, Vergewaltiger und andere Tiere nicht wegsperrt, sondern ihnen nach viel zu wenigen Haftjahren eine neue Chance gibt, während ihre vergessenen Opfer ein durch Angst und Wut zerfressenes Dasein fristen müssen.
Die ‚logische‘ Konsequenz ist nach Calder klar und folgt nicht nur Volkes Stimme: „Gabriel-Gesellschaft“ nennt er die Gruppe der Rächer, die ihr alttestamentarisches Gerechtigkeitsempfinden zum Einsatz bringen, „wenn Gott schläft“. Selbstjustiz ist folglich ein Vorgriff auf himmlische Vergeltung und geht damit in Ordnung. Ein sträflich langweiliger und umständlich in die Länge gezogener Law-and-Order-Thriller erhält auf diese Weise doch seine eigene Stimme: Ihr Klang ist hässlich, und ihre Botschaft wäre niederträchtig, ginge der Autor nicht gar so hölzern vor.
_Autor/en_
J. M. Calder ist ein Pseudonym, das sich die Autoren John Clanchy und Mark Henshaw vermutlich nicht gaben, um die Verantwortung für ihre unterdurchschnittlichen Thriller zu verschleiern, obwohl dieser Gedanke sich jenen aufdrängt, die ihre Werke kennen. John Clanchy wurde in Melbourne geboren, ist aber seit 1975 in Australiens Hauptstadt Canberra ansässig. Er arbeitete einige Jahre in der Studentenbetreuung der Australian National University und wechselte später in die Graduiertenförderung. Daneben schrieb Clanchy Romane und Kurzgeschichten, für die er diverse Literaturpreise einheimste.
Mark Henshaw wurde in Canberra geboren. Er arbeitete zunächst als Übersetzer und hielt sich lange in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ausländern auf. „Out of the Line of Fire“ (dt. „Im Schatten des Feuers“), sein Romanerstling, erschien 1989. Dieses Buch und weitere Werke wurden ebenfalls mit Preisen ausgezeichnet,
Mitte der 1990er Jahre beschlossen Clanchy und Henshaw unglücklicherweise, sich gemeinsam an einem Thriller zu versuchen. „If God Sleeps“ (dt. „Wer keine Gnade kennt“) wurde 1997 veröffentlicht, 2006 erschien „And Hope to Die“ (dt. „Ich töte, was du liebst“), ein ähnlich langatmiger und gefühlsduseliger zweiter Krimi um Solomon Glass.
|Taschenbuch: 381 Seiten
Originaltitel: If God Sleeps (Ringwood/Victoria : Signet/Penguin Books 1997)
Übersetzung: Anja Schünemann
ISBN-13: 978-3-499-24827-6
Als eBook: Juni 2010 (Rowohlt Digitalbook)
ISBN-13: 978-3-644-42651-1|
[www.rowohlt.de]http://www.rowohlt.de