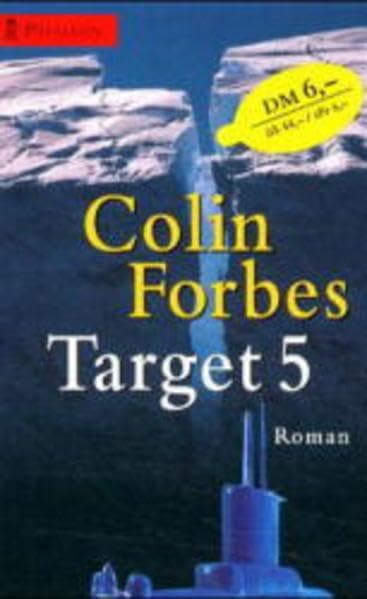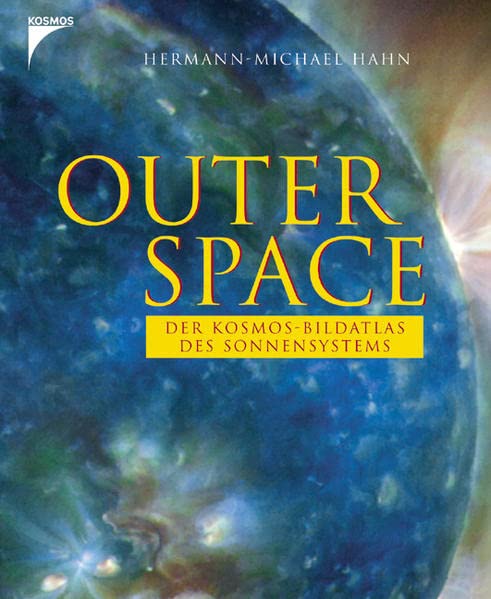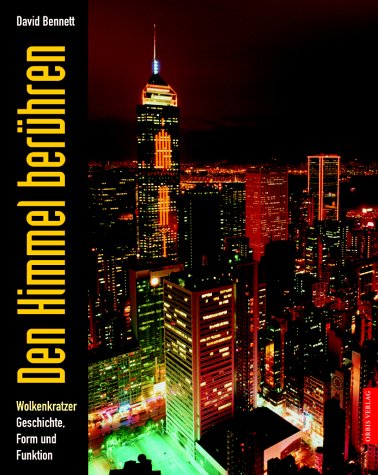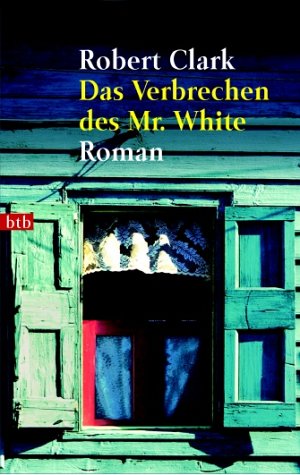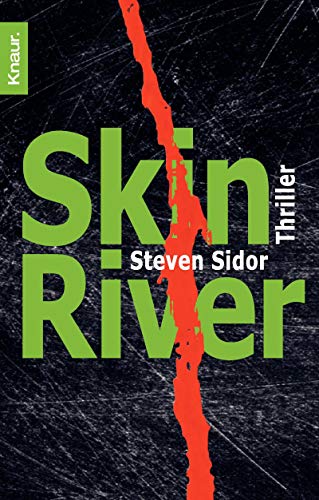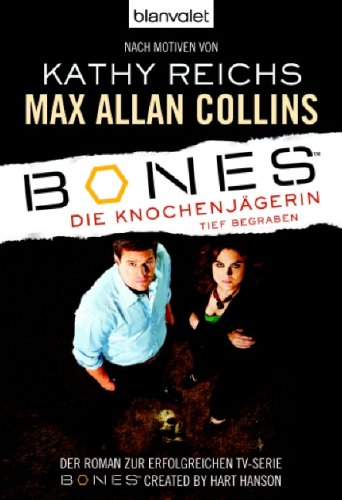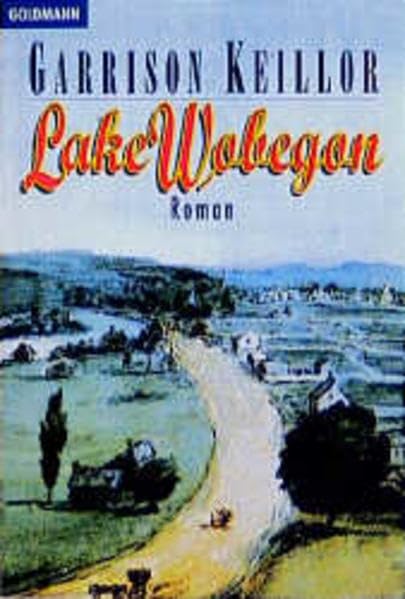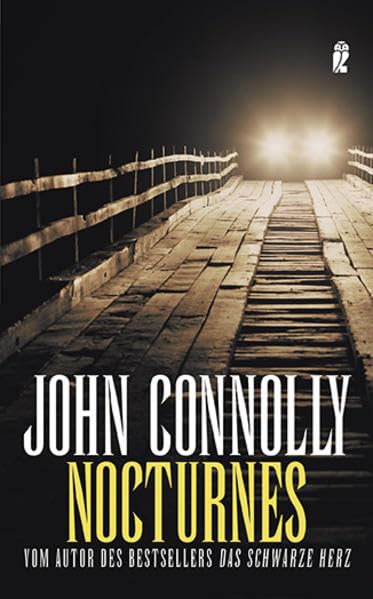H. P. Lovecraft: Das schleichende Chaos weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Forbes, Colin – Target 5
Mitten in der Nacht und auf offener Strecke holt ihn das FBI aus dem Zug, der ihn in die verdienten Ferien tragen sollte: Keith Beaumont, britischer Abenteurer und Arktis-Experte, der schon mehrfach für den US-Geheimdienst tätig geworden ist, muss zurück nach Grönland, das er gerade erst verlassen hat, um einen ungewöhnlichen Auftrag zu übernehmen.
Wir schreiben das Jahr 1972. Der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion ist auf seinem Höhepunkt. Sogar in der Arktis belauern sich die beiden Supermächte. Die Machthaber beider Seiten plagt die Angst, der Gegner könne über das Dach der Welt eine Invasion starten. Deshalb unterhält man Militärstützpunkte und noch weiter im Norden kleine „Forschungsstationen“.
Eine seltene Laune des aktuellen Polarwinters bringt es mit sich, dass sich zwei riesige Eisinseln vor der Ostküste von Grönland einander auf vierzig Kilometer genähert haben. „Nordpol 17“ trägt eine Station der Sowjets, während die Amerikaner ihrer schwimmenden Insel den Namen „Target 5“ gegeben haben.
Auf „Nordpol 17“ nutzt ein Mann die Gunst der Stunde: Michael Gorow, Meereskundler von Weltrang, hat genug von der Diktatur in seinem Heimatland. Er signalisiert den Amerikanern seine Bereitschaft überzulaufen. In Washington ist man entzückt, denn Gorow war es, unter dessen Leitung gerade das neue Unterwasser-Ortungssystem der UdSSR auf dem arktischen Meeresboden verlegt wurde. Freilich behalten Militär und Geheimdienst den Wissenschaftler in der Sowjetunion aus diesem Grund besonders sorgfältig im Auge.
Doch nun hält sich Gorow zu Forschungszwecken auf „Nordpol 17“ auf. Nur hier kann er sich absetzen, doch allein wird er den Marsch über das vereiste Nordmeer gen „Target 5“ nicht schaffen. Deshalb sollen ihn Keith Beaumont und seine beiden alten Freunde und Mitstreiter Sam Grayson und Horst Langer in Empfang nehmen und in Sicherheit bringen.
Bevor das Unternehmen begonnen hat, wissen die Russen schon Bescheid. Sie haben einen Maulwurf im amerikanischen Sicherheitssystem platziert, der Beaumont in der US-Militärbasis Thule auf Grönland in Empfang nimmt. Zwar kann der Brite ihn entlarven und ausschalten, aber das Unglück ist schon geschehen: Der Agent konnte noch seinen Chef benachrichtigen, den gefürchteten Oberst Igor Papanin, Leiter der Sicherheitsbehörde für besondere Aufgaben für den arktischen Militärbereich der UdSSR. Der hochintelligente Mann setzt sofort alle verfügbaren Kräfte gen „Nordpol 17“ in Marsch – und sollte ihnen Gorow entkommen, werden sie nicht zögern, sich „Target 5“ zuzuwenden. Als dieses Szenario tatsächlich real wird, beginnt in der Eiswüste ein erbitterter Wettlauf. Beide Seiten unterschätzen freilich sträflich ihren eigentlichen Gegner: den Polarwinter, der schon bald erbarmungslos die ersten Opfer fordert …
Romane wie dieser sind es, die dem Leser bewusst machen, welcher Verlust das Ende der Sowjetunion für die Unterhaltungsliteratur bedeutet hat. Wir haben ihn noch längst nicht verwunden; idealere Bösewichte hat es seither nicht mehr gegeben: kein wirrer & wechselhafter Flickenteppich diktatorisch-mafiöser regierter Einzelstaaten, sondern ein homogenes „Reich des Bösen“, wie Ronald Reagan es einst so lyrisch nannte, bevölkert von finsteren, bis an die Zähne bewaffneten Kommunistenteufeln, die nur auf ihre Gelegenheit lauerten, über ihr positives Gegenstück & die wahren Verfechter der Freiheit auf diesem Planeten – die Vereinigten Staaten von Amerika (sowie ihre westlichen Verbündeten = Handlanger) herzufallen. Die ganze Welt kann als Schachbrett für „das Spiel“ dienen – das unauffällige, deshalb aber nicht weniger verbissene Ringen um die Vorherrschaft auf diesem Planeten, ausgetragen von den Geheimdiensten der Supermächte, da ein offener Schlagabtausch angesichts des auf beiden Seiten angehäuften Atomwaffen-Arsenals reiner Wahnsinn gewesen wäre.
Das ist der Stoff, aus dem mehr als vier Jahrzehnte lang die (Alb-)Träume waren. Weil der Mensch sich den Dingen, die er fürchtet, gern spielerisch nähert (das „Godzilla-Syndrom“), gibt es eine unendliche Zahl von Filmen und Büchern, die vor dem Hintergrund des Kalten Krieges spielen. Einige Autoren verdanken ihren Weltruf sogar dem geschickten Spiel mit der Angst vor den „Roten“ und ihren Tücken; John le Carré ist vielleicht der bekannteste unter ihnen.
Colin Forbes erreicht ganz gewiss nicht le Carrés Klasse. Er begann seine Karriere in den 60er Jahren mit einer Reihe von Romanen, die allerlei Abenteuer wackerer britischer Soldatenhelden während des II. Weltkriegs beschrieben. Dies waren im Grunde reine Wild-West-Geschichten, in denen die Nazis die Rolle der bösen Indianer übernahmen. Allerdings lesen sich diese knalligen Reißer durchaus spannend; nicht umsonst sind sie seit Jahrzehnten sogar in Deutschland immer wieder nachgedruckt worden und haben eindrucksvolle Auflagenzahlen erreicht. („Gehetzt“, „Die Höhen von Zervus“ und „Das Double“, eine wüste Räuberpistole um einen durch einen Doppelgänger ersetzten Adolf Hitler, sind alle im |Heyne|-Verlag erschienen.)
Daneben widmete sich der fleißige Forbes natürlich auch dem Agententhriller. Die Sowjets erwiesen sich als ebenso dankbare Schurken wie die Nazis. Oberst Papanin, der in „Target 5“ auf russischer Seite die Fäden in der Hand hält, ist der roboterhafte Apparatschik par excellence. In Russland ist es immer kalt und dunkel, die Menschen schleichen graugesichtig und geduckt daher, immer gewärtig, von der Polizei oder dem Geheimdienst auf offener Straße verhaftet und verschleppt zu werden, damit man sie foltern und ihnen „Landesverrat“ vorwerfen kann. Aber Russen sind auch schlau, und dies manifestierte sich für den Durchschnittswestler der 1960er und 70er in der schwer verständlichen, ärgerlichen Tatsache, dass sie stets die Schachweltmeisterschaft für sich entschieden. Natürlich konnte ihnen das nur gelingen, weil sie – anders als die braven und vom wahren Sportsgeist beseelten Amerikaner – das Schachspiel nur als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln begriffen. Folglich schleppt sogar der grimmige Papanin stets ein Schachspiel mit sich herum, auf dem er in den weniger freien Minuten, die der Große Bruder im Kreml ihm gewährt, die nächsten Züge gegen den Klassenfeind einübt. Auch die Verräterhatz im Eis betrachtet Papanin als Spiel, das er unter allen Umständen zu gewinnen trachtet.
Den diabolischen Sowjets stemmen sich reinen Herzens die Verteidiger des Westens entgegen. General Dawes lockt Keith Beaumont zwar mit einem faulen Trick in die Arktis, aber er muss halt so handeln, weil es doch im Dienst einer guten Sache ist. Und weil er im Herzen ein wahrer Patriot und Dawes zwar ein harter Brocken, aber eigentlich ein patenter Kerl ist, lacht der brave Keith bald wieder anerkennend über seinen schlauen Chef und lässt Gedanken an Manipulation und Machtmissbrauch gar nicht erst aufkommen. Immerhin verlässt er sich doch auf ihn – und dabei ist er nicht einmal Amerikaner! Ganz verleugnen mochte Colin Forbes also seine Herkunft – und sein treues britisches Publikum nicht. Ohnehin spielt Beaumonts Nationalität für die Handlung überhaupt keine Rolle.
Von der holzschnittartigen Weltsicht einmal abgesehen, funktioniert „Target 5“ als Abenteuerroman ausgezeichnet. Die „Realität“ des Jahres 1972 weckt heute nicht nur nostalgische Gefühle, sondern lässt „Target 5“ ebenso irreal wirken wie die leicht Science-Fiction-lastigen Film-Agententhriller dieser Zeit. Darüber hinaus fesselt Forbes Roman durch die grandiose arktische Kulisse. Der Kampf des Menschen gegen das ewige Eis stellt sich heute kaum anders dar als 1972. Diese Passagen sind quasi zeitlos, und weil Forbes sein Handwerk versteht, sind sie auch heute noch spannend zu lesen.
http://www.heyne.de
Mulvey, Laura – Citizen Kane. Der Filmklassiker von Orson Welles
Die Geschichte vom märchenhaften Aufstieg und bodenlosen Fall des Zeitungsmagnaten Charles Foster Kane, dem beruflich (scheinbar) alles gelingt, während man sein Privatleben nur als Jahrzehnte währendes Desaster bezeichnen kann, wurde vom Regisseur/Drehbuchautor/Hauptdarsteller Orson Welles im Jahre 1941 als Filmdebüt in Szene gesetzt. Dem gerade 26-Jährigen war an den Kinokassen wie in der Presse zunächst wenig Erfolg beschieden; zu weit war Welles der Bildsprache und den Erzählstrukturen seiner Zeit voraus. Fast zwei Jahrzehnte dauerte es, bis sich zumindest unter den Kritikern die Erkenntnis durchsetzte, dass Welles mit „Citizen Kane“ eines der wenigen echten Meisterwerke der Filmgeschichte gelungen war – ein Film, der nicht nur für sich selbst stehen konnte, sondern stilbildend und vorbildlich ganze Generationen von Filmschaffenden prägen sollte.
„Citizen Kane“ ist heute weniger ein Film als eine Legende. Seit um 1960 die moderne Filmkritik „erfunden“ wurde, ist Orson Welles‘ Meisterwerk auf den ersten Rang jeder Kritikerliste der „besten Filme der Geschichte“ quasi abonniert! Schon diese beinahe blinde Liebe ließ es der Filmhistorikerin und -journalistin Laura Mulvey ratsam erscheinen, zum 60. „Geburtstag“ von „Citizen Kane“ einen kritischen Blick auf diesen Film zu werden. Plappern die Kritiker ein Lob nach, das ihre Vorfahren und Kollegen seit vier Jahrzehnten wie ein Mantra anzustimmen pflegen? Oder kann „Citizen Kane“ auch im 21. Jahrhundert seinem Ruf gerecht werden?
Das hier in der Filmbuch-Reihe des |Europa|-Verlags vorgelegte Bändchen aus der Feder Mulveys kann diese Frage beantworten – uneingeschränkt und überzeugend positiv, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Zum einen ist es schwer, einen Film-Monolithen dieses Kalibers auf etwas über einhundert Seiten zu bewerten, zum anderen ist „Citizen Kane“ in den USA bereits im Jahre 1992 erschienen. Mehr als ein Jahrzehnt Rezeptionsgeschichte fehlt also, doch hier steht Ihr Rezensent mutig Gewehr bei Fuß, um in die Bresche zu springen …
Wer heutzutage das Glück hat, „Citizen Kane“, den Film, zum ersten Mal zu sehen (und dann womöglich in einem Programmkino, d. h. auf der „richtigen“ Leinwand, für die er geschaffen wurde!), mag kaum glauben, dass dieser Streifen vor mehr als einem halben Jahrhundert entstanden ist. Er ist gealtert, keine Frage, aber dennoch lässt sich noch gut nachvollziehen, welcher Quantensprung der Filmgeschichte dank Orson Welles im Jahre 1941 gelang. Vor und hinter der Kamera ereignete sich künstlerisch Revolutionäres – nicht, dass Welles und seine genialen Mitstreiter (die von den Chronisten gern verschwiegen werden, auf dass der Stern des verehrten Meisters um so heller strahle) das Rad neu erfunden hätten: Die meisten (erzähl-)technischen Tricks und Kniffe gab es schon vor 1941, doch niemals zuvor hatte jemand ihr Potenzial entdeckt, wurden sie so konsequent und furios eingesetzt wie in „Citizen Kane“.
Über die USA des Jahres 1941 brach der Film herein wie ein kultureller Feuersturm. Seit knapp zehn Jahren schwang das Hayes-Office die Knute der Zensur und hatte in Hollywood praktisch jeden künstlerisch-subversiven Funken erstickt. Das Publikum war eingelullt und abgestumpft; Experimente verschreckten es eher statt es zu inspirieren. Dabei könnte niemand den Schöpfern von „Citizen Kane“ vorwerfen, sie hätten ihren Zuschauern bleischweres Kopf-Kino vorgesetzt. „Citizen Kane“ erzählt eine mitreißende Geschichte und geizt wahrlich nicht mit Schauwerten. Aber Welles kaut seinem Publikum diese Geschichte nicht vor, sondern fordert Aufmerksamkeit und die Bereitschaft mitzudenken – und das ist seit jeher riskant.
Orson Welles (1915-1985) war gerade 25 Jahre alt, als er mit den Dreharbeiten zu seinem ersten Film begann – ein Wunderkind, das als Unterhaltungskünstler bereits mit allen Wassern gewaschen war, seine Landsleute am Theater mit kühnen Inszenierungen klassischer und moderner Stücke und 1938 mit dem Radio-Schocker [„Krieg der Welten“ 1475 in Angst und Schrecken versetzt hatte und sich nun anschickte, Hollywood zu erobern. Seitens des RKO-Studios mit unerhörter Autonomie ausgestattet, spielte Welles mit der sprichwörtlichen Unbekümmertheit des jungen Genies mit den Konventionen des Kinos, definierte es (teilweise) neu und scherte sich wenig um geschriebene oder ungeschriebene Regeln oder gar Tabus. Das Ergebnis ließ ihn an prominenter Stelle in die Kinoannalen eingehen. Freilich zahlte Welles bis zu seinem eindeutig verfrühten Tod einen bitteren Preis dafür. Nie wieder sollte ihm ein Werk wie „Citizen Kane“ gelingen, obwohl ihm die Filmgeschichte auch später noch manchen Meilenstein verdankt.
Schlimmer noch: „Citizen Kane“ zerstörte Welles‘ Karriere, bevor sie in Gang kommen konnte. Er hatte seinen Charles Foster Kane ein wenig zu offensichtlich an William Randolph Hearst, den ungekrönten (und reizbaren) Zeitungszaren, angelehnt und sich außerdem deutlich auf die Seite Präsident Franklin D. Roosevelts und dessen Politik des „New Deal“ geschlagen, die Hearst, Erzkapitalist der ersten Stunde und eingeschworener Gegner jeglicher Bemühungen, zur Überwindung der Weltwirtschaftskrise die Reichen und Superreichen zur Kasse zu bitten, erbittert bekämpfte. Dazu kamen die von Welles eher als Inspiration denn als Herausforderung verstandenen Anspielungen auf das gesellschaftlich eigentlich unhaltbare, aber von der devoten Presse totgeschwiegene Verhältnis Hearsts zum mehr als fünfzig Jahre jüngeren Filmsternchen Marion Davies, das er später auch heiratete. Der alte Mann, der sich rühmte, in seinen zahlreichen Zeitungen den spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 inszeniert zu haben, begann nach 1941 einen vernichtenden und objektiv kriminellen Medienfeldzug gegen Welles, der sich davon auch nach Hearsts Sturz nicht mehr erholen konnte.
Aber hier geht es ja nicht um Orson Welles‘ Niedergang, sondern um „Citizen Kane“. Mulvey skizziert knapp aber umfassend die Vorgeschichte, die Umsetzung und die unmittelbare wie langfristige Rezeption des Films, der bei allem überbordenden Ideenreichtum durchaus ein zuverlässiger Spiegel seiner Zeit ist. Die bedrückende geistige Enge von „God’s Own Country“ wird ebenso offenbar wie die Mechanismen der gut geölten Hollywood-Maschinerie, die sich über Jahrzehnte an der Quadratur des Kreises versuchte: der industriellen Produktion lukrativer Träume. „Citizen Kane“ spiegelt drastisch wider, was dem blühte, der es wagte, Hollywood als die wunderbare Spielzeugeisenbahn zu betrachten, als die es von den großen Studios in der Öffentlichkeit gern dargestellt wurde. Unter diesen Bedingungen ist es erstaunlich, dass ein Film wie dieser überhaupt zustande kommen konnte.
Ein wenig störend wirkt hier und da Mulveys Versuch, „Citizen Kane“ und seinen Schöpfer auf Biegen und Brechen mit den Mitteln der Psychoanalyse zu „entschlüsseln“. Solche nachträglichen Interpretationen lösen oft „Rätsel“, die sehr elegant wirken, an die ihre Schöpfer allerdings selbst im Traum nicht gedacht haben: Eine Rose ist manchmal nur eine Rose, wie es so schön heißt. Dennoch kann Mulvey trotz der gebotenen Kürze – „Citizen Kane“ erschien quasi als Begleitheft des renommierten „British Film Institute“ zum Neustart des Films – mit einigen Entdeckungen aufwarten. Die zahlreichen und sehr schönen Schwarzweißfotos runden das Lektürevergnügen des überdies sorgfältig übersetzten Bandes ab, der einmal mehr traurig macht, dass die „Film-Bibliothek“-Reihe (sowie der „alte“ |Europa|-Verlag) selbst längst Geschichte sind.
http://www.neuer-europa-verlag.de/
Ernest Haycox – Goldstaub aus Ophir
Ophir ist eine jener kurzlebigen Siedlungen, die im Nordosten des US-Staates Oregon entlang des John Day River entstanden. Recht und Gesetz sind hier, wo Gold aus dem Flusswasser gewaschen wird, besonders fern. Seit einiger Zeit treibt eine Bande ihr Unwesen, die auf weniger mühsame Weise reich werden will. Ihr jüngstes Opfer ist der Postkutschenfahrer Tom Rawson. Einen Monat hat er auf Leben und Tod im fernen Portland gelegen, nachdem man ihn auf seiner letzten Tour vom Kutschbock geschossen hat. Eine Kiste mit Goldstaub verschwand, aber Tom ist wieder da. Er will es den Strolchen heimzahlen.
Toms Rückkehr wird mit gemischten Gefühlen quittiert. Da ist Jack Mulvey, sein Chef und Freund, der sich freut, dass der junge Mann zurück ist, doch nicht grundlos fürchtet, er könnte erneut zur Zielscheibe werden. Das denkt auch Ed Carrico, Leutnant des 3. Kavallerieregiments, der gerade den Lynchmord an einem möglichen Gold-Dieb verhindern musste und weiß, wie gespannt die Situation in Ophir ist. An seiner Seite weiß Tom immerhin die furchtlosen Kutscherkollegen Barney Rheinmiller und Bart Lennon. Ernest Haycox – Goldstaub aus Ophir weiterlesen
Nick Rennison – Sherlock Holmes. Die unautorisierte Biographie
Die Biografie des Kriminalisten William Sherlock Holmes (1854-1929) lässt Licht in viele dunkle Winkel eines außergewöhnlichen Lebens fallen. Aus meist zufälligen Äußerungen, zeitgenössischen Quellen und allerdings gut begründeten Spekulationen resultieren vor allem die Angaben zur Geschichte der Familie Holmes (Kapitel 1: „Meine Vorfahren waren Landjunker“), in die nicht nur Sherlock, sondern auch der kaum weniger berühmte Mycroft 1854 bzw. 1847 geboren wurden.
Die schwierigen Jugendjahre des Sherlock Holmes, dessen Genie mit einer gleichzeitigen Ablehnung der rigiden viktorianischen Gesellschaftsordnung einherging, ließen ihn nur schwer seinen Platz in der Welt finden. Dem gescheiterten Studium und einem Intermezzo am Theater folgte der Umzug nach London, wo Holmes viele saure Jahre darauf verwenden musste, sich als „beratender Ermittler“ zu etablieren (Kap. 2: „Diese ungastliche Stadt“). Hier lernte er 1880 den ehemaligen Militärarzt John H. Watson kennen, der nicht nur – mit Einschränkungen – zu seinem Biografen, sondern auch zu seinem besten Freund wurde (Kap. 3: „Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe“).
Nick Rennison – Sherlock Holmes. Die unautorisierte Biographie weiterlesen
Rainer Schmitz – Was geschah mit Schillers Schädel? Alles, was Sie über Literatur nicht wissen

Die Literaturgeschichte ist ein Forschungsfach, das sich bekanntlich überaus wichtig nimmt. Große Geister äußern bekanntlich große Gedanken, und diese dem gemeinen Leservolk, den noch viel gemeineren Kritikern sowie den chronisch mit Blindheit geschlagenen wissenschaftlichen Kollegen zu erklären, ist eine todernste Aufgabe, nein, eine Mission, zu der sich zahlreiche Spezialisten berufen fühlen. Noch die scheinbar unwichtigste biografische Einzelheit fließt in die Werksanalyse ein, bis aus einem Schriftsteller schließlich ein Ausnahmemensch wird, dessen Leben das Werk und umgekehrt spiegelt.
Dabei sind Schriftsteller auch nur Menschen – in der Regel sogar recht schwache i. S. von gar nicht vorbildlichen Zeitgenossen. Darüber hinaus sind sie weder vor den Tücken der Geschichte oder des Objekts gefeit. Lächerliches und Peinliches stößt ihnen mindestens ebenso häufig zu wie Erhabenes oder Dramatisches. Wieso auch nicht, denn der Schriftsteller lebt nicht für seinen Nachruhm, sondern im Hier & Jetzt mit allen Konsequenzen, die Spielsucht, Impotenz, Inkontinenz, alkoholbedingte Ausfälle und alle sonst möglichen (und unmöglichen) Profanitäten einschließen. Rainer Schmitz – Was geschah mit Schillers Schädel? Alles, was Sie über Literatur nicht wissen weiterlesen
Hahn, Hermann-Michael – Outer Space – Der Kosmos-Bildatlas des Sonnensystems
„Outer Space“: Hinter dem hübsch-hässlichen, wohl dem „Denglischen“ zuzuordnenden Begriff verbirgt sich der Raum, den unser Sonnensystem mit seinem Zentralgestirn – der Sonne -, mit der Erde und ihren Nachbarplaneten, deren Monden, vagabundierenden Kometen, den inneren und äußeren Asteroiden und anderen Himmelkörpern einnimmt. Knapp aber informativ und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft werden sie vorgestellt, wobei das Schwergewicht jedoch auf den sensationellen Fotos liegt: „Outer Space“ versteht sich als „Ergänzungsband“ zum Textsachbuch „Unser Sonnensystem“, das der Autor 2004 ebenfalls im Verlag |Kosmos| veröffentlichte.
Wie es üblich für Darstellungen des Sonnensystems ist, orientiert sich die Gliederung an den markantesten „Bewohnern“ des „Outer Space“. „Die Erde – der blaue Planet“ (S. 10-27) wirkt aus dem All betrachtet keineswegs weniger exotisch oder fremdartig als die fernen Planeten, die wir noch kennen lernen werden. In aller Kürze aber eindrucksvoll stellt der Verfasser die grundsätzlichen Eigenschaften unseres Heimatplaneten heraus, die ihn plötzlich als „Verwandten“ von Höllenwelten wie Merkur oder Venus identifizieren. Ein Unterkapitel widmet sich dem Mond, der die Erde als Trabant umkreist und folgerichtig zum Ziel für erste Forschungsexpeditionen des Menschen in den „Outer Space“ wurde.
Die Darstellung springt anschließend zurück auf Null bzw. ins Zentrum des Sonnensystems: „Die Sonne – ein brodelnder Feuerball“ (S. 28-45) ist ein Ort, wie man ihn sich unwirtlicher kaum vorstellen kann. Umfang und Hitze erreichen Größenordnungen, die den Menschen an den Rand seiner Vorstellungskraft und darüber hinaus treiben. Die Bilder flößen Angst ob der ungeheuren Gewalten ein, die diesen Stern prägen. Und doch ist er die Quelle der Lebens auf der Erde und mit ihm verbunden durch eine komplexe Kette erstaunlicher Prozesse, die hier vorbildlich aufgerollt wird.
Der sonnennächste Planet ist „Merkur – eine steinige Welt der Extreme“ (S. 46-59), die ihre Geheimnisse bisher gut zu hüten wusste. Merkur ist nicht nur schwer zu beobachten, sondern gehört zu den wenigen Planeten des Sonnensystems, die bisher kaum und dann schon vor Jahrzehnten durch Sonden untersucht und fotografiert wurden. 2008 und 2009 wird sich dies ändern und eine Fülle neuer Erkenntnisse über Merkur bringen, der entweder sonnengeröstet oder weltallgefrostet wird, wenn er sich denkbar langsam um seine Achse dreht.
Lange galt die Venus als Zwilling der Erde; man vermutete unter ihrer dichten Wolkenschicht eine urzeitliche Dschungelwelt mit Dinosauriern und anderen Getümen. Tatsächlich ist „Venus – eine glühende Hölle“ (S. 60-79), deren Atmosphäre zudem aus Säuren besteht und einen Luftdruck aufweist, unter dem jede gelandete Sonde bisher binnen weniger Minuten zerdrückt wurde. Dennoch gelangen bemerkenswerte Bilder dieser fremden Welt, die eine schauerlich-schöne, absolut lebensfeindliche Oberfläche zeigen.
Auf der „anderen Seite“ der Erde kreist „Mars – unser geheimnisvoller Nachbar“ (S. 80-117). Auch er galt als Kandidat für außerirdisches Leben – und ist es noch, wie neue Untersuchungen andeuten, die einen Blick in die Unterwelt des Mars‘ ermöglichen. Die relative Nähe zur Erde und eine nicht gar zu aggressive Atmosphäre bieten die Chance, ferngesteuerte Marssonden landen zu lassen, die sogar fahrende „Ableger“ aussenden können. So existieren inzwischen unzählige Bilder des roten Planeten in perfekter Schärfe, die sehr deutlich machen, dass auf dieser angeblich toten Welt noch viele Geheimnisse auf ihre Enthüllung warten.
Ein Exkurs führt uns in den weiten, aber nicht leeren Abgrund zwischen Mars und Jupiter. Hier ziehen „Kleinplaneten – die Insekten des Himmels“ (S. 118-125) ihre Bahnen, Stein- und Eisbrocken von oft grotesker Form, die bei der Entstehung des Sonnensystems als Schutt zurückblieben. Besonderes Interesse erregen sie, seit bekannt ist, dass nicht alle diese Asteroiden in der Ferne bleiben, sondern auf Umlaufbahnen kreisen, die sich mit dem Lauf der Erde schneiden. Ein zufälliges „Treffen“ ist möglich und würde verheerende Folgen mit sich bringen. Kein Wunder, dass man diese „Insekten“ sehr genau im Auge behält!
„Jupiter – der stürmische Riesenplanet“ (S. 126-151) bildet die eindrucksvolle „Mitte“ des Sonnensystems. Er ist zwar als Gasball ein relatives Leichtgewicht, aber auch der größte Planet überhaupt. Gewaltige atmosphärische Erscheinungen geben ihm sein markantes Aussehen – Wirbelstürme von Ausmaßen, in denen die Erde verschwinden könnte, rasen um seine Oberfläche, zu deren Erkundung noch kein Instrument gebaut werden kann, das dem Druck und den Temperaturen standhielte. Besondere Aufmerksamkeit wird auch den zahlreichen Monden des Jupiter geschenkt, die sich vielfältig als Vulkan- und Lavahölle, Eisjuwel oder Steinkugel präsentieren.
Jenseits des Jupiter erwartet den Reisenden durch den „Outer Space“ der nicht minder beeindruckende „Saturn – der majestätische Herr der Ringe“ (S. 152-189), ebenfalls ein Gasriese mit entsprechenden Rätseln, aber auch jenen Ringen, die ihn legendär werden ließen (obwohl auch andere Planeten beringt sind, wie wir in diesem Buch sehen). Unglaubliche Aufnahmen belegen, wie Sonden quasi „durch“ die Ringe flogen und ihren Geheimnissen auf die Spur kamen. Unter die Linse genommen werden die Monde Saturns, von denen einer völlig unerwartet eine dichte Atmosphäre aufweist, was unsere Anhänger außerirdischen Lebens schon wieder zum Träumen bringt …
Das Sammelkapitel „Jenseits von Saturn – die fernen Welten“ (S. 190-213) stellt die Planeten Uranus und Neptun sowie den jüngst zum Kleinplaneten „degradierten“ Pluto dar. Für einen Bildatlas sind die zur Verfügung stehenden Bilder nicht so zahlreich oder ausdrucksstark, dass sich Einzelkapitel lohnten. Auch stehen wie beim Merkur Sondenflüge mit leistungsstarker Technik erst bevor. Dennoch hat das Wissen um Uranus, Neptun, Pluto und die noch weiter „draußen“ kreisenden Kleinplaneten und Kometen in den letzten Jahren enorm zugenommen, so dass auch dieser letzte Teil des Buches keineswegs als der Vollständigkeit angehängter Nachklapp zu versehen ist.
Vorangestellt ist „Outer Space“ eine Einleitung (S. 7), dem Haupttext folgen ein Anhang, der die „Sonne und Planeten in Zahlen“ nebeneinander stellt (S. 214), sowie ein Register (S. 215/16), der Bildnachweis und das Impressum (S. 217).
Dorthin zu gehen (bzw. fliegen), wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, bleibt in den letzten Jahrzehnten unbemannten Forschungssonden und Robotern vorbehalten. Während sich altmodische US-Raumfähren höchstens in die Erdumlaufbahn schleppen, ziehen sie hinaus in die Weite des „Outer Space“, umkreisen nicht nur die Objekte menschlichen Interesses, sondern landen auf weit entfernten Planeten, Monden oder steuern sogar Kometen an. Sie horten dabei Dateien, die das Wissen um Natur und Geschichte des Sonnensystems in Quantensprüngen wachsen lassen. Gleichzeitig liefern sie fesselnde Bilder unbekannter Landschaften, die jene Kleingeister, für die Raumfahrt nichts als das überteuerte Anbohren außerirdischer Felsbrocken bedeutet, nachhaltig Lügen strafen.
Seit der Jahrtausendwende strömt eine ganze Herde metallener Schnüffler durch das Sonnensystem. Sie heißen „Spirit“ oder „Opportunity“, „Cassini“ oder „Huygens“ und wagen sich weiter vor als je zuvor. Das Internet bietet die Möglichkeit, die dabei entstandene Bildflut auch als Laie zu sichten. Der Blick auf den Bildschirm ist jedoch noch immer kein Ersatz für das gedruckte Foto; der Verfasser spricht es in seinem Vorwort sehr richtig an. Wie konkurrenzlos das gute, alte Sachbuch weiterhin ist, belegen die auf feines Kunstdruckpapier gebrachten 200 Farbfotos (sowie fünf Farbillustrationen), die noch die kleinsten Details mit unerhörter Schärfe wiedergeben. Das Format 28,6 x 24 cm gestattet wahre Augenschmause, die noch erheblich dort verfeinert werden, so sich Fotos gar aufklappen lassen. Eine Panoramaaufnahme der Marslandschaft kann einen schon in den Lesesessel drücken, wenn sie in voller Farbpracht fast einen Meter breit klaftert! „Outer Space“ ist kein kostengünstiges geschweige denn billiges Buch, doch wer es in die Hand (oder besser Hände, denn es ist schwer) nimmt, weiß, dass es sein Geld wert ist!
Knappe Texte und Bildlegenden liefern das notwendige Hintergrundwissen. Sie sind auch dem bereits genannten Laien verständlich, ohne dabei ins Wissenschafts-Pidgin à la „Galileo“ zu verfallen. Wer sich näher informieren möchte, greift zum ergänzenden Textsachbuch – und freut sich auf weitere Erkenntnisse, die uns die Forschungsmissionen der kommenden Jahre garantiert liefern werden!
Hermann-Michael Hahn studierte Astronomie und Physik in Bonn und arbeitet seit vielen Jahren als freier Wissenschaftsjournalist und Buchautor.
Der Vollständigkeit halber sei auch das eingangs erwähnte Textsachbuch erwähnt:
Hermann-Michael Hahn: Unser Sonnensystem. Sonne und Planeten im Fokus der Forschung
Deutsche Erstausgabe: September 2004 (Verlag Kosmos/Franckh-Kosmos)
98 Farb- u. 42 SW-Fotos sowie 70 Illustrationen
223 S.
EUR 29,90
ISBN-10: 3-440-09796-X
ISBN-13: 978-3-440-09796-0
http://www.kosmos.de
Bennett, David – Den Himmel berühren
In drei Kapiteln präsentiert Verfasser David Bennett den Lesern sein Thema:
|“Senkrechte Welten – Ein Tag im Leben eines Wolkenkratzers“|: Im Mittelpunkt steht der Sears Tower, seit 2001 wieder höchstes Haus auf dem nordamerikanischen Kontinent. (Dass die höchsten Gebäude der Welt inzwischen in Asien emporragen, ist eine weitere Erkenntnis, die wir diesem Werk verdanken.) Er wurde in Chicago erbaut und reckt sich stolze 443 Meter in die Höhe. Verfasser Bennett geht es jedoch mehr darum, was sich im Inneren abspielt, dessen gewaltige Dimensionen einen exotischen Mikrokosmos mit eigenen Regeln und Gewohnheiten formen.
|“Hoch hinaus – Die Geschichte der Wolkenkratzer“|: Kaum ein Jahrhundert gibt es sie, obwohl man sich die Großstädte der Welt ohne sie nicht mehr vorstellen kann. Aber auch Hochhäuser haben tief angefangen – als Laternenkratzer gewissermaßen. Dieses Stadium haben sie aber rasch und gewissermaßen in 20-Jahres-Sprüngen hinter sich gelassen: Jedenfalls teilt David Bennett die Wolkenkratzer-Chronologie in diese Phasen ein. Als Laie findet man das überzeugend. Die wenigen, aber das Wichtige erfassenden Informationen verblassen ohnehin im Vergleich zum Bildmaterial. Historische Fotos von fabelhafter Qualität und sogar Ausklappseiten schwelgen in eindrucksvollen Gesamt- und Detailansichten.
|“Vertikale Realität – Der Bau der Hongkong Bank“|: So ganz klar wird nicht, wieso Bennett sich ausgerechnet dieses Gebäude als Beispiel dafür wählt, wie man heute ein Hochhaus baut; möglicherweise ist er einfach gerade anwesend gewesen … Sei’s drum, die Hongkong Bank kann als exemplarisch für den modernen Hoch-Bau gelten. Die unglaubliche Herausforderung wird selbst dem Nicht-Architekten sogleich deutlich. Wer sich bisher ernsthaft fragte, wie Wolkenkratzer der Schwerkraft trotzen, selbst wenn sie nicht von Flugzeugen gerammt werden, weiß nach der Lektüre mehr – und staunt fast ehrfürchtig! (Ausgenommen chronisch zivilisationskritische Weltverbesserer, die ihre Mitmenschen in Höhlen zurückzwingen möchten.)
Lässt sich die Geschichte der höchsten Häuser dieser Welt in einem (wenn auch großformatigen) Buch von gerade 120 Seiten darstellen? Kann diese Lektion um grundsätzliche technische Informationen ergänzt werden, ohne den Umfang des Werkes in die Höhe und die Nicht-Architekten unter den Lesern in die Flucht zu treiben? Ist es möglich, die kompakte Lehrstunde durch Foto-Impressionen zu ergänzen, die nicht einfach nur Seiten schinden, sondern zusätzliche Infos vermitteln sollen?
Tatsächlich ist das alles möglich, wenn man nur weiß, wie es gemacht wird. David Bennett, Ingenieur und Schriftsteller, hat sich sichtlich Gedanken darüber gemacht, wie er sein Thema dem Laien (der Fachmann murrt sicherlich wie üblich über viele weiße Flecken und Vereinfachungen) nahe bringen kann. Nicht dass dies in diesem Fall schwer wäre: Auch nach dem Fall der Twin Towers in New York haben Wolkenkratzer ihre Faszination nicht verloren. Wie sollten sie auch, symbolisieren sie doch diverse Träume des Menschen, den es seit jeher in die Höhe lockt. Sich über den alltäglichen Pöbel und den Straßenschmutz der Stadt erheben und gleichzeitig Kosten fürs Baugrundstück sparen: Wer könnte da schon widerstehen?
„Den Himmel berühren“ ist in gewisser Weise ein Zeugnis unschuldigerer Zeiten. Als es 1995 veröffentlicht wurde, war der Aufwärtsdrang der Architekten noch ungebrochen. Höher, immer höher sollte es gehen, Konzepte für 800-Meter-Wolkenkratzer wurden ernsthaft entwickelt. Wie bereits erwähnt wurde, steht heute das höchste Haus der Welt in Asien (Petronas Towers in Koala Lumpur, Malaysia, 450 m; kennen wir u. a. aus dem Kinofilm „Entrapment“/“Verlockende Falle“ von 1999 mit Sean Connery und Catherine Zeta-Jones). Zumindest in den westlichen Industrieländern ist mit dem Ende des World Trade Center in New York (zwei Mal 417 m übrigens) alles anders geworden. In Bennetts Werk gibt es sie natürlich noch, aber für diese aktuelle deutsche Billigausgabe hat sich der |Orbis|-Verlag tatsächlich die Mühe gemacht, einen Hinweis auf die Katastrophe vom September 2001 in den Text aufzunehmen. Respekt!
David Bennett ist Bauingenieur mit eigenem Beratungsbüro und hat sich – das dürfte keine Überraschung sein – auf Hochhäuser spezialisiert. Für diese macht er sich seit jeher auch publizistisch stark und hat zahlreiche (meist prächtig bebilderte) Sachbücher verfasst.
C. W. Ceram – Götter, Gräber und Gelehrte. Roman der Antike

C. W. Ceram – Götter, Gräber und Gelehrte. Roman der Antike weiterlesen
Clark, Robert – Verbrechen des Mr. White, Das
Herbert White gehört zu jenen unauffälligen Zeitgenossen, die ihr gesamtes Leben am Rande der Gesellschaft verbringen und dort von ihren Mitmenschen kaum zur Kenntnis genommen werden. Dabei ist es nicht einfach, ihn zu übersehen, ist er doch auffällig groß und kräftig und trotz seiner Jugend mit einer spiegelblanken Glatze geschlagen. Mit ruhiger Regelmäßigkeit geht er seinem farblosen Angestelltenjob nach und verbringt die Feierabende und Wochenende daheim. Dort schneidet er Zeitungsartikel aus, die über Neues in der Welt berichten. Für White ist das wichtig, denn er leidet an Gedächtnisstörungen und kann sich schlecht merken, was in den letzten Tagen und Wochen geschehen ist oder er selbst getan hat.
Das ist fatal, denn es sichert ihm zusammen mit seinem zweiten Zeitvertreib die ungeteilte Aufmerksamkeit der örtlichen Polizei. Herbert White fotografiert gern – am liebsten junge und schöne Frauen. Dafür ist er schon bekannt bei den Tänzerinnen der „White Castle“-Bar, denen seine harmlose Obsession eine schöne Nebenerwerbsquelle erschließt. Doch wir schreiben das Jahr 1939, und St. Paul, Whites Heimatort, ist keine weltoffene Großstadt, sondern ein kleines Nest irgendwo im US-Staat Minnesota. Hier gelten eigene, oft ungeschriebene Regeln, deren wichtigste lautet, dass jeder als verdächtig gilt, der sich „anders“ verhält als die braven Bürger.
Und Verdächtige sind Männern wie den Polizisten Welshinger und Trent vom Sittendezernat des Städtchens St. Paul ausgeliefert – selbstherrlichen, rassistischen und korrupten Männern, die gern Landstreicher, Schwarze, Juden und andere Minderheiten, die sich nicht wehren können, schurigeln, demütigen oder erpressen. Die meisten ihrer Kollegen sind aus demselben Holz geschnitzt. Lieutenant Wesley Horner ist allerdings anders – ein beruflich integerer Mensch, dem privat viel Schlimmes widerfahren ist. Seine Ehefrau ist nach langer Krankheit gestorben, die Tochter fortgezogen. Nun ist er allein und grübelt zu viel. Der Dienst leidet aber nicht darunter, was nur gut ist, als in einer lauen Spätsommernacht die Leiche der Tänzerin Charlene Mortensen entdeckt wird; die junge Frau wurde erschlagen. Mord ist ein seltenes Delikt in St. Paul. Die Polizisten schwärmen aus, doch Eifer ersetzt solide Fahndungsarbeit. Ein Täter muss her, und das möglich rasch, denn Presse und Öffentlichkeit werten jede Verzögerung als Schwäche. Da ist die Versuchung groß, die Ermittlungen ein wenig abzukürzen. Es dauert auch nicht lange, bis Herbert White ins Visier der Beamten gerät. Er passt nicht nur gar zu gut in ihr beschränktes Weltbild, sondern eignet sich auch hervorragend als Hauptverdächtiger. Sein umständliches Verhalten, seine angeblichen Gedächtnislücken und sein ungewöhnliches Hobby verschaffen ihm einen schweren Stand. Gar zu gern würden Welshinger und Trent ihm die Bluttat anhängen. Zwar ist die Indizienkette mehr als dünn, doch dem ließe sich nachhelfen …
Als „Mr. White’s Confession“ 1999 von den ehrwürdigen „Mystery Writers of America“ als bester Kriminalroman des Jahres mit dem „Edgar Allan Poe Award“ ausgezeichnet wurde, war niemand erstaunter als Robert Clark, der niemals einen klassischen Thriller im Sinn hatte, als er die traurige Geschichte des Herbert White niederschrieb. Nachdem man sie gelesen hat, versteht man ihn gut, denn in der Tat steht „Das Verbrechen …“ zwischen den Genres: Krimi, Liebesgeschichte, historischer Rückblick, psychologische Studie – das alles und noch mehr steckt in der Geschichte, die trotzdem ein harmonisches und sehr stimmiges Ganzes ergibt und glänzend ihren Verfasser bestätigt, der es ablehnt, sich in literarische Schubladen sperren zu lassen.
Ist der Leser bereit, über seinen (oder ihren) Schatten zu springen und sich auf die Geschichte einzulassen, bleibt die Belohnung nicht aus. Ja, es ist wahr: In diesem Roman geschieht nicht gerade viel, und es gibt eigentliche keine Figur, die wirklich sympathisch wäre. Das schließt Herbert White, den tragischen Anti-Helden, ausdrücklich mit ein. Sogar die wenigen Polizisten, die sich tatsächlich bemühen, Recht und Ordnung zu vertreten, sind recht unbedarft und leicht auf falsche Fährten zu locken. Das mindert jedoch in keiner Weise die Wirkung einer ganz spezifischen Rekonstruktion des Jahres 1939. Dabei beschränkt sich Robert Clark auf ganz wenige Pinselstriche, wenn er das St. Paul von einst wiedererstehen lässt. Er hat es nicht nötig, Authentizität durch ausufernde historische Reiseberichte zu erzwingen. Die Vergangenheit wird nur dort beschworen, wo sie für die Handlung relevant ist.
Die scheint wiederum Jim Thompson Recht zu geben, der stets der Meinung war, die scheinbare Idylle der kleinen Stadt, in der jeder jeden kennt und man sich stets untereinander hilft, könne sich als arger Saustall entpuppen, in dem es genauso schmutzig zugeht wie in der verluderten Metropolis. Doch Clark ist kein Zyniker wie Thompson, und St. Paul kein Höllenpfuhl, sondern einfach ein Ort, bewohnt von Menschen, die grundsätzlich bemüht sind, ihr Leben regelkonform zu führen. Das schützt sie nicht vor dem Scheitern: „Das Verbrechen des Mr. White“ ist eine ganz einfache Geschichte, wie sie das Leben tatsächlich manchmal schreibt, und weil ihr Verfasser sein Handwerk versteht, liest sie sich trotzdem spannend. Das Ausbleiben einer Auflösung ändert daran gar nichts. Wer zwischen den Zeilen liest, wird den wahren Mörder ohnehin selbst erkennen. Gewissheit gibt es allerdings nicht: Clark verstreut sehr geschickt Andeutungen und Indizien über den ganzen Text, die neben dem boshaften Welshinger noch andere Verdächtige zulassen. Auch Herbert White wird nie völlig entlastet. So bleibt dem Leser die Entscheidung überlassen.
St. Paul ist übrigens kein fiktiver Ort; er existiert tatsächlich, und Robert Clark ist dort geboren und aufgewachsen. Inzwischen ist er mit Ehefrau und zwei Kindern in Seattle ansässig.
Sidor, Steven – Skin River
Seit anderthalb Jahren ist Buddy Bayes Besitzer der Black Chimney Tavern. Außerhalb Gunnars, einer kleinen Stadt im Nordosten des US-Staates Wisconsin einsam gelegen, ist die Kneipe ein beliebter Treffpunkt für Urlauber, Jäger und Fischer. Sie ist aber auch ein Versteck für Bayes, der in seiner Heimatstadt Chicago den Gangster Red um viel Geld betrogen hat und sich nun verborgen halten muss, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Buddy hat sich eingelebt und in der jungen Mutter Margot auch eine Freundin gefunden; er ist zufrieden.
Natürlich meidet er tunlichst öffentliche Aufmerksamkeit. Daher ist es schlecht, dass ausgerechnet er die Überreste der jungen Melissa Teagles im Skin River treibend findet. Sie ist dem „Ziegenhäuter“ in die Hände gefallen, einem psychopatischen Serienkiller, der seine Opfer mit dem Messer jagt und zerlegt. Die Existenz eines unsichtbar bleibenden Killers, der womöglich zu den Einheimischen gehört, übersteigt das Verständnis des kriminalistisch nur bedingt fähigen Sheriffs Glen Rafferty. Er hält sich an Buddy Bayes, den Neuling in der Gemeinde, der sich ihm als Verdächtiger anbietet.
Notgedrungen muss sich Bayes selbst als Detektiv versuchen. Leider fehlt ihm jede Erfahrung. Seine ungeschickten Ermittlungen bringen den düpierten Red und seine Schergen auf seine Spur. Sie wollen das unterschlagene Geld, und sie wollen Bayes strafen. So wird der Kneipenwirt plötzlich von zwei Seiten unter Druck gesetzt. Zu allem Überfluss wird der „Ziegenhäuter“ auf Bayer aufmerksam. Er stellt ihm eine Falle und plant seine Form von Vergeltung, denn er hat ein Auge auf Margot geworfen …
Solche Thriller liest man gern: Eine einfache und bewährte Story wird mit diversen Hakenschlägen in einen rasanten Thriller verwandelt. „Skin River“ ist stets für eine Überraschung gut. Der Plot wird ordentlich gegen den Strich gebürstet: Die Hauptfigur selbst ist es, die ihren Untergang einleitet. Längst hat der von ihm gefoppte Gangster seine Niederlage als böse Erfahrung abgehakt – er denkt gar nicht daran, seine Zeit damit zu vergeuden, nach Buddy zu suchen. Der hat sich völlig unnötig in der Wildnis eingegraben und tritt jetzt denkbar ungeschickt seinem Gegner noch einmal auf die Füße.
Auf dieser Welt geht eben schief, was schiefgehen kann. „Murphys Gesetz“ ist ein wichtiges Element dieses Romans. Kein Zufall ist so irrwitzig, dass es ihn nicht geben könnte. Bemerkenswerterweise erscheint dem Leser dies nie seltsam, übertrieben oder unlogisch: Sidor hat seine Geschichte vor allem in ihren ersten beiden Dritteln fest im Griff.
Danach wird das bisher so dichte Handlungsgefüge ein wenig löchrig. Der Verfasser muss einen Weg finden, die einzelnen Fäden seiner Story, die er so kundig gesponnen hat, für das Finale zu einem soliden Knoten zu verknüpfen. Hier zeigen sich leichte Schwächen, denn Sidor wählt den einfachen Weg und inszeniert eine wilde Verfolgungsjagd, die einerseits in eine mörderische Abrechnung zwischen Bayes und dem Gangster und andererseits in der Entlarvung des „Ziegenhäuters“ mündet. Das ist wiederum sehr spannend, aber nicht raffiniert.
Das trifft auch auf die Figurenzeichnung zu. Selten treten uns die Protagonisten eines Thrillers so plastisch vor das innere Auge wie hier. Mit Buddy Bayes hat Sidor einen zwielichtigen „Helden“ geschaffen. Anfänglich schildert er uns einen sympathischen Zeitgenossen, der mit seiner verbrecherischen Vergangenheit abgeschlossen hat. Bayes hat einen Schurken betrogen, das ist ja nicht so „schlimm“. Nun führt er eine Kneipe, kommt gut mit seinen Gästen aus und knüpft sogar zarte Bande zu einer schönen Frau.
Dann holt besagte Vergangenheit ihn nicht etwa ein. Bayes weckt sie, denn er hat noch eine zweite, deutlich düsterere Seite. Wenn er in Chicago prüft, ob man ihm auf den Fersen ist, kommt plötzlich der „alte“ Bayes zum Vorschein – ein gewiefter Krimineller, für den Gewalt ein alltägliches „Instrument“ ist. Dieser Bayes droht, schlägt und schießt. Er ist deshalb kein Psychopath, sondern erledigt nüchtern seinen „Job“. Erst weil wir diesen Bayes kennen gelernt haben, erscheint uns die gewaltige Schießerei in und um Buddys Kneipe nicht unwahrscheinlich: Die Situation ist nicht unbedingt neu für unseren bedrängten Mann, und deshalb meistert er sie.
Die zweite zentrale Gestalt des „Skin River“-Dramas ist der „Ziegenhäuter“, ein Psychopath der ganz finsteren Sorte. Sidor schildert ihn erfreulich realistisch nicht als diabolisch genialen Übermenschen, der auf überkomplizierte Art killt und quasi nebenbei die verfolgende Polizei mit sardonischen Scherzen neckt. Sein „Ziegenhäuter“ ist ein Mensch, der von seinem dunklen Trieb beherrscht wird. Mit diesem Drang hat er sich arrangiert, er ist ein „organisierter“ Serienmörder, der seine Spuren verwischt und es im Laufe vieler Jahre auf eine bedrückend beeindruckende Jagdstrecke gebracht hat, ohne auch nur in Verdacht zu geraten.
Doch seine psychische Situation ändert sich. Sidor schildert einen „Ziegenhäuter“, der die Kontrolle über sich zu verlieren beginnt. Die inneren Stimmen in seinem Kopf werden so laut, dass er sich nicht mehr darauf konzentrieren kann, seine Tarnung als liebenswert unkonventioneller Außenseiter in der Gemeinde Gunnar aufrechtzuerhalten. Er wird schlampig, versteckt seine Opfer nicht mehr, sondern präsentiert sie. Größenwahn erfüllt ihn. So würde er sich irgendwann sogar dem engstirnigen Sheriff Rafferty verraten, doch da ist Buddy Bayes. Zwar ist der „Ziegenhäuter“ verrückt, doch dumm ist er nicht. Deshalb legt er falsche Spuren, die Bayes in Verdacht geraten lassen.
Schließlich erfolgt der geistige Zusammenbruch so schnell, dass dem „Ziegenhäuter“ solche Schlichen und seine Maske gleichgültig werden. Der Wahn beherrscht ihn vollständig. Diesen Prozess weiß Sidor eindringlich zu schildern. Der „Ziegenhäuter“ ist auf der einen Seite selbst ein Opfer. Die berühmt-berüchtigte „gestörte Kindheit“ hat ihn geprägt und die Saat für seinen Krankheit gelegt. Auf der anderen Seite ist der „Ziegenhäuter“ womöglich ein Psychopath von Geburt an. Sidor legt sich hier nicht fest und folgt damit der Forschung, die weiterhin nicht wirklich weiß, wie ein Serienmörder „entsteht“ oder „funktioniert“.
Zu guter Letzt bleibt vom „Ziegenhäuter“ nur das groteske Zerrbild eines Menschen. Sidor schildert ihn etwa wie den alten Ed Gein, den berüchtigten Mörder und Leichenschänder, der u. a. als Vorbild für den Horrorfilmklassiker [„Texas Chainsaw Massacre“]http://www.powermetal.de/video/review-58.html diente. Seine letzten Jahre verbrachte Gein in einem Sanatorium für geisteskranke Kriminelle: ein geistig zerbrochener, täuschend friedlicher Mann, der nach Ansicht seiner Ärzte jedoch weiterhin von seinen Dämonen getrieben wurde. Der „Ziegenhäuter“ ist so wahnsinnig geworden, dass sich die in ihm aufgestaute Gewalt nicht mehr gegen unschuldige Opfer, sondern gegen sich selbst entlädt: Die Bestie zerstört sich selbst.
Auch den Randfiguren schafft Sidor detaillierte Biografien. Hier übertreibt er es in seinem Eifer allerdings, denn der Aufwand lohnt sich nur bedingt. So wichtig werden Figuren wie Sheriff Rafferty, Margot oder Gangster Red nicht, dass sie uns so aufwändig vorgestellt werden müssten. Andererseits fällt auch hier auf, wie geschickt der Autor Klischees vermeidet. Er vervollständigt damit das erfreuliche Bild eines Thrillers, der es keineswegs verdient, im Meer jener Durchschnittskrimis zu versinken, die Monat für Monat auf den deutschen Buchmarkt geworfen werden. Das kann leider leicht geschehen, denn sowohl die Aufmachung als auch der alles und gleichzeitig nichts sagende Covertext verschleiern erfolgreich, welches Kleinod hier auf seine Leser wartet!
Viel ist noch nicht bekannt über Steven Sidor, der bisher nur zwei Romane geschrieben hat und ein drittes Werk für 2007 ankündigt. Auch seine [Website]http://www.stevensidor.com zeichnet sich in biografischer Hinsicht durch bestürzende Kargheit aus. Den knappen Verlagsinfos lässt sich entnehmen, dass Sidor das Grinnell College besuchte und an der University of North Carolina in Chapel Hill studierte. Er arbeitete anschließend in der Betreuung psychisch kranker Menschen. Heute lebt Sidor mit seiner Familie in der Nähe von Chicago.
http://www.knaur.de
Richard Matheson – Der letzte Tag

Richard Matheson – Der letzte Tag weiterlesen
Keene, Brian – Reich der Siqqusim, Das
|“Auferstehung“|, S. 3-246: Eigentlich sollten die aktuellen Experimente mit dem Nuklearbeschleuniger der Havenbrook National Laboratories in Hellerton, US-Staat Pennsylvania, das Wissen um die Bausteine des Universums erweitern. Stattdessen öffneten sie eine Pforte zwischen den Dimensionen, die besser verschlossen geblieben wäre: Aus der „Leere“, in die sie einst verbannt wurden, kommen die Siqqusim, die der Mensch als „Dämonen“, „Teufel“ und unter vielen anderen Namen kennt, auf die Erde zurück. Sie werden körperlich, indem sie in die Leichen toter Menschen und Tiere fahren. Intelligente und bösartige Zombies führen einen blutigen Krieg gegen die verhassten Menschen, die auf der ganzen Welt massakriert und gefressen werden.
Eine kleine Gruppe verzweifelter Männer und Frauen stemmt sich gegen den Untergang. Da ist Jim Thurmond, der seinen Sohn Danny retten will, nachdem ihn dessen letzter telefonischer Hilferuf aus New Jersey erreichte, wo er mit seiner Mutter lebt. Ihm schließt sich der Pfarrer Thomas Martin an, der Gott in der derzeitigen Apokalypse sucht. Zu ihnen stoßen Frankie, eine drogensüchtige Prostituierte, die aus den Ruinen der Stadt Baltimore entkam, und Professor William Baker, der wissenschaftliche Leiter von Havenbrook und mitverantwortlich für das Inferno. Man schlägt man sich durch ein Land der Sterbenden und der Toten, die sich mit buchstäblich teuflischer Schläue auf die Spur der Reisenden setzen. Doch immer noch ist der schlimmste Feind des Menschen der Mensch selbst – hier in Gestalt des Colonels Schow. Er schwingt sich zum Herrscher seines eigenen Reiches auf, das er mit seinen Soldaten als Diktator beherrscht und dessen „Bürger“ er in Sklaven verwandelt …
|“Stadt der Toten“|, S. 247-490: Nachdem Schow geschlagen und Danny gerettet werden konnte, können sich die wenigen Überlebenden aus „Auferstehung“ in den festungsartig gesicherten Ramsey Tower in New York durchschlagen. Hier hat sich der Milliardär Darren Ramsey zum Schutzherrn von 300 Menschen ernannt, die den Zombies entkommen konnten. Nur Leibwächter Bates weiß, dass Ramsey unter einem ausgewachsenen Messiaskomplex leidet und allmählich den Bezug zur Realität verliert. Bates trifft bereits Vorkehrungen, denn er glaubt nicht an die Sicherheit des Turms.
Inzwischen setzt Dämonenfürst Ob den Feldzug zur Eroberung der Erde fort. Ramsey Tower ist ihm ein Dorn im Auge, denn hier hält sich das verhasste „Fleisch“ hartnäckig gegen die Attacken der Siqqusim. Ob bereitet deshalb einen massiven Angriff vor. Er zieht das Millionenheer der Zombies, die einst New Yorks Bürgerschaft bildeten, zusammen und rüstet es mit schweren Waffen aus. Ob steht unter Zeitdruck, denn in der „Leere“ warten bereits die Dämonenstämme der Elilum und Teraphim voller Ungeduld auf ihren Durchbruch in die reale Welt. Doch Ob will seine Rache an den verhassten Menschen und ihrem Schöpfer auskosten und sperrt sich gegen die Invasion seiner „Kollegen“, die den endgültigen Untergang der Erde einleiten würden.
Während Ob seine Truppen formiert, hält Ramsey in seinem Wahn eine Eroberung des Towers für unmöglich. Bates sucht und findet einen möglichen Fluchtweg, doch sein irrsinniger Chef kann ihn austricksen. Der Sturm auf Ramsey Tower findet statt und wird zur letzten Schlacht zwischen Menschen und Dämonen. Zwischen allen Fronten kämpfen wieder Jim Thurmond, Sohn Danny, Frankie und einige neue Mitstreiter um ihr Leben, das von den Untoten ebenso bedroht wird wie von den Lebenden, die selbst angesichts des nahen Endes von Egoismus und Eigennutz getrieben werden …
Da sind sie wieder einmal – die Zombies, noch mehr als die Werwölfe proletarische Schmuddelkinder des Horrorgenres. Sie sind schrecklich anzuschauen (und zu riechen) und benehmen sich auch so. Allerdings endet hier die Ähnlichkeit zwischen den „klassischen“ Zombies, deren Gestalt und Verhalten von George A. Romero definiert wurden, und den Siqqusim, die Brian Keene auf die Menschheit loslässt. Während Erstere von diffusen Urinstinkten und der Gier nach Menschenfleisch getrieben werden, sind Letztere buchstäblich von Dämonen beseelt, die nach äonenlanger Verbannung in menschliche Leichen fahren und weder blöd noch unbeholfen, sondern sehr zielorientiert ihren Gemeinheiten frönen.
Die daraus entstehende Apokalypse schildert Keene auf eigentlich wenig originelle Weise. Was die Zombiefizierung der Welt tatsächlich bedeutet, erfahren wir nur nebenbei. Keene konzentriert sich lieber auf einige Figuren, die stellvertretend für die Menschen der (nordamerikanischen) Welt mit der neuen Situation konfrontiert werden. Sie begeben sich auf ihre private Questen, deren Ziele die Ankunft an einem hoffentlich sicheren Ort bzw. die Rettung geliebter Familienmitglieder darstellen. Bis es so weit ist, bildet der Weg dorthin eine Kette gefährlicher Abenteuer – ein simples Handlungsgerüst, das freilich gut funktioniert, wenn es so geschickt mit Inhalt gefüllt wird wie durch Keene.
Wobei die Kompromisslosigkeit, mit der Keene zu Werke geht, eine wichtige Rolle spielt. Er verzichtet auf eine politisch korrekte Dämpfung des Schreckens. Schwangere Frauen, Kleinkinder, Priester, Ärzte, Polizisten und andere normalerweise sakrosankte Respektspersonen reihen sich nahtlos ein in sein Kaleidoskop des Grauens. Sie werden konsequent ausgelöscht, wenn ihre Stunde gekommen ist, und wirken besonders abstoßend, wenn sie als Untote wiederkehren, denn Keene spart nie mit Einzelheiten, wenn gemordet oder gemetzelt wird.
Die wenig innovative aber funktionierende Handlung wird durch diverse hübsche & hässliche Einfälle horribel aufgeladen. Damit sind nicht einmal die Splattereffekte gemeint, obwohl diese mit viel Liebe zum faulig-blutigen Detail und mit immer neuen Schauerlichkeiten beschrieben werden (bis man sich – darf man es so ausdrücken? – daran „satt“ gelesen hat).
Nein, Keene hat sich Gedanken zum Zombie-„Leben“ gemacht, die längst überfällig waren, aber auch in den aktuellen Filmen ignoriert werden. Wieso sind Zombies so stark, obwohl sie doch sichtlich verwesen und verfallen? Wie überleben sie, obwohl sie ihrer Nahrung – Menschenfleisch – irgendwann nicht mehr in erforderlicher Quantität habhaft werden können? Keene „erklärt“ diesen Widerspruch überzeugend: „Seine“ Zombies fressen Menschen, weil sie ihnen schmecken. Ansonsten hält sie eine unbekannte Kraft zusammen, die den Verlust lebenswichtiger Organe oder Gliedmaßen kompensiert. So können sie quasi bis zum Skelett verfaulen und trotzdem agil bleiben.
Keene berücksichtigt außerdem einen weiteren, eigentlich naheliegenden Gedanken: Wenn tote Menschen neu „belebt“ werden, gibt es keinen logischen Grund, dass Tiere ausgespart bleiben – sie sind ebenfalls Lebewesen! Die Notlage der lebenden Menschen verschärft sich um ein Vielfaches, wenn sie nunmehr auch den Attacken untoter Hunde, Katzen oder Vögel ausgesetzt sind. Keene geht noch einen Schritt weiter: Die beliebte Flucht in die zombiefreie Wildnis fällt bei ihm aus, denn dort, wo keine untoten Menschen auf ihre Opfer lauern, hausen jetzt neu „belebte“ Bären, Hirsche und andere Wildtiere, die ihre Ernährungsroutinen radikal umgestellt haben. Einige grandiose Szenen verdanken ihre Wirkung dem bizarren Effekt dieser Tierzombies: So wird der unglückliche Baker einmal von blutgierigen Eichhörnchen und Karnickeln durch die Wälder gehetzt. Hitchcock hatte Recht, als er Vögel als potenzielle Gegner der Menschen brandmarkte. Frankie erlebt Grausiges, als sie von den in ihren Käfigen und Gehegen verhungerten und wieder belebten Kreaturen des Zoos in Baltimore gejagt wird; ein Zombie-Löwe ist ein wahrlich erschreckender Gegner!
„Auferstehung“, der 2003 entstandene erste Teil von „Das Reich der Siqqusim“, ist der mit Abstand bessere Teil der Saga. Keene bleibt vage mit seiner Hintergrundgeschichte, was klug ist, wie wir erkennen, wenn er sie in „Stadt der Toten“ doch enthüllt. Zwei Jahre später als Teil 1 geschrieben, nahm sich Keene die Kritik seiner Leser zu Herzen; leider meldeten sich offensichtlich nur jene zu Wort, die mit der reizvollen Diffusität der „Auferstehung“ und dem offenen Ende dieses Buches überfordert waren und Aufklärung forderten.
Die Handlung setzt nahtlos im Finale des Vorgängerbandes ein und nimmt den sattsam bekannten Verlauf: Alles rennt, rettet, flüchtet sich vor den Zombiehorden, die stets aus allen Richtungen herbeiströmen und doch zuverlässig ins Leere greifen, bevor sie unseren Helden das wortreich angedrohte Ende bereiten können.
„Wortreich“ ist das Stichwort für weitere Kritik: In „Stadt der Toten“ werden die Zombies erstaunlich schwatzhaft. Das schließt ihren Anführer Ob ausdrücklich ein. Wirklich nur grinsen kann man bei der Lektüre einer Szene, in der er sich genötigt sieht, ausgerechnet einer völlig unwichtigen Nebenfigur (und uns Lesern) haarklein die Geschichte der Siqqusim sowie die Planungen zur Übernahme der Universums – Gottes Sturz vom Himmelsthron eingeschlossen – zu erzählen. (Dazu weiter unten mehr.)
Solche unfreiwillig komischen Momente mehren sich leider; Keene wusste offensichtlich, wieso er „Aufstehung“ in Momentaufnahmen einer Gesamthandlung gestaltete, die sich die Leser selbst zusammenreimen konnten und mussten. Für die Inszenierung einer biblisch-monumentalen Konfrontation zwischen Gut & Böse fehlt ihm offenkundig das schriftstellerische Format. „Stadt der Toten“ verkommt in dieser Hinsicht zum Kasperle-Theater.
Auch sonst kommt die Story im breiten Mittelteil buchstäblich zum Stillstand. Die Lebenden verbarrikadieren sich in einem festungsgleichen Hochhaus, das von den Siqqusim belagert wird. Wie die Geschichte nunmehr ablaufen wird, ist einfach zu erraten, vor allem für diejenigen unter uns, die Romeros „Land of the Dead“ gesehen haben; der Horrorfilm-Altmeister hat sich anscheinend stark von „Stadt der Toten“ „inspirieren“ lassen …
Natürlich gelingen Keene neuerlich Szenen, die im Gedächtnis bleiben. Sex mit Zombies ist beispielsweise ein bisher im Horrorgenre unerwähnt gebliebener Aspekt. (Nicht, dass wir ihn vermisst hätten …) Auch Frankies Sturz in ein schmutziges Schwimmbecken, das zu allem Überfluss von einer hungrigen Wasserleiche bevölkert wird, jagt Schauder über Leserrücken. Doch andere Konfrontationen stellen nur Wiederholungen sattsam bekannter Schnetzeleien dar, deren Wirkung verpufft ist. Überstrapaziert wird vom Verfasser in „Stadt der Toten“ auch das Prinzip des Cliffhangers: Immer wenn unsere Menschenhelden in einer schier aussichtslosen Situation stecken, bricht die Handlung ab und schwenkt zu einem anderen Punkt des Geschehens. Irgendwann tauchen die Verdammten wieder auf und wir erfahren, dass besagte Not gar nicht so groß war, weil … und es folgt eine enttäuschende Erklärung. „Stadt der Toten“ wirkt verglichen mit „Auferstehung“ wie Routine oder eine Pflichtübung, zu der sich der Verfasser von seinem Verlag oder seinen Lesern überreden ließ.
Normalbürger werden mit dem Unbeschreiblichen konfrontiert: Es ist ein bewährtes Prinzip, das uns in holzschnitthafter Prägnanz vor allem aus Hollywoods Horror- und Katastrophenfilmen vertraut ist. Am Beispiel von Menschen, die eben keine omnipotenten Superhelden sind, werden Grundzüge der menschlichen Psyche herausgearbeitet. Keene wandelt hier auf vertrauten Pfaden. Da haben wir u. a. den schlichten „Mann aus dem Volk“, der Himmel und vor allem Hölle in Bewegung setzt, um seinen über alles geliebten Sohn zu retten. Zu ihm gesellen sich: die Nutte mit Herz, die sich im Rahmen dieser edlen Mission bewähren und somit „reinwaschen“ darf; der reuevolle Wissenschaftler, der zu neugierig war und das Verderben über die Welt brachte; der standhafte Pfarrer, der noch in der Apokalypse einen göttlichen „Sinn“ findet. Konfrontiert werden sie mit weiteren Klischeefiguren wie dem überschnappten Militär, der Kaiser von China (oder Ähnliches) werden will; dem geilen Spießer, der endlich die Sau rauslassen kann; dem feigen Mitläufer; dem Psychopathen, der mit den Untoten um die Wette murksen darf. Zombies sind Monster, so Keenes Credo, aber die Menschen stehen ihnen auf ihre Art wenig nach. Der Verfasser ist ein Pessimist, der nicht davon ausgeht, dass eine elementare Krise den Zusammenhalt fördert. (Anmerkung: In einem Spektakel wie diesem lässt man dem Verfasser die Klischees insgesamt durchgehen; im Detail muss Keene freilich für die Erfindung der schrecklichsten Kinderfigur gegeißelt werden, mit der man in den letzten Jahren gequält wurde. Danny – „Ich will meinen Daddy!“ – ist ein schafsblödes Balg, das prompt dann in Schreckstarre verfällt, ins Stolpern gerät oder sich in einer Telefonzelle verläuft, wenn gerade tausend geifernde Zombies um die Ecke biegen.)
Keenes Siqqusim-Zombies wurden weiter oben bereits für ihre Bedrohlichkeit gelobt. Erste Kritik schimmerte ebenfalls durch: Je länger die Dämonen wüten, desto deutlicher fällt auf, dass sie geistig wohl doch keine Leuchten sind. Diese Vermutung wird in „Stadt der Toten“ zur traurigen Gewissheit. Hier reden die Zombies nicht nur, sie kalauern plötzlich wie deutsche Comedians auf einem ihrer spätpubertären TV-Gipfeltreffen. Die dümmsten Sprüche fließen ihnen von den verrottenden Lippen, während sie in Stücke geschossen, gesäbelt oder gefahren werden. Nun mögen Dämonen nicht zu den Intellektuellen dieser oder einer anderen Welt zählen. Man sollte in einem Horrorroman allerdings nicht über sie lachen müssen. Bei näherer Betrachtung wirken sie in „Stadt der Toten“ so „böse“ wie die klassischen |Marvel|-Schurken: Erst stellen sie sich hin und beschreiben ausführlich, was sie gleich anrichten werden, dann tun sie es, wobei ihr Mund auch nicht stillsteht, und anschließend stoßen sie sich in die Rippen und schwelgen in lustvollen Erinnerungen daran, was für verkommene Mistkerle sie sind. Das kommt so lächerlich an, wie es klingt; keineswegs singulär in ihrer Wirkung ist eine Szene, in welcher der Siqqusim-Fürst schwer beleidigt ist, weil die Menschen nicht wissen, wer sie drangsaliert: „Ich werde siebzehn Mal im Alten Testament erwähnt! Siebzehn Mal! Ich bin Ob der Obot! Ich führe die Siqqusim an! … Ich bin Ob, der aus dem Kopf spricht!“ Schon traurig, wenn man mit solchen Referenzen vor eine Menschheit tritt, die nicht mehr so bibelfest wie einst ist …
Im Finale findet Keene, das muss zu seiner Ehrenrettung gesagt sein, zur alten Form zurück. So konsequent & kohlrabenschwarz endete sicher kaum ein Roman zum Thema Weltuntergang. Üblicherweise blitzt irgendwo ein Lichtlein auf: Es wird trotz aller Qualen weitergehen. Hier nicht, und obwohl Keene tröstliche Visionen eines kitschigen Kinderbibel-Paradieses einschneidet, mildert es nicht die Wucht eines Endes aller Dinge, das beeindruckt und überzeugt: ganz großes Kino, Mr. Keene!
|Exkurs: Die deutsche Inkarnation|
„Das Reich der Siqqusim“ glänzt in seiner deutschsprachigen Ausgabe mit äußeren und inneren Werten. Was Erstere angeht, so orientierte man sich im |Otherworld|-Verlag offenbar an der US-amerikanischen Erstauflage, die im kleinen aber feinen Haus |Delirium Books| erschien. So erhält der Leser (und Sammler) für sein Geld nicht nur ein gebundenes, sondern ein richtig gut gebundenes Buch; wer fragt, was denn da der Unterschied sei, nehme eine dieser lieblos produzierten Schwarten in die Hand, die von modernen Buchfabriken auf den Markt geworfen werden und schon beim ersten Öffnen unheilverkündend krachen, weil man sie mehr schlecht als recht und viel zu eng in ihre Einbände presste.
Dazu gibt es ein Schutzcover aus steifem, d. h. widerstandsfähigem Papier und mit einem schaurig-schönen Titelbild von Anne Stokes – kein Foto aus einem billigen Bildstock! Zwei fies anzuschauende Innenillustrationen steuerte Jan Balaz bei. Ein Lesebändchen findet man auch, und ein Personenverzeichnis am Ende des Buches hilft, die zahlreichen Figuren zuzuordnen, sollte die Übersicht verloren gehen.
Die Übersetzung kann sich sehen bzw. lesen lassen – dieses knappe Urteil beschreibt gute, i. S. von „unsichtbare“ Textarbeiter im Hintergrund, die fremde Wörter so flüssig in unsere Muttersprache übertragen, dass es bei der Lektüre gar nicht auffällt. Wenn man als Leser überhaupt über etwas stolpert, dann vielleicht über die ungewöhnlich kleine Schrift. In diese 500 Seiten wurde deutlich mehr Text als üblich gepackt, was den Eindruck unterstreicht, dass einem mit „Das Reich der Siqqusim“ wirklich etwas für sein Geld geboten wird! Diverse Seiten fallen durch ihren noch einmal engeren Zeilenabstand aus dem Gesamtbild; auch eine Anzahl unkorrigiert gebliebener Rechtschreibfehler zeigt, dass es mit der (Schluss-)Redaktion wohl (noch) ein wenig hapert – das ewige Problem kleiner Verlage, die mit viel Enthusiasmus und Liebe, aber wenig Geld zu Werke gehen (müssen).
_Brian Keene_ (geboren 1967) wuchs in den US-Staaten Pennsylvania und West Virginia auf; viele seiner Romane und Geschichten spielen hier und profitieren von seiner Ortkenntnis. Nach der High School ging Keene zur U.S. Navy, wo er als Radiomoderator diente. Nach Ende seiner Dienstzeit versuchte er sich – keine Biografie eines Schriftstellers kommt anscheinend ohne diese Irrfahrt aus – u. a. als Truckfahrer, Dockarbeiter, Diskjockey, Handelsvertreter, Wachmann usw., bevor er als Schriftsteller im Bereich der Phantastik erfolgreich wurde.
Schon für seinen ersten Roman – „The Rising“ (2003), eine schwungvolle Wiederbelebung des Zombie-Subgenres – wurde Keene mit einem „Bram Stoker Award“ ausgezeichnet. Ein erstes Mal hatte er diesen Preis schon zwei Jahre zuvor für das Sachbuch „Jobs In Hell“ erhalten. Für seine Romane und Kurzgeschichten ist Keene seitdem noch mehrfach prämiert worden. Sein ohnehin hoher Ausstoß nimmt immer noch zu. Darüber hinaus liefert er Scripts für Comics nach seinen Werken. Außerdem ist Keene in der Horror-Fanszene sehr aktiv. Sein Blog „Hail Saten“ gilt als bester seiner Art; die Einträge wurden in bisher drei Bänden in Buchform veröffentlicht.
Brian Keene hat natürlich eine Website, die sehr ausführlich über sein Werk und seine Auftritte auf Lesereisen informiert (www.briankeene.com). Über den Privatmann erfährt man allerdings nichts; es gibt nicht einmal die obligatorische Kurzbiografie.
|Originaltitel: The Rising (North Webster : Delirium Books 2003) & City of the Dead (North Webster : Delirium Books 2005)
Übersetzung: Michael Krug|
http://www.otherworld-verlag.de
Collins, Max Allan / Clemens, Matthew V. / Reichs, Kathy – Bones – Die Knochenjägerin: Tief begraben
In diesen heißen Herbsttagen hält sich Special Agent Seeley Booth vom FBI in Chicago auf, wo er hofft, endlich den Fall Gianelli zum Abschluss zu bringen. Vater Raymond und Sohn Vincent üben seit vielen Jahren ihr mafiöses Terrorregime aus, ohne dass sie jemals zur Rechenschaft gezogen werden konnten. Nun hat sie ausgerechnet Stewart Musetti, ihr Auftragskiller, verraten und sich den Behörden gestellt. Booth und seine Kollegen haben sich allerdings zu früh gefreut: Aus seinem angeblich geheimen Versteck verschwindet Musetti mitsamt den vier FBI-Männern, die ihn beschützen sollten, spurlos. Die Gianellis werden wohl wieder einmal triumphieren, was Booth schier in den Wahnsinn treibt.
Nun wird ihm der Fall auch noch entzogen, denn ein Unbekannter legte ein „Geschenk“ ausgerechnet vor dem FBI-Büro in Chicago ab: ein Skelett, dessen Knochen sorgfältig mit Draht fixiert wurden. Sind dies die Überreste des Überläufers Musetti? Booth will sichergehen und fordert Dr. Temperance Brennan an. Die berühmte Anthropologin arbeitet für das Jeffersonian Museum in Washington, D. C., und hat dem FBI und Booth schon mehrfach hilfreich zur Seite gestanden.
Auch dieses Mal kann sie helfen, obwohl ihre Untersuchung für Schrecken und Missmut sorgt: Das Skelett setzt sich aus den Knochen von mindestens vier Menschen zusammen, die in einem Zeitraum von vier Jahrzehnten starben! Der potenzielle Mörder schickt einen Brief, in dem er sich seiner Taten brüstet und das FBI auffordert, ihn zu fangen. Er erhöht den Einsatz, indem er wenig später einen weiteren Skelett-„Bausatz“ auslegt.
Dank eines aufmerksamen Polizeibeamten kann ein Serienmörder gefasst werden, unter dessen Haus sich viele Leichen finden. So gilt dieser Fall als abgeschlossen, doch dann taucht ein drittes Skelett auf. Nichts ist wirklich geklärt, es gibt immer noch mehrere offene Fälle, von denen einer bis in die Ära des legendären Chicagoer Gangsterbosses Al Capone zurückreicht …
Die TV-Serie „Bones“ gehört zu jenen heute sehr beliebten Pathologenkrimis, die ihr Stück vom „CSI“-Kuchen zu ergattern suchen, indem sie die Schraube in Sachen Mord & Totschlag noch einige Umdrehungen anziehen. Nie sind es einfach „nur“ Leichen, die der Forensikerin Temperance Brennan auf den Untersuchungstisch gelegt werden. Stets ist etwas seltsam oder bizarr, sehr gern präsentieren sich die Überreste optisch spektakulär, d. h. sind scheußlich anzusehen.
An das aus dem Fernsehen bekannte Schema hält sich Autor Collins, der abermals einen seiner überdurchschnittlichen „Romane zur Serie“ vorlegt (statt eigenständige Werke zu verfassen, die seine Klasse eindrucksvoll unterstreichen). Wie es seine Art ist, kupfert er nicht die Vorlagen ab, sondern erweitert das vor allem in der Figurenzeichnung etwas stereotype Bild (s. u.) durch eigene Ergänzungen, die auch der Story sehr gut stehen.
Schon der Prolog stimmt auf eine mysteriöse Geschichte ein. Er führt zurück in die Jahre des II. Weltkriegs, die Chicago weiterhin als „Revier“ des organisierten Verbrechens zeigen, das einst Al Capone in die Stadt gebracht hatte. Collins profitiert hier von seinen Recherchen zu einer eigenen Serie historischer Krimis um den Privatdetektiv Nate Heller, die sicherlich zum Besten gehören, was das Genre zu bieten hat.
Der Forderung nach möglichst kniffligen Mordfällen leistet der Autor Folge, indem er einen Serienmörder ins Spiel bringt, der Skelettpuzzles fabriziert. Damit sind ideale Voraussetzungen für den Auftritt von „Bones“ Brennan gegeben, die zwar ständig darüber schimpft, dass man sie von dringlichen Eigenforschungen abhält, um sogleich mit Feuereifer an den Ermittlungen teilzunehmen.
Die Plots der TV-Serie zeichnen sich nicht durch besonderen Realismus aus, was der Unterhaltsamkeit wenig Abbruch tut. Collins bleibt auch hier in der Spur, ist jedoch Profi genug, die Gesetze der kriminalistischen Logik zu wahren. Das Ergebnis ist ein Roman, der als Krimi wesentlich überzeugender wirkt als die meisten Fernseh-Episoden. Dabei setzt uns Collins ziemlich starken Tobak vor, der die Grenze zum reinen Horror mehr als einmal schrammt. Vor allem die finale Abrechnung mit dem Mörder lässt an Schauerlichkeit nichts zu wünschen übrig.
Max Allan Collins präsentiert mit „seiner“ Temperance Brennan eine Figur, die nicht seinem Hirn entsprungen ist. Das ist für ihn, der schon mehrere TV-Serien für Romane adaptiert hat, nicht neu, doch dieses Mal klinkt er sich in eine Reihe ein, die bereits in Buchform Bestseller-Geschichte geschrieben hat. Temperance Brennan ist eine Schöpfung der Schriftstellerin Kathy Reichs und als solche seit 1997 auf den Buchmärkten der westlichen Welt omnipräsent. Während Collins seine „Bones“-Romane zur Fernsehserie schreibt, verfasst Reichs selbst weitere Brennan-Abenteuer.
Das ermöglicht den Vergleich zwischen beiden Versionen und ist spannend, da sowohl Reichs als auch Collins zu den Großen des Genres Kriminalroman gehören. Allerdings stellt sich rasch heraus, dass die Gegenüberstellung schwierig wird. Die Temperance Brennan der Reichs-Romane ist mit der „Bones“ aus dem Fernsehen nicht wirklich identisch. Literatur und Film/Fernsehen sind unterschiedliche Medien mit eigenen Regeln. „Bones“ ist daher eine deutlich simplifizierte Brennan-Version. Auch sie wird von diversen Selbstzweifeln und Problemen geplagt, doch diese bleiben der spannenden Handlung, die möglichst viele Zuschauer bannen soll, eindeutig untergeordnet.
An dieses Konzept hält sich Collins, und zumindest Ihr Rezensent hält das für eine gute Entscheidung, denn Kathy Reichs ist nicht die psychologisch begabte Verfasserin, für die sie sich hält. Sie stürzt „ihre“ Brennan in Irrungen & Wirrungen, die in dieser Intensität einfach langweilen, weil sie nie das Niveau einer Seifenoper übersteigen. Collins hält sich an das zuschauerkompatible Modell der „Bones“-Brennan und gibt ihm nur dort Tiefe, wo es die Handlung fördert.
Allerdings zwingt ihn das Korsett der Vorlage an anderer Stelle zu Kompromissen. Eine Grundkonstante der „Bones“-Serie ist die Konzentration auf das Paar Booth und Brennan. Ihr Verhältnis lässt sich mit dem alten Sprichwort „Was sich liebt, das neckt sich“ erschöpfend beschreiben. Tatsächlich werden in „Bones“ entsprechende Pseudo-Gags und dramatische Verwicklungen (vor allem im Vergleich mit den „CSI“-Serien) ebenso zahlreich wie plump eingesetzt, dass daraus einerseits Lächerlichkeit und andererseits Verdruss entsteht. Collins arbeitet die Wesenszüge der beiden Hauptpersonen wesentlich behutsamer heraus und kann auf diese Weise einigen Schaden ausbügeln, den diese in ihren Fernseh-Inkarnationen nahmen.
In einem Punkt konnte sich Collings den Fallstricken der Vorlage entziehen: „Tief begraben“ spielt in Chicago und damit weit entfernt von Brennans Forschungszentrale in Washington. Nur am Rande tauchen deshalb die nervenden weil klischeehaft überzeichneten Sidekicks der Serie – die kupplerische Gesichtsrekonstrukteurin Angela Montenegro, der verschwörungssüchtige Jack Hodgins, der Genietrottel Zack Addy und der pompöse Museumsleiter Goodman – auf. Dem Roman kommt das auf jeden Fall zugute. „Tief begraben“ setzt als Thriller zwar trotzdem keine Maßstäbe. Dennoch ist dieses Buch nicht nur für den „Bones“-Fan, sondern auch für den „normalen“ Krimifreund gut lesbar, weil spannend, planvoll konstruiert und mit routinierter Meisterschaft geschrieben.
Max Allan Collins wurde 1948 in Muscatine, US-Staat Iowa, geboren. Er entwickelte wie viele Kinder ein ausgeprägtes Interesse an Comics, entdeckte aber auch generell seine Liebe zur Populärkultur: zum Thriller, zur Musik, zum Fernsehen und für den Film. In den ersten beiden Jahren als Student arbeitete Collins als Reporter. Ab 1971 unterrichtete er Englisch an einem College. 1977 gab er dies auf und etablierte sich als freier Schriftsteller. Sechs Jahre zuvor hatte er seinen ersten Roman verkaufen können: „Bait Money“ (dt. „Köder für Nolan“) wurde zugleich das Debüt seines ersten Serienhelden Nolan, der als professioneller Dieb ständig mit der Polizei wie mit der Unterwelt in Konflikt gerät.
1975 schuf Collins seine bisher bekannteste und erfolgreichste Figur. Ursprünglich war der Privatdetektiv Nathan Heller als Held einer Comic-Serie geplant, die jedoch ihre Premiere nicht mehr erlebte. Die aufwändigen Recherchen versetzten den Schriftsteller in die Lage, Heller 1983 mit „True Detective“ (dt. „Chicago 1933“) einen ebenso voluminösen wie eindrucksvollen ersten Auftritt zu verschaffen. Wie selten zuvor im Genre gelang Collins die Einbettung des klassischen „Schnüfflers“ in das historische Umfeld der frühen 1930er Jahre.
Im Comic-Bereich feierte Collins erste Erfolge als Texter für den Klassiker „Dick Tracy“, der seit 1931 läuft. Collins führte die Serie an ihre Ursprünge zurück und zu neuem Ansehen. Er textete auch für „Batman“ und schuf mit dem Zeichner Terry Beatty die erfolgreiche Comic-Serie „Ms. Tree“ um eine weibliche Privatdetektivin.
1990 entdeckte Collins ein neues Betätigungsfeld: Als „Dick Tracy“-Spezialist wurde er engagiert, das Buch zum Film von und mit Warren Beatty zu verfassen. Auch zwei Fortsetzungen flossen aus seiner Feder. Der Damm war gebrochen, seitdem schreibt Collins (unterstützt von Co-Autoren; im vorliegenden Buch ist es Matthew V. Clemens) immer wieder „tie-ins“, die gegenüber den allzu oft minderwertigen, weil als „Nebenprodukt“ zum Film produzierten Romanen weniger talentierter bzw. inspirierter Kollegen durch ihre sorgfältige Machart und ihre Lesbarkeit auffallen.
Die Schaffenskraft des fleißigen Schriftstellers ist mit den beschriebenen Aktivitäten längst nicht erschöpft. Max Allan Collins schreibt und spielt seit den 1970er Jahren Rockmusik und gehörte verschiedenen Bands an, die durchaus kleinere Erfolge verzeichnen konnten. Im Film ist er inzwischen als Drehbuchautor („A Matter of Principa“, 2003), Produzent und Regisseur (u. a. die Independant-B-Thriller „Mommy“, 1995, und die Fortsetzung „Mommy’s Day“, 1997) aktiv, wenn auch auf diesem Gebiet (noch) nicht gerade berühmt.
http://www.blanvalet.de
Ellery Queen – Die siamesischen Zwillinge

Ellery Queen – Die siamesischen Zwillinge weiterlesen
Keillor, Garrison – Lake Wobegon
Irgendwo im US-Staat Michigan liegt der Städtchen Lake Wobegon. Man wird es auf Karten nicht finden, denn aufgrund der Unfähigkeit einiger Landvermesser wurde es dort niemals eingezeichnet. Eigentlich gibt es Lake Wobegon also nicht, was den meisten Einwohnern sogar recht ist, denn hier lebt ein eigenwilliger Menschenschlag. Die Nachfahren norwegischer und deutscher Einwanderer haben sich an dieser Stelle im 19. Jahrhundert niedergelassen. Zwar fühlen sie sich als Amerikaner, aber die Namen und gewisse Gewohnheiten ihrer europäischen Ahnen haben überlebt. Tatsächlich scheint in Lake Wobegon sogar die Zeit stehen geblieben zu sein, Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen, die Überlieferung lebt, während die Zukunft bestenfalls als bedrohlich gilt.
Die Tugenden der Alten werden in Lake Wobegon in Ehren gehalten. Harte Arbeit, ein christlicher Glaube, Sparsamkeit und der gesundes Misstrauen jeglichem Vergnügen gegenüber bestimmen das Denken und Handeln. So ist es immer gewesen, so hat es zu bleiben – und basta! Außenstehenden gelten sie als kauzige Hinterwäldler, was absolut zutreffend ist. Die Bürger von Lake Wobegon sind eine verschworene Gemeinschaft. Dafür zahlen sie freilich einen hohen Preis: Geheimnisse gibt es nicht in dieser Stadt. Trotzdem ist der Schein für die Bürger wichtiger als das Sein – geradezu lebenswichtig. Sie selbst würden das allerdings entrüstet zurückweisen, denn Eitelkeit gilt als schwere Sünde, und Pastor Ingqvist (für die Lutheraner) und Pater Emil (für die Katholiken) sind stets zur Stelle, die aus der Reihe getanzten Schäflein zur Herde zurückzutreiben.
Der Alltag von Lake Wobegon macht das Leben schwer für Außenseiter, zu denen sich unser Autor zählt. Fantasie und Freidenkertum sind ungern gesehen in einer Welt, die von zahlreichen geschriebenen und unzähligen ungeschriebenen Regeln bestimmt wird, deren Sinn niemals hinterfragt werden darf. Doch egal ob andressiertes oder echtes Heimatgefühl: Lake Wobegon ist nicht nur ein Ort, sondern auch eine Geisteshaltung, die man niemals wieder aus dem Kopf bekommt, selbst wenn man bis ans Ende dieser Welt flieht!
Die Geschichten aus bzw. um Lake Wobegon sind keine (auto-)biografischen Reminiszenzen des Garrison Keillor – jedenfalls keine unmittelbaren, da es diese Kleinstadt (leider?) gar nicht gibt. Der Autor hat sie und ihre im buchstäblichen Sinn unglaublichen Bewohner erfunden. Ursprünglich erzählte er sie im Radio, denn Keillor ist ein unerschütterlicher Jünger und Wahrer einer im Schwinden begriffenen Kunst, die sich um das gesprochene Wort ohne Bilder rankt.
Wieso er so viele Hörer damit fesseln konnte, wird uns schon nach der Lektüre weniger Absätze klar: Auch wenn der Menschheit nachgesagt wird, sie verblöde allmählich im Zeitalter des Privatfernsehens (und überhaupt), so erkennen viele Männer und Frauen eben doch richtigen Humor, wenn er ihnen unter die Augen (bzw. vor die Ohren) kommt.
Lake-Wobegon-Geschichten basieren nicht auf billigen, schnellen Comedian-Kalauern. Der Witz ist echt und hart erarbeitet. Immer wieder fragt man sich bewundernd, wie lange Garrison an diesen (übrigens fabelhaft übersetzten) Perlen echten Witzes wohl gefeilt haben mag. Auf mehr als 400 eng bedruckten Seiten findet sich praktisch kein Absatz, der vor geistreichen Gags, scharfsinnigen Beobachtungen oder wunderbaren Wortspielen nicht überquillt.
Für sein fiktives Fleckchen fadenscheiniger Idylle entwirft Keillor nicht nur eine bis ins Detail stimmige Topografie. Es gibt auch eine Lake-Wobegon-Chronik, die mehr als anderthalb Jahrhundert zurückreicht und mit zwerchfellerschütternder Logik belegt, wieso die Einheimischen geworden sind, was sie nun so überzeugend darstellen: Hinterwäldler-Adel mit Leib & Seele. Sie werden vom Verfasser niemals bloßgestellt; man lacht mit den Menschen aus Lake Wobegan, nicht über sie.
Humor und Tragik sind enge Verwandte. Charles Chaplin hat das begriffen; seine Filme, die beides gekonnt mischen, sind deshalb ewige Klassiker. Auch Keillor strebt nicht „nur“ nach dem Gelächter seiner Leser. Lake Wobegon geht uns auch deshalb so ans Herz (und an die Nieren), weil der Verfasser unter den Schrullen und Eigenheiten seiner Bürger jederzeit den hässlichen Alltag in der Provinz durchschimmern lässt. Oder anders ausgedrückt: Über Lake Wobegon zu lesen, bereitet ein Heidenvergnügen, aber dort leben würde man wohl lieber nicht. Das scheinbar glückliche, weil einfache Landleben ist bei näherer Betrachtung auch eine Schlangengrube, eine Falle, eine Sackgasse. Wo jede/r jede/n kennt, gibt es kaum Geheimnisse. Doch wir alle benötigen unsere Privatsphäre, unsere Freiräume. Die existieren nicht in Lake Wobegon – nicht einmal hinter der eigenen Tür, denn dort regieren die unzähligen Vorschriften und Regeln, die sich die Bürger selbst auferlegen, ohne deren Sinn zu hinterfragen.
Wobei „Hinterfragen“ ohnehin als verdächtige Mode der Gegenwart und damit als potenzielle List des Teufels gilt. Die Kirche ist Keillor offenkundig ein besonderer Dorn im Auge, wobei er keine Konfession ausspart. In seinen zum Lachen und Weinen gleichzeitig reizenden Kapiteln über die Eskapaden der Lutheraner und Katholiken von Lake Wobegan läuft er zur Höchstform auf. Selten wurde der Unterschied zwischen dem Glauben und dem, was der Mensch daraus gemacht hat – die Kirche/n nämlich – auf so unterhaltsame wie unbarmherzige Weise bloßgestellt. In Lake Wobegon wollen die Kirchgänger Feuer und Schwefel schmecken, sonst sind sie mit der Predigt unzufrieden. Andere heilige Kühe, die gleich reihenweise geschlachtet werden, sind die Erziehung und Schule, Sexualität und Ehe, Arbeit und Freizeit … Es gibt praktisch keinen Aspekt des menschlichen Kleinstadtalltags, den Keillor nicht berücksichtigen würde.
Da hat sich anscheinend eine Menge aufgestaut in unserem Verfasser, der in einer kleinen Stadt namens Anoka, gelegen ebenfalls in Minnesota, geboren wurde und aufgewachsen ist. Lake Wobegon ist in vielem ein Spiegel, in dem auch Keillor selbst in verschiedenen Lebensaltern immer wieder sichtbar wird. Er muss ein Außenseiter gewesen sein, der sich dem Kodex der Provinz nicht unterwerfen wollte und dafür seinen Preis zahlen musste.
Dies wird wiederum in schreiend komischen Episoden verpackt. Was es ihn wirklich gekostet haben könnte, lässt ein weiteres Alter Ego in seinen „95 Thesen“ erkennen, die sich an Martin Luther orientieren. Hier wird die Kritik an der hinterwäldlerischen Verbohrtheit und ihren Folgen zwar wiederum in elegante Worte gekleidet, sie kommt aber auch in Gestalt echter Vorwürfe daher – und die haben es in sich! Da mag sich so mancher Leser sogar hierzulande erkennen, denn Lake Wobegon – da trifft der Klappentext ins Schwarze – ist überall.
Garrison Keillor wurde 1942 wie gesagt im Städtchen Anoka geboren. Es dauerte lange, bis er seinem geliebten und verhassten Heimatstaat entkam. Zunächst schaffte er es jedenfalls nur bis zur Universität von Minnesota, wo er auch seinen Abschluss im Fach Journalismus machte. Hier war es auch, wo er seine lebenslange Liebe zum Radio entdeckte und erste Features über den Äther schickte. 1969 wurde Keillor Journalist und arbeitete für den „New Yorker“. Fünf Jahre später schrieb er einen Artikel über die dortige Oper. Dies inspirierte ihn, zum Radio zu wechseln, wo er eine Liveshow ins Leben rief: „A Prairie Home Companion“ wurde vor Publikum aus einem Theatersaal ausgestrahlt. 13 Jahre lief die Show, dann wechselte Keillor nach New York und startete „The American Radio Company“. Nach vier höchst erfolgreichen Jahren nannte er das Programm wieder „A Prairie Home Companion“. Es läuft noch heute.
Als Schriftsteller hat Keillor bisher acht Bücher mit geistreichen und amüsanten Geschichten gefüllt, die längst nicht nur um Lake Wobegon, sondern um die generellen Höhen und Tiefen des Lebens kreisen. Dazu kommen drei Kinderbücher, Gedichte und Hörbücher. Garrison Keillor lebt in New York. Er ist verheiratet mit der Violinistin Jenny Lind Nilsson, mit der er eine Tochter hat.
Garrison Keillor findet man im Internet u. a. unter http://www.mindspring.com/~celestia/keillor.
Originaltitel: Lake Wobegon Days (New York : Viking, Penguin 1985)
Übersetzung: Christa Eigner u. Alexandra Auer
http://www.goldmann-verlag.de
Jane Adams – Im Bann des Bösen
Der wenig erfolgreiche Journalist Simon Emmet und die berühmte Fotografin Tally Palmer bildeten nach allgemeiner Ansicht ein ungleiches Paar. Niemand ist daher erstaunt, als Simon von Tally rüde den Laufpass erhält. Sie liebe ihn zwar, doch es gäbe einen „Jack“, der ältere Rechte geltend machen könne, so Tallys Schlusswort. Simon kann und will den Bruch nicht wahrhaben. Krank vor Eifersucht stellt er der Geliebten nach, überwacht sie heimlich, versucht dem geheimnisvollen Jack auf die Spur zu kommen. Eine letzte Aussprache endet im Streit. Als Simon betrübt den Heimweg antritt, wird er überfallen und niedergestochen.
Hat ihm Jack eine Lektion erteilen wollen? Dies fragen sich Simons Freunde, zu denen auch Detective Inspector Alec Friedman und seine Lebensgefährtin Naomi Blake gehören. Naomi war selbst Polizistin, bis ihr ein Unfall das Augenlicht raubte. Sie hat die unglückliche Liebe zwischen Simon und Tally schon lange verfolgt und kann der Versuchung nicht widerstehen, sich in den Fall einzumischen. Jane Adams – Im Bann des Bösen weiterlesen
Ian Rankin – Der diskrete Mr. Flint

Ian Rankin – Der diskrete Mr. Flint weiterlesen
Connolly, John – Nocturnes
In zwei Novellen und 13 Kurzgeschichten erkundet Connolly, sonst als Meister des psychologischen Thrillers bekannt, die Abgründe nicht nur menschlicher Seelen:
– „Der Krebscowboy reitet“ (The Cancer Cowboy Rides), S. 5-83: Die moderne Pest hat Köpfchen und lässt ihren unglücklichen Wirt dafür sorgen, dass stets frische Opfer ihren tödlichen Weg kreuzen …
– „Mr. Pettingers Dämon“ (Mr. Pettinger’s Daemon), S. 84-99: Gräbst du unter einer alten Kirche nach einem Geheimnis, kann es sein, dass es sich dir entgegenwühlt …
– „Der Erlkönig“ (The Erlking), S. 100-110: Er haust im Wald, hat Kinder zum Fressen gern und lässt sich gar nicht gern um sein Opfer betrügen …
– „Die neue Tochter“ (The New Daughter), S. 111-125: Elfen mögen klein sein, sind aber gar nicht niedlich & gehen des Nachts gern auf Kinderfang …
– „Das Ritual der Knochen“ (The Ritual of the Bones), S. 126-140): Der englische Arbeiter ist nicht nur das Salz, sondern auch das Blut der Erde, das die Oberschicht zur Wahrung ihrer Privilegien lieber vergießt als den eigenen Lebenssaft …
– „Der Heizungskeller“ (The Furnace Room), S. 141-154: Der Eingang zur Hölle ist für manchen Sünder näher, als er sich vorstellen mag – bis es zu spät ist …
– „Die Hexen von Underbury“ (The Underbury Witches), S. 155-198: Eine echte Hexe ist durch ihren Tod nicht aufzuhalten …
– „Der Affe auf dem Tintenfass“ (The Inkpot Monkey), S. 199-210: Ein bisschen Blut im Austausch gegen Tinte, die Bestseller entstehen lässt? Der erfolglose Schriftsteller denkt nicht lange nach, doch sein dämonischer Helfer hat eigene Pläne …
– „Treibsand“ (The Shifting of the Sands), S. 211-225: In diesem Küstenstädtchen halten sich die Bürger lieber an ihre seit Urzeiten bekannten Götter, auch wenn hier und da ein Menschenopfer fällig wird …
– „Manche Kinder laufen aus Versehen weg“ (Some Children Wander by Mistake), S. 226-237: Der Zirkus kommt in die Stadt, und als er sie verlässt, hat er eine neue Attraktion …
– „Dunkles Grün“ (Deep Dark Green), S. 238-247: Manches Übel ist nicht dadurch zu stoppen, dass man es zu ertränken versucht …
– „Miss Froom, Vampirin“ (Miss Froom, Vampire), S. 248-260: Vampire sind gar keine garstigen Untoten, erfährt ein verliebter Jüngling; nur neigen sie leider zur Lüge …
– „Nocturne“ (Nocturne), S. 261-273: Wie kämpft man gegen einen Mörder, wenn dieser längst tot ist, aber nicht in Frieden ruhen mag?
– „Die Wakefordschlucht“ (The Wakeford Abyss), S. 274-288: Meidet diesen Ort, warnt der alte Bauersmann, was zwei wackere Wanderer natürlich nicht abhält, genau dorthin zu gehen – mit den üblichen Folgen …
– „Das spiegelnde Auge“ (The Reflecting Eye: A Charlie Parker Novella), S. 289-410: Ein ertappter Kindermörder meint den idealen Zufluchtsort gefunden zu haben, doch der Teufel ist einfallsreich, wenn es gilt, ihm zustehende Sünderseelen einzutreiben …
John Connolly gehört zu den großen Stars des aktuellen Buchthrillers. Seine Romane um den vom Schicksal hart geprüften Privatdetektiv Charlie „Bird“ Parker gehören zu den modernen Klassikern ihres Genres. Selten gelingt es einem Schriftsteller – zumal auf dem gern verachteten Sektor der Unterhaltung – so gut, die dunklen Seiten der Psyche in Worte zu fassen.
Dabei sieht Connolly das Böse als reale Kraft, die nicht zwangsläufig dem menschlichen Hirn entspringt, sondern in einer Sphäre außerhalb der Welt, wie wir sie kennen, beheimatet ist. Immer wieder entstehen „Portale“, durch die es in Gestalt von Dämonen und anderen Kreaturen der Finsternis ins Diesseits vordringt, wobei diese Durchgänge oft in den Köpfen derjenigen Zeitgenossen entstehen, die wir als Sadisten oder Serienmörder bezeichnen. Hier scheint der Durchbruch einfacher zu sein, da es zwischen diesen Unmenschen und den Kräften von „draußen“ eine eigene Affinität zu geben scheint: |“Es gibt Mythen, und es gibt die Realität. Wir erschaffen Ungeheuer und hoffen, dass die Moral, die in den Geschichten verpackt ist, uns leiten wird, wenn wir dem größten Schrecken im Leben begegnen. Wir geben unseren Ängsten falsche Namen und beten, dass wir möglichst nichts Schlimmes erleben werden als das, was wir selbst erschaffen haben.“| (S. 101) Was geschieht, wenn diese Rechnung nicht aufgeht, beschreibt der Autor in den hier vorgelegten Storys.
Diese eigenwillige Definition des Bösen belegt, dass Connolly den Thriller mindestens so liebt wie die Phantastik. In der Tat schreibt er schon seit vielen Jahren Kurzgeschichten um Gespenster und Gruselwesen, die er u. a. auf seine Website gestellt hat. Mit dem Erfolg der Charlie-Parker-Serie wuchs das Interesse an diesen Storys, aus denen sich womöglich ebenfalls Profit schlagen ließ. In seinem Nachwort erläutert Connolly, wie die ehrwürdige BBC ihn beauftragte, für eine Reihe von Grusel-Hörspielen Vorlagen zu schreiben – ein Vorhaben, das von großem Erfolg gekrönt und wiederholt wurde. Neun der hier versammelten Geschichten gehen auf diese Projekte zurück. (Eine Forderung scheint übrigens gewesen zu sein, dass diese Storys in den Jahren nach dem „Großen“, d. h. dem I. Weltkrieg von 1914-18, spielen, als die klassische angelsächsische Geistergeschichte ihre letzten Höhepunkte erreichte.)
„Erinnert an Stephen King – aber Connolly schreibt besser“, liest man auf der Rückseite des Buchumschlags. Es ist eine dieser wie gekauft wirkenden, völlig nutzlosen „Kritiken“, der man in einem Punkt indes zustimmen kann: Storys wie „Der Krebscowboy reitet“ oder „Der Erlkönig“ lesen sich in der Tat wie vom Horrorkönig aus Maine verfasst. Das bedeutet freilich nicht, dass Connolly diesen imitiert, sondern bezieht sich auf die Meisterschaft, mit der es ihm gelingt, das Grauen in einer ansonsten fast aufdringlich durchschnittlichen Alltagswelt zu erden. Connollys Kreaturen drängt es nicht zur Weltherrschaft. Sie tun, was sie tun müssen, und haben die Regeln der Welt, in die es sie verschlagen hat, gut begriffen: Verhalte dich unauffällig, meide das Licht der Öffentlichkeit, vergreife dich an denen, die niemand vermisst.
In unserer unmittelbaren Nachbarschaft gibt es diffuse aber sehr aktive Wesen, die unsere Ahnen noch sehr gut kannten und fürchteten, während wir „modernen“ Menschen nicht mehr an sie glauben. Eine Ausnahme gibt es: Kinder besitzen in ihrer „irrationalen“ Unschuld einen besonderen Sinn für diese Eindringlinge. Deshalb schweben vor allem sie in Gefahr. Nicht, weil sie „wissen“: Diesen Kreaturen ist es gleichgültig, ob man an sie „glaubt“. Sie „sind“ – und sie nutzen die Chancen, die ihnen die ihre Anonymität bietet („Treibsand“, „Dunkles Grün“, „Die Wakefordschlucht“). So breitet sich das Böse nicht unbedingt aus; es fristet sein Dasein und richtet örtlich begrenzt seinen Schaden an, bis es entdeckt, aber nicht unbedingt unschädlich gemacht wird.
Dabei nimmt es viele Gestalten an. Viele sind klassisch: Gespenster („Nocturne“), Hexen („Die Hexen von Underbury“), Vampire („Miss Froom, Vampirin“), Dämonen („Mr. Pettingers Dämon“), das „kleine Volk“, das so gar nichts gemeinsam hat mit den liebenswerten Elfen, wie wir sie heute „kennen“ („Die neue Tochter“). „Der Erlkönig“ ist die weitere Variante einer Natur, deren Palette des Lebens weitaus breiter ist, als wir Menschen wissen oder wissen möchten. Wie es eine gute Gruselgeschichte auszeichnet, kommt der Schrecken manchmal umso besser an, wenn er mit grimmigem Humor dargeboten wird („Miss Froom, Vampirin“, „Der Affe auf dem Tintenfass“).
Die Fans der erwähnte Charlie-Parker-Serie wird aufhorchen lassen, dass Connelly seinen „Nachtstücken“ – so die Übersetzung von „Nocturnes“ – eine bisher unbekannte, 120-seitige Novelle um seinen beliebten Anti-Helden beifügt. Sie verschärft die Neuorientierung der Reihe, die viele Leser, die Connolly als Meister des Psychothrillers schätzen, vor ein Problem stellt: Charlie Parker bekommt es als Detektiv nicht mehr nur mit „normalen“ Kriminellen, sondern mit den Ausgeburten des Jenseits zu tun. Diese Wendung ist nicht ohne Risiko, da Connolly damit zwischen den Stühlen steht: Rationale Krimi-Freunde und Geisterfans stehen meist in unterschiedlichen Leser-Lagern. Allerdings hält Connolly die Balance auf dieses Messers Schneide mit erstaunlicher Souveränität. „Das spiegelnde Auge“ spielt kurz nach den Ereignisse des vierten Romans (dt. „Die weiße Straße“) und ist daher ein wichtiger Mosaikstein, der dem düsteren Universum des Charlie Parker eine weitere Fassette hinzufügt. „Das spiegelnde Auge“ ist außerdem die mit Abstand beste Geschichte dieser Sammlung. Sie spielt in der Gegenwart, der Connolly meisterhaft die Regeln der phantastischen Literatur anzupassen weiß, und komplettiert den rundum positiven Eindruck dieser „Nocturnes“, die zu den angenehmen Überraschungen gehören, die das noch junge Buchjahr 2007 den deutschen Gruselfreunden bieten konnte.
John Connolly ist ein waschechter Ire, der nicht nur in Dublin geboren wurde (1968), sondern dort auch aufwuchs, studierte und (nach einer langen Kette von Aushilfsjobs, zu denen standesgemäß einer als Barmann gehörte) als Journalist (für „The Irish Times“) arbeitete; Letzteres macht er weiterhin, obwohl sich der Erfolg als freier Schriftsteller inzwischen eingestellt hat. Die amerikanischen Schauplätze seiner von der Kritik gelobten und von den Lesern geliebten Charlie-Parker-Thriller kennt Connolly indes durchaus aus eigener Erfahrung; schon seit Jahren verbringt er jeweils etwa die Hälfte eines Jahres in Irland und den Vereinigten Staaten.
Verwiesen sei auf die in Form und Inhalt wirklich gute [Connolly-Website,]http://www.johnconnollybooks.com die nicht nur über Leben und Werk informiert, sondern quasi als Bonus mehrere Gruselgeschichten und Artikel präsentiert.
http://www.ullstein.de/
_John Connolly bei |Buchwurm.info|:_
[„Das dunkle Vermächtnis“ 2251
[„In tiefer Finsternis“ 1803
[„Die weiße Straße“ 3098
[„Die Insel“ 1646
Catherine Donzel – Legendäre Ozeanreisen
„Das Meer vergessen“ (S. 10-17): Die Einleitung versucht ein Paradoxon zu erklären, denn die Kunst des Reisens auf dem Wasser besteht darin, die Passagiere das feuchte Element, das sie trägt, möglichst vergessen zu lassen. Die großen Schiffe der Vergangenheit und Gegenwart waren so eingerichtet, dass mögliche Ängste im Luxus förmlich erstickt werden. Aus der möglichen Zumutung, Tage oder Wochen auf einem relativ kleinen, einsam dahin schippernden Gefährt zuzubringen, wurde auf diese Weise ein Erlebnis. Die Fahrt selbst war so wichtig wie das Ziel, bis schließlich die Kreuzfahrt erfunden wurde, die auf ein Ziel sogar völlig verzichten konnte.
„Sich einschiffen“ (S. 18-61): Die Reise mit einem Schiff war zumindest in der angeblich guten alten Zeit nicht identisch mit einer modernen Pauschalreise. Auf große Fahrt gingen primär jene, die sich dieses kostspielige Vergnügen leisten konnten. Während über Geld nicht gesprochen wurde – man hatte es –, musste der gesellschaftliche Status präsentiert werden. Um sich zur Schau stellen zu können, reiste man mit großem Gepäck; eigentlich nahm man einen guten Teil seines Hausstandes mit in ferne Länder. Das Einschiffen wurde unter dieser Voraussetzung zu einer logistischen Herausforderung. Unmengen von Kleidern, Anzügen oder Golfschlägern galt es an Bord zu nehmen und zu verstauen, während die anspruchsvollen Passagiere demutsvoll begrüßt und in ihre Suiten geführt wurden. Möglichst unbemerkt wurden gewaltige Mengen Nahrungsmittel, Wasser, Treibstoff und andere unverzichtbare Ladungen in den Bauch des Schiffes geschafft. Das Tohuwabohu, von dem die Passagiere der ersten Klasse nichts merken sollten, hielt noch an, während das Schiff bereits auf den Ozean hinaus steuerte. Catherine Donzel – Legendäre Ozeanreisen weiterlesen