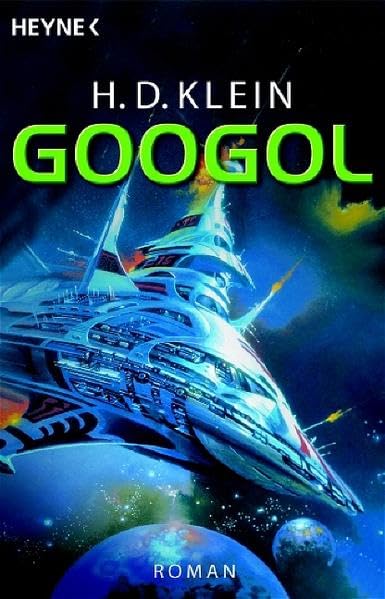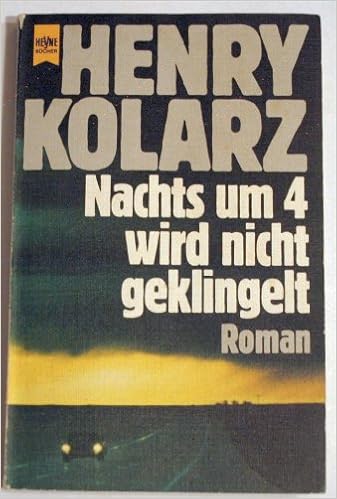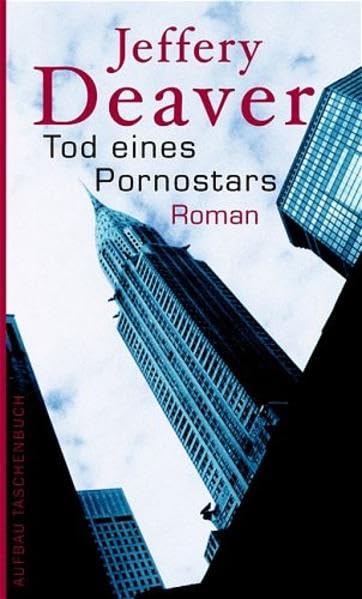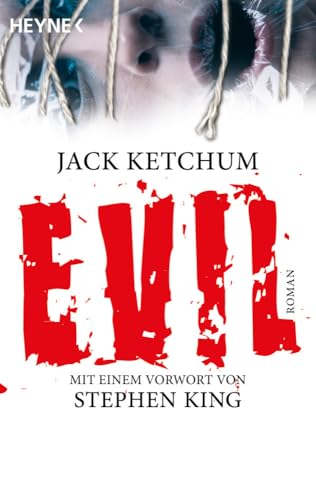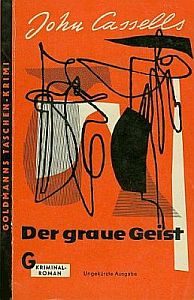
John Cassells – Der graue Geist weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Jeffery Deaver – Das Teufelsspiel (Lincoln Rhyme/Amelia Sachs 6)
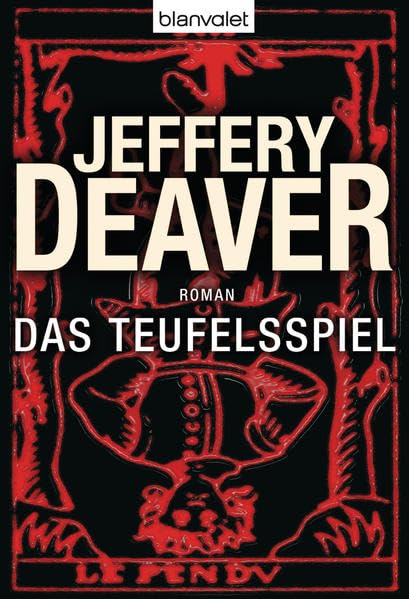
Jeffery Deaver – Das Teufelsspiel (Lincoln Rhyme/Amelia Sachs 6) weiterlesen
Craig Russell – Blutadler [Jan Fabel 1]

Craig Russell – Blutadler [Jan Fabel 1] weiterlesen
Max Allan Collins – CSI Las Vegas: Tödlicher Irrtum
Zwei Fällen beschäftigen das bewährte „Crime-Scene-Investigation“-Team (CSI) dieses Mal. Gil Grissom, der Chef, und seine Kollegen Sara Sidle und Nick Stokes bearbeiten gemeinsam mit Captain Jim Brass vom Las Vegas Police Department das seltsame Verschwinden der Rita Bennett. Die reiche Autohändlerin ist vor einem Vierteljahr gestorben und wurde nach Ansicht der Tochter von ihrem Lottergatten umgebracht. Eine Exhumierung sollte Klärung bringen. Stattdessen findet sich in Ritas Sarg eine fremde Leiche: Kathy Dean, gerade 19 Jahre alt, wurde ganz sicher ermordet, denn in ihrem Hinterkopf findet der aufmerksame CSI-Pathologe Robbins ein Einschussloch.
Wie wurden die Leichen vertauscht? Die Vorschriften für das Bestattungswesen sind in Las Vegas streng. Entweder ist die Tat auf dem Friedhof oder im Bestattungsinstitut begangen worden. Dort streitet man eine Schuld natürlich energisch ab. Doch die CSI-Mannschaft erkennt eine Verbindung zwischen der verstorbenen Kathy Dean und dem aalglatten Dustin Black, dem Leiter der „Desert Haven Mortuary“. Mann und Mädchen kannten sich, was Black den Ermittlern verschwieg. Nachdem eine Untersuchung der Leiche ergab, dass Kathy zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger war, erregt dieses Verhalten Verdacht und bedingt intensive Nachforschungen. Max Allan Collins – CSI Las Vegas: Tödlicher Irrtum weiterlesen
John Connolly – Das dunkle Vermächtnis [Charlie Parker 2]

John Connolly – Das dunkle Vermächtnis [Charlie Parker 2] weiterlesen
Klein, H. D. – Googol
Im Jahr 2045 ist es so weit: Außerirdische fliegen die Erde an! Sie reisen an Bord eines riesigen Pyramidenraumschiffs an, hüllen sich aber in tiefes Schweigen. Die Erdmenschen ergreifen die Initiative, doch als sich ein „Begrüßungskomitee“ aufmacht, die Pyramide anzufliegen, setzt es sich nicht aus kernig-stoppelhaarigen NASA-Astronauten zusammen. An Bord der “Nostradamus” befindet sich eine Multikulti-Crew, die ihre Anweisungen – man lese und staune! – vom deutschen (!) Raumfahrtkonzern „Space Cargo“ erhält. (Das ist wahre Science-Fiction!) Kapitän John Nurminen und seine Mannschaft haben den Auftrag, die außerirdischen Gäste zu begrüßen und, sollte niemand zu Hause sein, die Geheimnisse ihres Pyramidenschiffes zu erkunden – zum Wohle des Mutterkonzerns und der Menschheit: in genau dieser Reihenfolge.
Die Mission ist schwierig und stellt ihre Mitglieder vor nie gekannte Probleme. An Bord der „Nostradamus“ herrscht wenig von dem weihevollen Eifer, der Forschern und Entdeckern in den Geschichtsbüchern nachträglich gern zugeschrieben wird. Die Mannschaft ist bunt zusammengewürfelt und arbeitet (noch) nicht harmonisch zusammen. Kapitän Nurminen hat kein Mitspracherecht bei der Zusammenstellung der Crew; „Space Cargo“ stellt ihn vor vollendete Tatsachen. Mehr als die Tatsache, die historische Mission mit einer Mannschaft anzutreten, die in ihrer Mehrheit die Erde niemals verlassen hat, beunruhigt Nurminen die Tatsache, dass man ihn zwingt, dies an Bord eines Schiffes zu tun, das wenig mehr als ein Prototyp ist. Der Antrieb der „Nostradamus“ ist revolutionär – jedenfalls in der Theorie, denn praktisch wurde er noch nicht unter Dauerbelastung getestet. Das ficht seinen geistigen Vater, den knarzig-genialen Professor Schmidtbauer, allerdings nicht an. Schließlich ist er höchstpersönlich mit von der Partie und wird dem Kapitän schon zeigen, welche Knöpfe er zu drücken hat. Da schreckt es den gebeutelten Nurminen nicht mehr, als er entdeckt, dass seine neue Bordärztin eine ehemalige Geliebte ist, von der er sich im Streit getrennt hat, und sich zum Dienst auch eine Parapsychologin mit dem schönen Namen Halbmond sowie ein Nexialist melden, der von allem ein bisschen, aber nichts richtig versteht und dadurch nach Ansicht des Konzern prädestiniert ist für die Kontaktaufnahme mit einer außerirdischen Intelligenz.
Allerdings ist es fraglich, ob die „Nostradamus“ ihr Ziel jemals erreichen wird. Die Konkurrenz-Konzerne von „Space Cargo“ gedenken nicht, sich ausbooten zu lassen. Sie schicken eigene Schiffe aus. Der Vatikan ist davon überzeugt, dass am Steuer der Pyramide der Antichrist höchstpersönlich sitzt, der komfortabel anreist, um endlich sein Reich des Bösen auf der Erde zu errichten. Die Außerirdischen sind gar nicht so fremd im Sonnensystem, denn auf dem Mars wurden schon vor einigen Jahren Pyramidenbauten gesichtet, die stark an die Form des nun georteten Raumschiffs erinnern; die Entdeckung wurde aus politischen Gründen geheim gehalten. „Space Cargo“ selbst scheint ein falsches Spiel mit der Mannschaft der „Nostradamus“ zu treiben und sehr viel interessierter an der Erprobung des neuartigen Antriebs als an der Erforschung der Pyramide zu sein, und, und, und … Die Ränke und Intrigenspiele auf der Erde und im Weltall scheinen kein Ende zu finden, und mittendrin steckt immer die „Nostradamus“ – ein hilfloser Spielball divergierender, undurchsichtiger Interessen und einer Technik, die sich verhängnisvoll zu verselbständigen beginnt …
„Googol“ – eine Space Opera aus deutschen Landen, die eigene Wege geht; ein Unikum auf einem schon lange weitgehend nivellierten SF-Buchmarkt, der durch angelsächsische Autoren und Endlosserien à la „Star Trek“ oder „Battletech“ geprägt wird: eine Überraschung, mit der wohl niemand gerechnet hat, und deren Wiederkehr sechs Jahre nach der Erstausgabe mit einer „überarbeiteten“ Neuauflage versucht wird.
H. D. Klein erfindet mit seinem ziegelsteinschweren Opus das Rad nicht neu, aber das verlangt ja auch niemand. Selbst wenn sich das Erstaunen, dass es ein Buch wie „Googol“ tatsächlich geben kann, ein wenig gelegt hat, bleibt die Freude an einer spannenden, trotz ihrer Umfangs ohne gravierende Längen erzählten Geschichte. Offensichtlich gibt es doch kein Gen, das nur Amerikaner oder Briten befähigt, einen lesenswerten SF-Roman zu Stande zu bringen (dessen Held nicht Perry Rhodan oder Rhen Dark heißt …). Klein hat sein Thema und seinen Stoff im Griff. Die von ihm zum Einsatz gebrachte Technik wirkt überzeugend. Besonders positiv macht sich indes sein Entschluss bemerkbar, das Hauptgewicht eben nicht auf die „harte“ Science-Fiction zu legen, wie dies im Umfeld der Erforschung außerirdischer Artefakte im SF-Roman allzu oft geschieht, sondern die Menschen in den Vordergrund zu stellen – „Menschen“ wohlgemerkt, nicht eindimensionale „Helden“ und „Schurken“. John Nurminen beispielsweise müht sich redlich, die übernommene Aufgabe erfolgreich durchzuführen. Für ihn ist es ein schmerzlicher Prozess, als er zum einen herausfindet, dass er eindeutig überfordert ist. Schlimmer wirkt sich die Entdeckung aus, vom „Space Cargo“-Konzern, dem er bisher vertraut und für den er sein Bestes gegeben hat, belogen und ausgenutzt worden zu sein; eine Erkenntnis, die um so bitterer wirkt, als Nurminen sich eingestehen muss, dass die entsprechenden Zeichen schon lange an der Wand gestanden haben: Er wollte sie einfach nicht sehen.
Unter diesen Umständen ist es zu verschmerzen, dass das Rätsel der Außerirdischen in „Googol“ niemals eine echte Auflösung erfährt. Sie dienen ihrem Autor als „McGuffin“, wie Alfred Hitchcock es genannt hat: als Katalysator, der die Handlung in Schwung bringt, um anschließend nebensächlich zu werden. Dazu kommt die uralte Einsicht, dass ein Rätsel, dessen Auflösung man allein dem Leser überlässt, einen um so stärkeren Eindruck hinterlässt. So sind die Außerirdischen letztlich tatsächlich gar nicht so wichtig.
Einige wenige Schwachpunkte gibt es gleichwohl doch. So ist das Bild einer im Würgegriff skrupelloser Wirtschaftskonzerne gefangenen Erde nicht nur ein wenig abgegriffen. Es wurde auch schon wesentlich schärfer und konsequenter und dadurch überzeugender gezeichnet. (Man denke nur an William Gibsons „Neuromancer“-Trilogie oder – um einen echten Klassiker zu nennen – Frederik Pohls und Cyril M. Kornbluthes „Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute“/“The Space Merchants“ von 1953.) Auch in seinem Bemühen, sich von der anglo-amerikanischen „Konkurrenz“ um jeden Preis abzugrenzen, ist Klein ein Stück zu weit gegangen: Seine Zeichnung der Mannschaft der „American Gothic“ und besonders ihres Captains ist womöglich satirisch gemeint, geht aber weit über die Grenzen der Karikatur hinaus.
Zu vermerken sind schließlich gewisse stilistische Schwächen oder besser Eigenarten, die wahrscheinlich nicht ausbleiben können bei einem Werk dieses Umfangs und einem Autor, an dem die Jahre der Perry Rhodan/Atlan/Terra Astra & Co-Monokultur nicht spurlos vorübergegangen sein können. Aber das sind nur Marginalien; es überwiegt die Freude an einem ambitionierten und gelungenen Roman – kein Meisterwerk, aber grundsolides Lesefutter, oft ein gutes Stück oberhalb des Durchschnitts.
Ach ja: Was ist eigentlich ein „Googol“? Den Mathematikern unter uns wird dieses Wort womöglich nicht unbekannt sein, denn es bezeichnet eine Zahl, die so unvorstellbar groß ist, dass es den Fachleute sogar schwer fiel, einen Namen für sie zu finden: eine Zehn, gefolgt von einhundert Nullen. Klingt noch nicht sehr eindrucksvoll, gewinnt aber an Gewicht, führt man sich vor Augen, dass die gesamte Anzahl aller Protonen des Universums auf eine Zehn mit achtzig Nullen geschätzt wird. (Edward Kasner, der das Googol in den 30er Jahres des 20. Jahrhunderts „erfand“, wandte sich für die „Taufe“ übrigens an seinen neunjährigen Neffen, der ahnungslos ein wahrhaft großes Wort gelassen aussprach und damit in die Wissenschaftsgeschichte einging.) Das Googol wird als erstes Zahlwort diesseits der Unendlichkeit, für das es keine Entsprechung mehr in „unserer“, der sichtbaren Welt gibt, definiert. Damit qualifiziert es sich nachdrücklich als Titel für einen Science-Fiction-Roman und mag gleichzeitig ein Wortspiel bilden, das die Erfahrungen seines Autors beschreibt, für einen mehr als tausendseitigen fantastischen Roman aus Deutschland in Deutschland einen Verlag zu finden.
Anmerkung: Für April 2006 ist die Fortsetzung „Googolplex“ bei |Heyne| angekündigt.
Dan Simmons – Lovedeath
Fünf Kurzgeschichten bzw. Novellen, die um die Themen Liebe oder/und Tod kreisen, sammelt dieser Band, der zwar als „Horror“-Taschenbuch erscheint, aber vergleichsweise wenige Elemente des Übernatürlichen bietet. Stattdessen geht es um die beiden grundlegenden Gefühle in ungewöhnlichen, meist krisenhaften Situationen. Facettenreich und meisterhaft lotet der Verfasser aus, wie erstaunlich und erschreckend dünn die Trennlinie zwischen Liebe (oder Leben) und Tod ist.
Inhalt
Das Bett der Entropie um Mitternacht („Entropy’s Bed at Midnight“, S. 29-70): Ein auf die Untersuchung bizarrer Unglücksfälle spezialisierter Versicherungsvertreter meint die Regel entdeckt zu haben, dass der Tod der Liebe zwingend und unter grausamen Begleiterscheinungen folgen wird …
Tod in Bangkok („Dying in Bangkok“, S. 71-128): Ein ehemaliger Vietnamkämpfer sucht in Thailand nach einem Mutter-Tochter-Vampirpaar, das einst seinen besten Freund auf höchst extravagante Weise zu Tode brachte …
Sex mit Zahnfrauen („Sleeping With Teeth Women“,129-222): Ein junger Indianer begibt sich auf eine lange, gefährliche Reise, an deren Ende er in jeder Beziehung zum Mann gereift oder tot sein wird …
Flashback („Flashback“, S. 223-284): Die Bevölkerung der USA dämmert im Bann einer Droge dahin, die es ermöglicht, vergangene Ereignisse noch einmal zu durchleben …
Der große Liebhaber („The Great Lover“, S. 285-431): Im I. Weltkrieg erlebt ein junger Schriftsteller das Grauen der französischen Schützengräben. Im täglichen Kampf um das Überleben hilft ihm eine wunderschöne Geisterfrau, die er bald für den leibhaftigen Tod halten muss …
Lang oder kurz bzw. irgendwo dazwischen
Die Novelle ist der ungeliebte Bastard zwischen Roman und Kurzgeschichte. Literaturwissenschaftler werden bei diesem Bild aufschreien, doch es trifft dennoch den Kern der Sache. In einem langen Vorwort (S. 13-27) erläutert Dan Simmons, dass diese mittellange Erzählform als höchst marktschädlich gilt. Romane verkaufen sich besser als Kurzgeschichten, Storysammlungen immer noch besser als Novellen. Diese sind gleichzeitig zu lang und zu kurz. Gleichzeitig gibt es freilich gute Gründe für ihre Existenz: Manche Idee ist für die mittellange Form geboren. Nur wenige Autoren gehen jedoch das Risiko ein dies zu berücksichtigen. Lieber walzen sie das, was ihnen eingefallen ist, zum (mehrbändigen) Roman aus.
Dan Simmons kann es inzwischen einen gewissen Konfrontationskurs leisten. Wie Stephen King, Peter Straub oder Clive Barker gehört er zu den ganz Großen der Phantastik, hat sich aber auch in anderen Genres etabliert. In „Lovedeath“ wirft er seinen Verlegern gleich zwei Fehdehandschuhe hin: Er liefert ihnen Novellen, die zu allem Überfluss nicht einmal ‚richtigen‘ Horror bieten.
Obwohl der Leser in seiner Mehrheit ein Gewohnheitstier ist, geht Simmons das Risiko ein, auch sein Publikum zu verwirren. „Tod in Bangkok“ ist fast Grusel, „Flashback“ irgendwie Science Fiction. Doch der Verfasser hält sich nicht an Genregrenzen, die er überspringt und sogar Erzählungen präsentiert, die verdächtig in Richtung Belletristik (= ’schöne‘ bzw. ‚echte‘ Literatur) gehen.
Was Simmons tatsächlich gelingt, ist das Ad-Absurdum-Führen einer viel zu lang postulierten Grenze: die zwischen „E“- und „U-Literatur“ nämlich. „Lovedeath“ bietet schlicht spannende Geschichten, die gleichzeitig Stoff zum Nachdenken bieten. Zwar stößt der Autor gewaltig ins Horn: „Lovedeath“ sollte eigentlich (auch im Original) „Liebestod“ heißen und eine Beziehung zu Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ herstellen. So schlimm kommt es jedoch nicht; Simmons bietet durchweg schnörkellose Lektürekost. Ohnehin stellt sich die Frage, ob es überhaupt Literatur gibt, in der Liebe und Tod ausgespart bleiben. Auch Simmons hat inhaltlich wie formal sehr unterschiedliche Erzählungen unter den gemeinsamen Titel gestellt, der dadurch wie eine weit gespannte Klammer wirkt.
Faszinierende aber unbequeme Wahrheiten
Betrachten wir uns die fünf Novellen ein wenig näher. „Das Bett der Entropie um Mitternacht“ kreist um die bekannte aber ungeliebte Erkenntnis, dass es Liebe ohne Risiko nicht gibt. Das Schicksal hat den männlichen Protagonisten doppelt geschlagen: Sein Sohn kam bei einem jener tragischen Unfälle um, mit denen er sich beruflich im Auftrag einer Versicherung beschäftigt. Seither lebt er wie auf dünnem Eis, vermeidet ängstlich jedes Risiko und würde vor allem seine kleine Tochter am liebsten niemals aus den Augen lassen. Immer wieder zitiert er aus seinen „orangefarbenen Akten“, in denen er festhält, wie aus einem nichtigen Anlass eine Tragödie erwachsen kann. Der übervorsichtige Vater kommt zu der Erkenntnis, dass er sein Kind nicht vor allen möglichen Übeln bewahren kann oder muss – er raubt sonst ihr und sich die Lebensfreude. Klingt langweilig? Von wegen! Simmons trifft exakt die richtigen Töne, er weiß Gefühle in Worte und Bilder zu übersetzen und spart zwischendurch nicht mit rabenschwarzem Humor, wenn er von ebenso lächerlichen wie grausamen Unglücksfällen erzählt. (2000 griff Simmons dies übrigens für seinen spannenden Thriller „Darwin’s Blade“, dt. „Das Schlangenhaupt“, wieder auf.)
„Tod in Bangkok“ wirkt wie ein „Nebenwerk“ zu Simmons’ berühmten, mehrfach preisgekrönten Romanerstling „Song of Kali“ (1985; dt. „Göttin des Todes“/“Song of Kali“). Das tropische Asien stellt er als dampfende Sickergrube dar. Bangkok ist eine Stadt, in der Suff, Drogen und Sex zusammen mit Gesetzlosigkeit, Korruption. Armut und Schmutz in einer Halbwelt zusammenfließen, in der sogar der Tod käuflich ist. So deutlich wie keine andere Erzählung macht „Tod in Bangkok“ deutlich, wieso Simmons selbst dieses Buch nicht „Leben und Tod“ nannte: Die Liebe kann durchaus beides subsumieren. Die Atmosphäre rücksichtsloser Verderbtheit verleiht „Tod in Bangkok“ als Erzählung eine unheilvolle Anziehungskraft, während die eigentliche Handlung kaum überraschen kann. In den 1990er Jahren mag AIDS als Symbol modernen Schreckens gewirkt haben. Heute hat Gleichgültigkeit diesen Effekt beeinträchtigt; der von Simmons heraufbeschworene Horror aus Sex und ‚verdorbenem‘ Blut verwandelte die Welt doch nicht in ein Siechen- und Beinhaus, sondern blieb mehr oder weniger auf die Länder der Dritten Welt beschränkt, was ihn problemlos ignorierbar werden ließ.
Mythen ohne Tümeleien
„Sex mit Zahnfrauen“ überrascht als farbenprächtiger Streifzug durch die (Mythen-) Welt der nordamerikanischen Ureinwohner. Der weiße Mann beginnt sich bereits breit zu machen auf den Prärien des nur scheinbar unendlich weiten Kontinents aber noch geben die Indianer sich nicht geschlagen und führen wie seit Jahrtausenden ein Leben, das geprägt wird vom Existieren in und von der Natur sowie einem Glauben, der Geister und mythische Wesen in Tieren, Pflanzen, Felsen oder Quellen ortet; das Nebeneinander von Realität und Übernatürlichem wird als völlig normal erachtet.
In dieser harten aber harmonischen Welt erleben wir die Abenteuer eines jungen Tunichtguts, der eigentlich nur der schönen Maid im Nachbarzelt an die Wäsche möchte, stattdessen seine Berufung zum Schamanen erfährt und sich plötzlich auf einer aufregenden Reise durch sein Land wieder findet, die ihren gefährlichen Höhepunkt in der Begegnung mit den „Zahnfrauen“ des Titels findet – einer besonders für geile junge Kerls unerfreulichen Spezies weiblicher Dämonen. Simmons hat fleißig recherchiert für seine Novelle; letztlich sollte man indes vorsichtig sein mit der Beantwortung der Frage, in wie weit oder ob überhaupt es ihm gelungen ist die historische Realität einer versunkenen indianischen Kultur neu zu beleben. Er präsentiert auf jeden Fall seine unterhaltsame, spannende, mit Humor nicht sparende Version, in der er kräftig gegen kitschigen Ethno-Quark à la „Wer mit dem Wolf tanzt“ vom Leder zieht.
Harte Alternativ-Realität
Eine beklemmende Vision gelingt Simmons mit „Flashback“. In den 1990er Jahren galten die Japaner als ökonomische Gegner, welche die USA wirtschaftlich ins Abseits zu drängen oder gar aufzukaufen drohten. Auf dieser Schiene fährt Simmons ein Stück in eine gar nicht so ferne Zukunft. Die USA sind von der Weltmacht zum Armenhaus abgestiegen; die Schulden der Reagan-Jahre haben das einst reichste Land der Welt zum Schuldner Japans und der Europäischen Gemeinschaft gemacht, die ihre Wirtschaftskriege von amerikanischen Soldaten auskämpfen lassen. Damit diese Weltordnung gewahrt bleibt, schleusen die neuen Herren die Droge „Flashback“ in die USA ein. Fast jeder Bürger nimmt es, ist abhängig davon, kommt nicht auf den Gedanken gegen sein Schicksal aufzubegehren.
„Flashback“ erzählt die Geschichte einer Durchschnittsfamilie, die zufällig von diesem Komplott erfährt. Das genretypische Happy-End bleibt aus; dem ungemein detailliert beschriebenen Alltagsleben der dystopischen Art folgt ein konsequent düsteres Finale, das Simmons zudem als Schriftsteller zeigt, der sich schon vor mehr als einem Jahrzehnt nur zu gut vorstellen konnte, was Globalisierung tatsächlich bedeuten kann.
Delirien eines ‚großen‘ Krieges
Beinahe Romanlänge erreicht „Der große Liebhaber“, die eindringlichste aber auch seltsamste Erzählung dieses Bandes. Akribisch rekonstruiert Simmons die fiktiven Erlebnisse eines jungen Mannes und Schriftstellers, der in den Weltkrieg von 1914-18 zieht und seine Erlebnisse während des realen Somne-Feldzugs von 1916 schildert. Dieser entwickelte sich zu einer Hölle auf Erden, in der die Soldaten aller Krieg führenden Länder zu Hunderttausenden verheizt wurden. Simmons kreiert Bilder äußersten Schreckens, die sich eng an zeitgenössischen Frontberichten orientieren. Eine ganze Generation junger und talentierter Schriftsteller zog mit in diesen Krieg. Sie schrieben über das Grauen, das sie hautnah erlebten, und das mit dem Talent, das ihnen gegeben war. Immer wieder streut Simmons Gedichte aus und vom Krieg ein seine Novelle ein. Er lässt sie von seinem Protagonisten verfassen; in ihrer poetischen Wucht und Eindringlichkeit verdichten sie künstlerisch den Schrecken, den Simmons ansonsten betont sachlich in knapp gehaltenen Tagebucheinträgen fixiert.
„Der große Liebhaber“ lässt seine Leser freilich ratlos zurück. Was möchte uns der Autor sagen? Krieg ist die Hölle, das stellt er wortgewaltig unter Beweis. Dennoch belebt Simmons primär die Erinnerung an einen Krieg, der längst Geschichte ist. Gewisse Strukturen des Schreckens – durch die Kriegshistorie zieht sich als dicker roter Faden die Menschen verachtende Dummheit frontfern entscheidender Feldherren – sind zeitlos. Trotzdem erschreckt Simmons eher vordergründig durch drastische Splatter-Szenen als durch die Darstellung der Sinnlosigkeit des Grabenkampfes.
Aufgesetzt wirken außerdem jene Szenen, in denen der psychisch überforderte Soldat die „Lady in Weiß“ halluziniert. Sie sollen seine ungebrochene Lebenslust bzw. -sehnsucht im Angesicht der Hoffnungslosigkeit illustrieren. Der Schuss geht nach hinten los: Lange fragt man sich, ob Simmons von einer Kriegs- zu einer Geistergeschichte umschwenkt. (Das hatte er übrigens in der früheren Novelle „Iversons Gruben“ vor dem Hintergrund des Amerikanischen Bürgerkriegs von 1861-65 schon getan.) Der Tod in Frauengestalt kann mit den Schrecken des Schlachtfelds nicht mithalten. Es fehlt zudem eine Auflösung; das Kriegstagebuch bricht unvermittelt ab. Simmons selbst übernimmt es das Nachkriegsleben seiner Figur zu beschreiben.
Plötzlich entpuppt sich „Der große Liebhaber“ als Versuch eines Psychogramms. Nicht ohne Grund wird der I. Weltkrieg in Großbritannien noch heute als der „Große Krieg“ bezeichnet. Ganze Jahrgänge junger Männer fielen im Felde; ihr Fehlen führte zu enormen gesellschaftlichen Verwerfungen, deren Folgen sich erst nach dem Krieg abzeichneten. Simmons gelingt es nur bedingt diese Entwicklung am Beispiel eines individuellen Schicksals darzustellen. Letztlich beeindruckt und erschreckt „Der große Liebhaber“ als stupende handwerkliche Leistung eines bemerkenswerten Verfassers. Ihn deshalb gescheitert zu nennen wäre falsch: „Der große Liebhaber“ entwickelt auf jeden Fall einen düsteren Sog, dem sich kein Leser entziehen kann.
Unterm Strich ist dies wohl die Gemeinsamkeit, welche die „Lovedeath“-Erzählungen eint; ich empfinde das als großartige Empfehlung für ein Buch, das die Lektüre von der ersten bis zur letzten Seite lohnt. Ein – zudem flüssig übersetztes – Werk dieser inhaltlichen und formalen Qualität sollte in den von öden Endlosreihen dominierten Regalen der deutschen Buchmärkte keinesfalls untergehen.
Autor
Dan Simmons wurde 1948 in Peoria, Illinois, geboren. Er studierte Englisch und wurde 1971 Lehrer; diesen Beruf übte er 18 Jahre aus. In diesem Rahmen leitete er eine Schreibschule; noch heute ist er gern gesehener Gastdozent auf Workshops für Jugendliche und Erwachsene.
Als Schriftsteller ist Simmons seit 1982 tätig. Fünf Jahre später wurde er vom Amateur zum Profi – und zum zuverlässigen Lieferanten unterhaltsamer Pageturner. Dass er nicht längst in dieselbe Bestseller-Kategorie aufgestiegen ist wie Dan Brown oder Stephen King, liegt wohl primär daran, dass er auf zu vielen Hochzeiten tanzt: Simmons ist einfach zu vielseitig, lässt sich in keine Schublade stecken, versucht immer wieder etwas Neues. Leider liebt das träge Leservieh keine Aufregung, sondern hält sich lieber an das Bekannte, scheinbar Bewährte. Ein flinker Schriftsteller wie Simmons taucht unter zu vielen Masken auf und kann sich deshalb nicht als Markenzeichen etablieren. In Deutschland wird er daher wohl ewig im Taschenbuch-Getto gefangen bleiben, während es Fließband-Kolleginnen und -Kollegen längst zum gediegen gebundenen Festeinband gebracht haben, der allein vom Radar der ‚richtigen‘ Literaturkritik geortet wird: eine Ungerechtigkeit, die den wissenden Fan indes nicht davon abhalten wird, den Meister in seinen vielen Verkleidungen zu finden!
Über Leben und Werk von Dan Simmons informiert die schön gestaltete Website http://www.dansimmons.com.
Impressum
Originaltitel: Lovedeath. Five Tales of Love and Death (New York: Warner Books 1993)
Übersetzung: Joachim Körber
Deutsche Erstausgabe: Dezember 1999 (Blitz Verlag)
352 S.
ISBN-10: 3-93217-122-5
Diese Ausgabe: Oktober 2005 (Festa Verlag/Horror-TB Nr. 1512)
431 S.
EUR 9,90
ISBN-13: 978-3-86552-032-6
www.festa-verlag.de
Henry Kolarz – Nachts um 4 wird nicht geklingelt
Im Jahre 1959 sitzen im Zuchthaus Ivy Bluff, gelegen im US-Staat North Carolina, 37 Kapitalverbrecher der unverbesserlichen Sorte ein. Hier sollen sie nicht rehabilitiert, sondern weggeschlossen und mit jenem Eifer bestraft werden, der für die gesetzestreuen und frommen Bewohner der Südstaaten typisch ist. Die Männer hinter Gittern müssen im Steinbruch schuften, werden mit einem Brei aus Schweineleber und Maismehl gefüttert, dürfen nicht lesen, rauchen oder entspannen, werden von abgestumpften, tückischen Wächtern misshandelt. Ihre berechtigten Proteste verhallen ungehört.
An einem kalten Dezembertag wagen 19 Männer den Ausbruch. Mörder, Vergewaltiger, Bankräuber, Psychopathen sind es, die Ivy Bluff den Rücken kehren. Wie Tiere hat man sie gehalten, sie haben nichts zu verlieren, sind zu allen entschlossen. Blitzschnell zerstreuen sie sich in alle Himmelsrichtungen, springen auf Güterzüge, stehlen Autos oder verkriechen sich in abgelegenen Schlupfwinkeln. Sie nehmen Geiseln, sie rauben und töten.
Angst greift unter den braven Bürgern Amerikas um sich. 19 tollwütige Teufel treiben ihr Unwesen! Starke Männer schlafen mit der Waffe in der Hand, Mütter, Hausfrauen und behütete Töchter weinen und trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Glücklicherweise ist das Gesetz stark in Amerika. Gottes kriminalistische Zuchtrute auf Erden – FBI-Chef J. Edgar Hoover – setzt seine besten Männer auf den Fall an. Sie rasten und ruhen nicht, treiben die Strolche, denen die Knie zittern, wenn das Wort „FBI“ fällt, in die Enge. Aber der Teufel sorgt trotzdem für die Seinen: Obwohl Polizisten jeden Stein umdrehen und auch redliche Bürger ihre Nachbarn noch schärfer als üblich – es könnten ja Kommunisten sein – im Auge behalten, schlüpfen einige Schufte ihren Verfolgern durch die Maschen. Wochen und Monate vergehen, in denen das Lumpenpack für Angst & Schrecken sorgt, bis letztendlich das Gesetz obsiegt …
Henry Kolarz schrieb seinen „Roman nach Tatsachen“ im Jahre 1961. Dem Buch ging eine Reportageserie für die Illustrierte „Stern“ voraus, für die der Verfasser angeblich vor Ort recherchierte. Theoretisch muss er also über Fakten und Hintergründe informiert gewesen sein. Für den Roman beschloss Kolarz indes diese zugunsten der Spannung weitgehend zu ignorieren.
Jeder billige Trick ist ihm dabei recht. Der Ausbruch von Ivy Bluff ist in seinem historischen Ablauf recht gut belegt. Besagte Fakten sprechen eigentlich für sich. Kolarz sucht jedoch das menschliche Drama. Ihn interessiert das Verhalten von 19 verzweifelten, gefährlichen Männern auf der Flucht. Was treibt sie, was fühlen sie, wie gehen sie miteinander und mit den Menschen um, die sie immer wieder treffen? Das sind gute Fragen, die der Verfasser freilich nie gestellt zu haben scheint. Er nutzt das Ivy-Bluff-Geschehen stattdessen als Aufhänger für ein Thrillergarn, das als Vorlage für ein zeitgenössisches B-Movie dienen könnte.
Effekthascherei und moralinsaure Klischees bestimmen die Handlung. Kolarz’ Amerika ist die Kulisse, in der auch die „Jerry Cotton“-Filme der 1960er Jahre gedreht werden. Von einem echten Verständnis für Land und Leute kann nicht die Rede sein. Die Figuren denken und reden in Phrasen. Die Story orientiert sich nur lose an den tatsächlichen Ereignissen. Kolarz „interpretiert“ und interpoliert, erfindet ganze Handlungsstränge so, dass sie ins von ihm geschaffene Gesamtbild passen.
Dieses ist eindeutig der Sensationslust verpflichtet. Allen Ernstes versucht Kolarz seinen Leser weiszumachen, dass 19 Verbrecher ein Land von der Größe der Vereinigten Staaten terrorisieren könnten. Tatsächlich waren die Männer von Ivy Bluff der Justizmaschine, die ihr Ausbruch in Gang setzte, nie gewachsen. Die meisten Häftlinge wurden rasch gefasst. Dass andere länger frei blieben, lag eher an der Unfähigkeit ihrer Jäger und der Tücke des Objekts als an ihrem kriminellen Geschick.
Natürlich kann auch keine Rede von einer „Blutspur“ sein, welche die Ausbrecher durch das Land zogen. Auch Kolarz kann nicht leugnen, dass diese neue Verbrechen fast ausschließlich begingen, um ihre Flucht fortsetzen zu können. Er versucht das zu vertuschen, indem er die Flüchtlinge ständig streiten, fluchen und ihren Opfern mit „Umlegen“ drohen lässt – kindisches Gehabe, das wohl nur Filmgangster an den Tag legen. Dazu passt ein Stil, der dokumentarische Sachlichkeit mit der naiven Nachäffung dessen mischt, was der Autor für „hartboiled“ hält. War er tatsächlich vor Ort? Hat er mit Amerikanern gesprochen? Sich umgesehen? Das zu glauben fällt wie gesagt sehr schwer.
Schwarz-Weiß-Malerei betreibt Kolarz auch in der Figurenzeichnung – dies sogar buchstäblich: Mit unerfreulicher Geschmeidigkeit macht sich der Autor den Rassismus der US-Südstaaten zu Eigen. Oder liegt er womöglich auf ähnlicher Linie? Geradezu niederträchtig setzt Kolarz auf rassistische Klischees, um seinem Thriller Schwung zu verleihen. Dabei achtet er sorgfältig darauf, entsprechende Äußerungen stets seinen Ausbrecherfiguren in den Mund zu legen – es sind schließlich Schwerverbrecher, denen man jede Schlechtigkeit zutrauen darf.
Also ist es Gangster Anderson, der die „Neger“ (das durfte man 1961 problemlos schreiben) für die Leser folgendermaßen über den Kamm schert: „Stinken, fressen, und ‚rumhuren – das ist alles, was die können.“ (S. 36) Doch es ist Kolarz, der auf den folgenden Seiten alles daran setzt, diese bösen Unterstellungen mit Leben zu füllen. William Shaw, dessen Porträt (zusammen mit den Fotos seiner Komplizen) auf dem Cover der deutschen Erstauflage abgedruckt ist und alles andere als eine Galgenvogelphysiognomie aufweist, wird bei ihm zum hässlichen, blöden, brutalen, verfressenen und vor allem ewig geilen Unhold, der es auf „unschuldige“ weiße Frauen abgesehen hat, bei deren Anblick „seine Zunge feucht aus den dicken Lippen schoss“ (S. 67). Selbst seine Kumpane ekeln sich vor ihm und prügeln den „Nigger“ tüchtig, damit er sich „benimmt“.
Auch sonst bedient Kolarz gern alle einschlägigen Vorurteile. Wenn Ausbrecher Stewart einen schwarzen Eisenbahnarbeiter überfällt, um dessen Kleidung zu rauben, wird dies so eingeleitet: „Ein Neger richtete sich schlaftrunken im Bett auf und glotzte Stewart blöde an … ‚Ich hab’ nichts verbrochen, Massa!'“ (S. 39). Später gerät Stewart in New York unter die „Portoricaner“ – gemeint sind Zuwanderer von der Karibik-Insel Puerto Rico. Die schildert Kolarz als „Halbaffen“, welche „ihren“ Stadtteil fest im Griff haben und gegenüber den alteingesessenen (natürlich weißen) Bürgern unverschämt auftreten: „Jetzt haben sie sich auf der ganzen Westseite eingenistet … Zu Hause auf ihrer Insel hätten sie arbeiten müssen, aber hier gibt man ihnen fünfunddreißig Dollar in der Woche Unterstützung. Und die Behörden wagen es nicht, sie hart anzufassen. Ihre Stimmen können Wahlen entscheiden.“ (S. 157) Also: Vorsicht vor Fremdlingen, deutsche Leser, auf dass es uns nicht ebenso ergeht! (Ach ja: Und um 4 Uhr morgens liegen ordentliche Menschen im Bett – es muss also ein Strolch sein, wenn es um diese unchristliche Zeit an der Tür klingelt!)
Wohl unfreiwillig gelingt Kolarz das Kunststück, in seinem Roman nicht eine sympathische Figur auftreten zu lassen. Seine Ausbrecher sind selbstverständlich vertierte Rohlinge, die nichts als Raubmord & Vergewaltigung im Kopf haben. Wenn’s aber zur Sache geht, werden sie eigenartig zimperlich – Pech für Kolarz, dass die 19 Unholde nachweislich nur einen Mann umbrachten. So muss er sie über weitere Schreckenstaten eben fantasieren lassen.
Möglichst deutlich soll der Unterschied zwischen Abschaum und Vorschriftsbürger ausfallen. Der US-amerikanische Durchschnittsjoe würde sich nach Kolarz dem Terror nichtswürdiger Strolche normalerweise niemals beugen und diese unerschrocken Mores lehren. Leider steht ihm in der Regel eine schwache Frau im Weg, die beschützt werden muss und dabei heftig klammert. Kolarz-Frauen sind ängstlich, willenlos, abhängig von „ihrem“ Mann/Vater/Bruder. In der Krise zerfließen sie in Tränen, verfallen in blinde Panik und sind auch sonst die reinste Landplage.
Das Gesetz repräsentieren nach Kolarz ausschließlich aufrechte, unbestechliche Männer, die das Verbrechen mit Leib und Seele hassen. Ist ein Mensch kriminell geworden, so trägt er selbst die Schuld daran. Aufgabe der Polizei ist es, ihn zu verfolgen und zu fassen. Will er nicht aufgeben – umso besser: Gefangene werden ungern gemacht; man spart dem Staat gutes Geld, wenn man solches Pack umgehend austilgt.
Die Elite der Strafverfolger bildet „FBI“, von Kolarz penetrant ohne Artikel genannt. Stellvertretend für dessen Mitarbeiter stellt uns der Verfasser Mike Pastrato vor, „41 Jahre alt, Besitzer eines bis auf einen kleine Rest abbezahlten Hauses im Villenviertel und Vater von drei Kindern, die davon träumen, später auch einmal FBI-Agenten zu werden.“ (S. 45) Nach dem Mittagessen zieht Mike stets ein frisches Oberhemd an; ein halbes Dutzend Hemden hängt in seinem Aktenschrank. Ja, das sind die Menschen, die Amerika zu dem machen, was es geworden ist: manisch sauber, fleißig, angepasst & wie ein Zahnrad funktionierend.
So ließe es sich leicht viele Seiten weiter schimpfen und schaudern, doch es soll an dieser Stelle genug sein. „Nachts um 4 wird nicht geklingelt“ sollte heute, mehr als vier Jahrzehnte nach seiner Entstehung, ganz sicher nicht als Tatsachenbericht, sondern als (schlechter) Roman gelesen werden. Miserable Thriller gibt es allerdings auch in der Gegenwart mehr als genug. Wieso also Zeit an diesen alten Schinken verschwenden?
Weil „Nachts um 4 …“ inzwischen selbst zum Zeitdokument geworden ist. Anders ausgedrückt: Hier redet der Zeitgeist, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. 1961 ist noch nicht gar so lange her – und 1961 lag 1945 gerade 16 Jahre zurück. Da erstaunt die Offenheit, mit der „Neger“ und „Portorikaner“ unverhohlen dämonisiert und letztlich entmenschlicht werden, ohne dass sich jemand dadurch gestört gefühlt hätte. Insofern ist auch „Nachts um 4 …“ ein weiteres Indiz dafür, dass 1945 für das „deutsche Wesen“ keinen glatten Schnitt und Neuanfang bedeutete.
Interessant ist darüber hinaus die schlichte Schwarzweißsicht, die Kolarz einem ganzen Kontinent aufprägt, wobei er Amerika schreibt aber Europa bzw. Deutschland meint. Die Obrigkeit hat immer Recht, also gehorche ihr als Bürger und sei ihr dienstbar. Wer nicht mitspielt, macht sich als Außenseiter verdächtig und steht bereits mit einem Bein im Gefängnis. Ist man dort angelangt, hat man seine Menschenrechte verwirkt und ist eine Bestie, die am besten abgeknallt wird; in der Tat hat man den Ausbrecher Yank Hensley von Amts wegen zum Vogelfreien erklärt: Jeder brave Bürger durfte ihn ohne Warnung niederschießen. Es fällt schwer zu glauben, dass dies in einem zivilisierten Land unter „Rechtsprechung“ fiel.
Aber mit Recht & Gesetz ist das in den USA seit jeher eine besonders Sache … Ivy Bluff selbst ist ein gutes Beispiel dafür. Diese Einrichtung nimmt auf der Liste der historischen Justizirrwege, die in den USA begangen wurden, einen der oberen Plätze ein. 1956 wurde diese Strafanstalt speziell für verurteilte Verbrecher gegründet, die als „zu schwierig“ für „normale“ Gefängnisse eingeschätzt wurden, weil sie zur Gewalt gegenüber Wärtern und Mithäftlingen, Ausbrüchen oder sonstigem unkooperativen Verhalten neigten. In Ivy Bluff sollten sie zur Raison gebracht werden und nachdrücklich büßen, was sie der Gesellschaft angetan hatten. Dies betrieben die Betreiber mit einer Inbrunst, die 1959 gleich die Hälfte der Insassen zum Ausbruch aus der angeblichen Hochsicherheitseinrichtung trieb.
Sie wurden wieder gefangen, aber die Tage von Ivy Bluff als Gefangenenlager im mittelalterlichen Stil waren gezählt. Selbst gesetzestreue Bürger waren schockiert, als im Zuge der Ermittlungen herauskam, wie die Häftlinge hier gehalten und be- oder besser misshandelt wurden. (Hätten sie es nicht erfahren, wäre es ihnen sicher gleichgültig gewesen.) 1963 wurde aus Ivy Bluff „Blanch Prison“, eine Einrichtung für kranke Gefangene, die natürlich nicht mehr zur Zwangsarbeit antreten mussten. 1983 wandelte man Blanch eine Strafanstalt für Jugendliche um, die während ihrer Haftzeit in anderen Gefängnissen in Schwierigkeiten gerieten. 1999 wurde Blanch geschlossen.
Henry Kolarz, geboren 1927 in Berlin, schlug bereits in jungen Jahren die journalistische Laufbahn ein. Für diverse Illustrierten verfasste er mehrteilige Reportagen und spezialisierte sich dabei auf kriminalistische Themen. Storys wie „Nachts um 4 wird nicht geklingelt“, „Wenn Joseph nicht gesungen hätte“ oder „Der Tod der Schneevögel“ arbeitete Kolarz später in recht erfolgreiche „Tatsachenromane“ um. Den Durchbruch brachte ihm seine „Nacherzählung“ des berühmten englischen Postraubs von 1963, die unter dem Titel „Die Gentlemen bitten zur Kasse“ auch für das Fernsehen verfilmt und zu einem bekannten „Straßenfeger“ wurde.
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre verlagerte Kolarz seine schriftstellerische Arbeit und verfasste mit „Kalahari“ einen ersten „echten“ Roman bzw. Politthriller, dem er 1981 „Die roten Elefanten“ (1986 als siebenteilige TV-Serie verfilmt) folgen ließ. Kolarz, der am 12. Oktober 2001 in Hamburg starb, schrieb darüber hinaus diverse Drehbücher für Fernsehdokumentationen und Krimis (u. a. für „Tatort“).
Lee Child – Zeit der Rache
In New York nimmt ein Einsatzkommando des FBI den ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher fest. Ihm wird Serienmord vorgeworfen. Man fand zwei Frauen tot in ihren Badewannen, die bis zum Rand mit Armee-Tarnfarbe gefüllt waren. Die Ermittler fanden keinerlei Spuren aber zwei Gemeinsamkeiten: Beide Opfer waren Ex-Soldatinnen und hatten vor Jahren Anklage wegen sexueller Belästigung gegen Vorgesetzte eingereicht, deren Karrieren dadurch zerstört wurden. Die Untersuchung leitete in beiden Fällen Reacher!
Seine Unschuld stellt sich heraus, als ein neuer Mord nach bekanntem Muster erfolgt aber Reachers Alibi wasserdicht ist. Trotzdem muss er dem FBI helfen, da die Armee es ablehnt, mit Zivilisten zusammenzuarbeiten, Direktor Black schreckt nicht davor zurück, Reacher offen zu erpressen. Wohl oder übel beugt sich Reacher, aber als er sogleich das aufwändige Täterprofil der FBI-Spezialisten verwirft und die Zahl der potenziellen Opfer im Widerspruch zu diesen erheblich eingrenzt, wird ihm kein Glauben geschenkt. Lee Child – Zeit der Rache weiterlesen
Rankin, Ian – Sünden der Väter, Die
In ihrem Bemühen, den lästigen Untergebenen endlich aus seinem Job zu ekeln, haben sich Detective Inspector John Rebus’ Vorgesetzte etwas Neues einfallen lassen. Sie beauftragen ihn, gegen den alten Gelehrten Joseph Lintz zu ermitteln. Der steht im Verdacht, in jungen Jahren als Mitglied von Hitlers SS in Frankreich aktiv an unerhörten Kriegsgräueln teilgenommen zu haben. Lintz streitet dies ab und erweist sich als Meister der ausweichenden Auskunft – oder als Unschuldiger.
Viel lieber würde Rebus bei den Ermittlungen gegen Tommy Telford mittun. Der junge, charismatische Gangsterboss plant, sich zum Führer der Edinburgher Unterwelt aufzuschwingen. Jede kriminelle Machenschaft ist ihm dabei Recht. Er legt sich sogar mit dem bisherigen Alleinherrscher „Big Ger“ Cafferty an, der zwar in die Jahre gekommen aber keineswegs willig ist, die Macht zu teilen. Ein Bandenkrieg droht; erste Opfer sind bereits zu beklagen.
Die Polizei steht dem mehr oder weniger hilflos gegenüber. Sowohl Cafferty als auch Telford haben ihre Truppen gut im Griff. „Gesungen“ wird nicht, Beschattungen fliegen regelmäßig auf. Rebus schleicht sich trotzdem gern zu den Beamten der Scottish Crime Squad, einer Sondereinheit, der auch Siobhan Clarke, Rebus’ Ex-Kollegin und gute Freundin, inzwischen angehört. Für ihn ist dieser Fall persönlich geworden: Ein Autofahrer hat Sammy, seine Tochter, angefahren und schwer verletzt. Rebus, der sich als Vater in der Vergangenheit viele Fehler geleistet hat, wird von seinem Gewissen und von Wut übermannt. Er will den Unglücksfahrer, er will Rache. Um sie zu bekommen, verbündet er sich sogar mit seinem Erzfeind Cafferty, der einwilligt, ihm den Schuldigen zu liefern. Dafür soll Rebus Telford hinter Gitter bringen.
Derweil findet sich Lintz’ Leiche. Man hat den alten Mann an einem Friedhofsbaum aufgeknüpft – offenbar ein Mord mit Hinrichtungscharakter. Wer ist es, der das Recht in die eigene Hand genommen hat? Notgedrungen bleibt Rebus am Ball und entdeckt Verbindungen zwischen Lintz und Telford. Der hat sich außerdem mit dem tschetschenischen Mafiaboss Jake Tarawicz eingelassen, welcher sich in Edinburgh als Menschenhändler und Dealer etablieren möchte. Schließlich werden sogar hochrangige Mitglieder der Yakuza gesichtet, die stets eine Möglichkeit suchen, außerhalb Japans scheinbar legale Unternehmen als Geldwaschanlagen zu erwerben.
Rebus will sie in seinem Zorn alle drankriegen. Dass er sich dabei übernommen hat, dämmert ihm spätestens, als er sich auf einen Stuhl gefesselt und mit einem Stromkabel malträtiert wiederfindet …
Wie üblich setzt Ian Rankin seinen Inspektor Rebus erneut einem Trommelfeuer aus kriminalistischen Herausforderungen und privaten Schicksalsschlägen aus. Insgesamt zerfällt „Die Sünden der Väter“ in zwei Handlungsstränge. Da haben wir einerseits Rebus’ Kampf gegen die Unterwelt von Edinburgh und andererseits seine Ermittlungen gegen einen möglichen Kriegsverbrecher. Beide Stränge werden verklammert durch Rebus’ Bangen um das Leben seiner im Koma liegenden Tochter bzw. sein Versagen als Familienvater: Der „Sünden der Väter“, auf die der deutsche Titel anspielt, haben sich sowohl Joseph Lintz als auch John Rebus jeder auf ihre Weise schuldig gemacht. Mehrfach blendet Rankin Episoden ein, in denen sich Rebus daran erinnert, wie er seine Familie enttäuscht hat.
„Die Sünden der Väter“ ist gleichzeitig ein neues Kapitel im spannenden Duell zwischen Rebus und „Big Ger“ Cafferty. Der Polizist und der Gangster sind Todfeinde und sich – Rebus’ Kollegen beobachten es mit Misstrauen – als solche näher als manche Freunde. Sie kennen sich seit Jahren, wissen um ihre Geheimnisse, nutzen einander aus und versuchen dem Gegenüber stets mindestens einen Schritt voraus zu sein. Rankin nutzt diesen Zweikampf als Aufhänger, um Edinburghs „Fortschritte“ auf dem Weg zur Verbrechermetropole des 21. Jahrhunderts zu beschreiben. Die kriminelle Szene ist zum Spiegelbild einer zunehmend globalisierten Welt geworden: Syndikate überspringen Meere und Kontinente, breiten sich aus, erobern neue Territorien, in denen sie zentral möglichst alle illegalen Aktivitäten kontrollieren und steuern. Der Kontakt zum politischen und wirtschaftlichen Establishment wird gesucht und gefunden, an die Gesetze hat sich nur der Steuerzahler als von oben und unten geschorenes Schaf zu halten.
Die Polizei ist entweder machtlos oder bereits Teil des Filzes. Im Vergleich zu ihren Gegnern sind die Beamten hoffnungslos unterbesetzt, schlecht ausgerüstet und entsprechend motivationsarm. Rebus hat es mit oft halblegalen Tricks, aus langer Berufslaufbahn erwachsener Erfahrung und kriminalistischem Dickkopf geschafft, Erfolge zu erzielen. Mit der Unterwelt in ihrer Gesamtheit legt er sich erst an, als er sich persönlich angegriffen fühlt. Die Handlung wird rau, während die Spannung steigt, denn selten hat sich Rebus so viele Feinde gemacht, derer er sich nun gleichzeitig erwehren muss. Das gelingt ihm mit dem üblichen Einfallsreichtum, aber er muss harte Schläge einstecken.
Dabei stellt sich – nicht zum ersten Mal – die Frage, ob es Rankin nicht ein wenig übertreibt. Zwei Gangsterbanden im Krieg: Das genügt ihm nicht. Er lässt auch noch die russische Mafia und die Yakuza mitmischen. Sicherlich ist das ein wenig zu viel des Schlechten. Allerdings muss man bewundern, wie Rankin seinen Rebus geschickt die verschiedenen Parteien gegeneinander ausspielen lässt. Am Ende siegt die Gerechtigkeit, aber Rankin wäre nicht Rankin, würde er den Triumph nicht sogleich wieder relativieren: Die Macht kennt kein Vakuum, so lässt er Rebus sehr richtig sinnieren; dort wo sie verschwindet, strömt sie sogleich von außen nach. Obwohl die meisten Gangster letztlich auf der Strecke bleiben, wird Edinburgh dasselbe kriminelle Pflaster wie bisher bleiben.
Eindeutig überflüssig wirkt mit dem Fortschreiten der Geschichte der Handlungsstrang um Joseph Lintz. Rankin legt hier eine falsche Fährte, die ihm viel Raum für moralische Exkurse zum Thema Schuld und Sühne bietet. Gleichzeitig geht es um die Schuld derjenigen Regierungen, die einst zum Kampf gegen den Nationalsozialismus und seine Vertreter angetreten sind, aber später die „nützlichen“ Nazis vor einer Bestrafung bewahrten, sie mit Geld und einer weißen Weste ausstatteten und beschützten – ein düsteres Kapitel, das noch heute sorgfältig unter den Teppich gekehrt bleibt. Dieses Thema böte Stoff für einen eigenen Roman. Hier wird es verheizt bzw. wirkt wie eine dieser peinlichen Gedenkaktionen, die sich bußfertige Gutmenschen gern ausdenken, ohne die eigentlich Betroffenen vorher zu fragen, ob ihnen dies Recht ist.
Rebus als Rächer: Mit „Die Sünden der Väter“ schlägt Verfasser Ian Rankin einen weiten Bogen zurück zum ersten Band der Serie. „Verschlüsselte Wahrheit“ zeigte einen Rebus, dessen Dienstzeit in einer militärischen Spezialeinheit ihn psychisch schwer gezeichnet hatte. Wir erfuhren, dass Rebus in „schmutzigen“ Guerillataktiken und zum Kampf gegen Terroristen ausgebildet wurde. Er versteht es also, seinen Gegnern eine ungemütliche Zeit zu bereiten. Zu viele Zigaretten und noch mehr Alkohol haben Rebus’ körperliche Fitness zwar untergraben. An seiner Entschlossenheit, selbst unter starkem Stress einen „Auftrag“ durchzuziehen, konnte dies jedoch nichts ändern.
Dieses Mal ist Rebus sogar doppelt motiviert: Seine Polizeiarbeit ist ihm heilig, auch wenn er sie auf seine Weise erledigt und sich wenig um die Dienstvorschriften schert. Ganz besonders hasst er das organisierte Verbrechen in „seiner“ Stadt. Mit „Big Ger“ Cafferty hat er schon lange mehr als eine Rechung offen; die beiden liefern sich ein Katz-und-Maus-Spiel, das Rebus nie gewinnen konnte. Tommy Telford ist ebenfalls ein gefährlicher Verbrecher, den Rebus gern ausgeschaltet sähe. In dieser Verfassung kommt es ihm dann nicht mehr darauf an, sich auch mit der russischen Mafia und der Yakuza anzulegen.
In die Wut flüchtet sich Rebus vor allem deshalb, weil sein schlechtes Gewissen ihm zu schaffen macht. Sammy ist das Kind einer unglücklichen Ehe. Rebus und seine Frau waren zerstritten, er war zweifellos ein nachlässiger Vater, dessen Gedanken meist um den aktuellen Fall und kaum um seine Familie kreisten. Erst in jüngster Zeit bemüht sich Rebus, seiner Tochter näher zu kommen. Jetzt droht sie zu sterben. Rebus projiziert das eigene Versagen auf Cafferty, Telford & Co. Außerdem sucht er sich eine „Ersatztochter“: Die junge bosnische Einwanderin Dunja wurde von Telford zur Prostitution gezwungen. Rebus nimmt sich ihrer an. Sie will er „retten“, was ihm bei Sammy misslungen ist. Selbstverständlich ist er hier auch nicht erfolgreicher.
Eher lästig ist Rebus dagegen die Beschäftigung mit dem Fall Joseph Lintz. Der Polizist repräsentiert hier die Mehrheit seiner Zeitgenossen, für die Ende des 20. Jahrhunderts die Nazis nur mehr Schauergestalten aus Geschichtsbüchern und Filmen sind. Rebus liest die Berichte über die Ermordung einer ganzen Dorfbevölkerung, an der Lintz sich beteiligt haben soll, aber das in Erfahrung Gebrachte berührt ihn zunächst nicht: Zu viel Zeit ist vergangen, Zeitzeugen gibt es kaum noch. Diese Haltung ist es, die für Lintz den besten Schutz bedeuteten: So lange er sich in seinem zweiten Leben nichts zuschulden kommen ließ, interessierte sich niemand für das erste. Darüber hinaus ist Lintz ein vornehmer, gebildeter Herr, der für sich einnimmt und mit dem Mörder von einst nichts mehr gemein hat.
Aber einige Opfer der Nazis haben eben doch überlebt. Sie vergessen und vergeben nicht, weil sie das allgemeine Vergessen fürchten. Deshalb fordern sie auch Jahrzehnte nach dem Ende des Nazi-Terrors Gerechtigkeit. Nur widerwillig laufen die Mühlen des Gesetzes an; es gibt mehr als genug aktuelle Verbrechen, um die es sich zu kümmern gilt. Auch Rebus muss erst lernen, dass diese Vergangenheit nicht tot ist, weil sich die Sünden der Väter auf die Nachkommen der Täter und Opfer vererben können. Ob Lintz ein Schlächter war oder nicht, bleibt im Grunde Nebensache. Rankin lässt diese Frage daher offen.
Für Rebus erweist sich vor allem Dunja als Bindeglied zwischen den alten und neuen Schrecken. Auch die junge Frau ist ein Kriegsopfer: Als bosnische Muslimin wurde sie während des Balkankriegs von „ethnischen Reinigungstruppen“ – Mordkommandos – verfolgt. Auch nach dem Ende des Kriegs wagt sie nicht heimzukehren. Die Mörder sind weiterhin unter ihren Landsleuten. So wie Dunja erging es im nazideutsch terrorisierten Europa unzähligen Menschen. Ihr Schicksal ist zeitlos. Es führt Rebus vor Augen, was die Lintzes dieser Welt tatsächlich verbrochen haben. Zumindest in diesem Punkt „funktioniert“ Rankins Lintz-Episode. Sie muss ihm wichtig gewesen sein, denn sie gab dem Buch seinen Originaltitel: „In a hanging garden / change the past / In a hanging garden / wearing furs and masks“, singen „The Cure“ auf ihrem Album „Pornography“ von 1982. Doch was geschehen ist, bleibt geschehen und wird Teil der Gegenwart. Gleichgültig wie gut es getarnt wird: Irgendwann kommt es unbewältigt und mit ungebrochener Wucht wieder zum Vorschein.
Ian Rankin wird 1960 in Cardenden, einer Arbeitersiedlung im Kohlerevier der schottischen Lowlands, geboren. In Edinburgh studiert er ab 1983 Englisch, zunächst mit dem Schwerpunkt Amerikanische, später Schottische Literatur. Schon früh beginnt er zu schreiben. Zunächst hoffnungsvoller Poet, wechselt er als Student zur Prosa. Nach zahlreichen Kurzgeschichten versucht er sich an einem Roman, findet aber keinen Verleger. Erst der Bildungsroman „The Flood“ erscheint 1986 in einem studentischen Kleinverlag.
Nachdem sein Stipendium ausgelaufen ist, verlässt Rankin 1986 die Universität und geht nach London, wo er u. a. als Redakteur für ein Musik-Magazin arbeitet. Nebenher veröffentlicht er den Kolportage-Thriller „Westwind“ (1988) sowie den Spionageroman „Watchman“ (1990). Unter dem Pseudonym „Jack Harvey“ verfasst Rankin in rascher Folge drei actionlastige Thriller. 1991 greift Rankin eine Figur auf, die er vier Jahre zuvor im Thriller „Knots & Crosses“ (1987; dt. „Verborgene Muster“) zum ersten Mal hat auftreten lassen: Detective Sergeant (später Inspector) John Rebus. „Knots & Crosses“ war 1987 weniger als Kriminalroman, sondern eher als intellektueller Spaß im Stil Umberto Ecos gedacht, den sich der literaturkundige Autor mit seinem Publikum machen wollte. Schon die Wahl des Namens, den Rankin seinem Helden gab, verrät das Spielerische: Um Bilderrätsel – Rebusse – dreht sich die Handlung.
Mit John Rebus gelingt Rankin eine Figur, die im Gedächtnis seiner Leser haftet. Als man ihn immer wieder auf das weitere Schicksal des Sergeanten anspricht, wird er sich dessen Potenzials bewusst. Die Rebus-Romane ab „Hide & Seek“ (1991; dt. „Das zweite Zeichen“) spiegeln das moderne Leben (in) der schottischen Hauptstadt Edinburgh wider. Rankin spürt seither den dunklen Seiten nach, die den Bürgern, vor allem aber den (zahlenden) Touristen von der traulich versippten Führungsspitze aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kirche gern vorenthalten werden. Daneben lotet Rankin die Abgründe der menschlichen Psyche aus. Simple Schurken, deren möglichst malerisches, weil „gerechtes“ Ende bejubelt werden kann, gibt es bei ihm nicht.
Ian Rankins Rebus-Romane kommen nach 1990 in Großbritannien, aber auch in den USA stets auf die Bestsellerlisten. Die renommierte „Crime Writers‘ Association of Great Britain“ zeichnet ihn zweimal mit dem „Short Story Dagger“ (1994 und 1996) sowie 1997 mit dem „Macallan Gold Dagger Award“ aus. 1992 ehrt man ihn in den USA mit dem „Chandler-Fulbright Award“ als „Nachwuchsautoren des Jahres“. Rankin gewinnt im Jahre 2000 weiter an Popularität, als die britische BBC beginnt, die Rebus-Romane zu verfilmen.
Ian Rankins [Website]http://www.ianrankin.net ist höchst empfehlenswert; über die bloße Auflistung seiner Werke verwöhnt sie u. a. mit einem virtuellen Gang durch das Edinburgh des John Rebus.
Die John-Rebus-Romane …
… erscheinen in Deutschland im Wilhelm Goldmann Verlag (Stand: Januar 2006):
01. [Verborgene Muster 956 (1987, Knots & Crosses) – TB-Nr. 44607
02. [Das zweite Zeichen 1442 (1991, Hide & Seek) – TB-Nr. 44608
03. [Wolfsmale 1943 (1992, Wolfman/Tooth and Nail) – TB-Nr. 44609
04. [Ehrensache 1894 (1992, Strip Jack) – TB-Nr. 45014
05. Verschlüsselte Wahrheit (1993, The Black Book) – TB Nr. 45015
06. Blutschuld (1994, Mortal Causes) – TB Nr. 45016
07. [Ein eisiger Tod 575 (1995, Let it Bleed) – TB Nr. 45428
08. [Das Souvenir des Mörders 1526 (1997, Black & Blue)
09. Die Sünden der Väter (1998, The Hanging Garden) – TB Nr. 45429
10. Die Seelen der Toten (1999; Dead Souls) – TB Nr. Nr. 44610, erscheint im Mai 2006
11. Der kalte Hauch der Nacht (2000, Set in Darkness) – TB Nr. 45387
12. [Puppenspiel 2153 (2001, The Falls) – TB Nr. 45636
13. [Die Tore der Finsternis 1450 (2002, Resurrection Man)
14. Die Kinder des Todes (2003, A Question of Blood)
15. [So soll er sterben 1919 (2004, Fleshmarket Close)
16. Night Police [Arbeitstitel] (2006; noch kein dt. Titel)
Darüber hinaus gibt es zwei Sammlungen mit Rebus-Kurzgeschichten: „A Good Hanging & Other Stories“ sowie „Beggars Banquet“. Hinzu kommt „Rebus’s Scotland“, ein Fotoband mit Texten von Rankin, der hier jene Orte aufsucht, die ihn zu seinen Romanen inspirierten.
James Ellroy – Ein amerikanischer Albtraum [Underworld U.S.A. 2]

James Ellroy – Ein amerikanischer Albtraum [Underworld U.S.A. 2] weiterlesen
Gay Longworth – Haut und Knochen
Detective Inspector Jessie Driver steckt in der Krise: Ihr alter Chef und Mentor wurde pensioniert, mit seiner Nachfolgerin zerstreitet sie sich schon am ersten Arbeitstag. Kollegen kritisieren oder mobben sie. Privat leidet Jessie unter ihrer schwierigen Beziehung zu einem flatterhaften Rocksänger.
Auch der aktuelle Kriminalfall sorgt für Ärger. Die Tochter einer publicitysüchtigen Schauspielerin ist verschwunden. Die Ermittlungen führen u. a. in die Marshall Street Baths, eine alte, längst geschlossene Schwimmhalle, in deren Ruine sich nun Junkies herumdrücken. Die Verschwundene findet sich dort nicht. Dafür entdeckt man in der Aschegrube eines uralten Heizungskessels die vollständig mumifizierte Leiche eines Mannes. Man hat ihn gefesselt in die Grube gestoßen, dort von Ratten anfressen und schließlich ertrinken lassen; ein Mord, dessen Brutalität von Rache kündet.
Jessies Nachforschungen gestalten sich schwierig, doch schließlich wird das Opfer identifiziert – als Krimineller, der vor 14 Jahren spurlos verschwand, nachdem er einer Verurteilung als Kidnapper im letzten Moment hatte entkommen können. Entführt hatte der Mann Nancy Scott-Somers, Tochter einer prominenten und einflussreichen Familie, die sehr auf ihr Privatleben bedacht ist und keinesfalls dulden will, dass Jessie die alte Sache wieder aufleben lässt. Die Scott-Somers üben über Anwälte, hohe Beamte und Jessies Vorgesetzte Druck auf die Polizistin aus, die sich indes nicht abschrecken lässt, zumal sie auf ein sorgsam gehütetes Familiengeheimnis stößt, das die Scott-Somers als Dulder oder sogar Auftraggeber des besagten Rachemordes in Verdacht bringt. Bald wird es eng für Jessie, die immer wieder in die Marshall Street Baths zurückkehren muss, wo mehr als ein Geist umgeht, der Vergeltung fordert und diese mit Gewalt einfordert …
Geist/er des Verbrechens
Würde diese Geschichte in Edinburgh spielen, hätte wahrscheinlich Ian Rankin sie erfunden: Ein vertracktes Rätsel wurzelt in einer Vergangenheit, die längst nicht so tot ist wie die Leichen, die sie produziert hat. In diesem Fall scheinen sie buchstäblich durch die gekachelten Hallen des alten Schwimmbads zu geistern; sogar ein leibhaftiger Exorzist erläutert der ermittelnden Polizistin, wie das Spuken funktioniert.
„Die unruhigen Toten“ lautet der Originaltitel, der wie üblich dem Inhalt gerechter wird als die deutsche ‚Übersetzung‘. (Gay Longworth soll offenbar ins Fahrwasser der gern gekauften Seziersaal-Thriller gelotst werden; mit entsprechenden Wortspielen wird plump vor allem eine angebliche Nähe zur erfolgreichen ‚Kollegin‘ Kathy Reichs suggeriert.) Unruhig sind sie, weil sie ihre Angelegenheiten im Leben nicht regeln konnten oder ihre Angehörigen sie nicht ruhen lassen. Das Ergebnis ist eine ungute Mischung beider Sphären, wobei sich in den Marshall Street Baths ein regelrechter Schnittpunkt zwischen der diesseitigen Welt und dem Jenseits gebildet hat.
Die behutsame Annäherung eines ansonsten lupenreinen Polizeithrillers der britisch soliden Art an einen Schauerroman stört erfreulicherweise selbst den Puristen nicht; auch hier haben Longworth-Vorgänger von John Dickson Carr bis Ian Rankin Maßstäbe gesetzt. Ob es nun wirklich spukt, oder ob es die Zwangsvorstellungen verstörter Hirne sind, welche sich manifestieren, darf jede/r Leser/in selbst entscheiden. Longworth selbst wird jedenfalls nie müde zu beschreiben, dass jedes Kapitalverbrechen über die Folgen körperlicher Gewalt hinaus auch die Psyche nachhaltig beschädigt.
Die Spannung als glitschige Beute
Der eigentliche Krimiplot ist stabil und wird logisch durchgespielt, ist aber alles andere als originell. Wenn man sehr kritisch urteilen möchte, ist das „Spannungshighlight von einer ‚wahren Meisterin des Thrillers‘“ (Werbedonner auf der Umschlagrückseite) ein Patchwork-Krimi im Polizeimilieu, der mit kriminalistischen Sackgassen und Überraschungen (sowie weiteren Leichen) nicht geizt, also mit den Versatzstücken des Genres jongliert.
Freilich rutschen sie der Verfasserin im Finale aus den Händen: Die Auflösung des Plots kann nur als missglückt bezeichnet werden und lässt die bisher durchaus angetanen Leser verärgert zurück. Dazu lässt sich Longworth von der modernen Unsitte des Doppel- oder gar Dreifach-Finales verleiten, viel zu viel literarisches Pulver zu verschießen. Das Ergebnis ist keine Steigerung von Höhepunkten, sondern ein gegenseitiges Außerkraftsetzen.
Abgeschmeckt wird die Handlung mit viel Herzschmerz (s. u.) und selbstverständlich Sozialkritik. Von ersterem gibt es zu viel, letztere wird nicht annähernd so überzeugend vermittelt wie vom bereits mehrfach genannten Ian Rankin. So ist es in erster Linie das handwerkliche Können der Autorin, welches die Leser fesselt. Dazu kommen echte Highlights wie die Szenen in den verrottenden Marshall Street Baths (die es übrigens tatsächlich gibt, wie die Verfasserin im Nachwort anmerkt). Hier kommt echte Schauerstimmung auf, die zusammen mit einem eigenartigen Faible der Autorin für skurrile und splatterige Einschübe für eine angenehme Abwechslung sorgt, wenn zwischendurch wieder etwas zu viele Hände gerungen und Herzen gebrochen werden.
Ellenbogen und Kniekehlen-Schläge
Jessie Driver: eine moderne Frau in einer Männerwelt. Das bedingt jene Mischung aus Krimi und Seifenoper, ohne die heute kein Kriminalroman mehr auszukommen glaubt. Positiv ist in diesem Zusammenhang die Schilderung des Polizeialltags. In ihrem Revier findet Jessie wenig Solidarität. Das schließt ihre männlichen Kollegen ebenso ein wie die weiblichen. Die einen bilden auch im 21. Jahrhundert eine verschworene Gemeinschaft chauvinistisch gestimmter Kerle, die wenig oder gar nichts von Frauen als Gesetzeshüter halten und das heimlich oder offen mit sexistischen ‚Scherzen‘, übler Nachrede oder offenes Mobbing demonstrieren. Da spielt viel Furcht vor der weiblichen ‚Konkurrenz‘ mit, die sich nicht an den ungeschriebenen „For-the-Boys“-Kodex hält, mit dem die Männer seit jeher ihren Dienstalltag regeln und Karriereplanung betreiben.
Paradoxerweise halten sich auch Frauen an dessen Spielregeln. DCI Moore hat es weit gebracht in der Polizeiwelt. Trotzdem ist sie unsicher und stößt Jessie lieber vor den Kopf, als ihr, der Untergebenen, im unfairen Kampf mit den intriganten Kollegen beizustehen. Die daraus erwachsenden Spannungen werden realistisch geschildert und tragen zur Atmosphäre dieses Krimis bei, obwohl sie nur mittelbar mit dem Mordfall zu tun haben. Longworth orientiert sich hier an Vorbildern wie Nigel McCrery mit seiner „Silent Witness“-Reihe um die Gerichtsmedizinerin Samantha Ryan sowie besonders Lynda LaPlante mit ihrer „Prime Suspect“-Serie (dt. „Heißer Verdacht“) um die im kollegialen Dauerstress stehende Jane Tennison.
Das Leben – ein Trauerspiel
Hätte es die Verfasserin bloß dabei belassen! Doch eine taffe weibliche Polizistin benötigt offenbar unbedingt ein publikumsattraktives Privatleben – ein möglichst desolates selbstverständlich. Also gibt es Longworth der armen Jessie knüppeldick: Ihr Lover ist ein nur bedingt treuer Rockstar, der außerdem unter Mordverdacht stand (vgl. „Dead Alone“, dt. „Bleiche Knochen“); die Mutter starb, ohne der seither offensiv trauernden Tochter die Gelegenheit zu einer letzten Aussprache gewährt zu haben; Jessie hadert deshalb mit Gott, der so eine Schweinerei zuließ; der sonst fast aufdringlich patente Bruder Bill lässt sich mit einer schmierigen Sensationsreporterin ein, die prompt Jessies schmutzige Privatwäsche an die Öffentlichkeit zerrt … Nein, es sind ein paar Nackenschläge zuviel, die der Heldin hier verabreicht werden. Sie sorgen für unnötige Längen in der Handlung und fallen in ihrer übertriebenen Dramatik eher lächerlich aus.
Hart an der Grenze zur Karikatur stehen die Scott-Somers, eine dieser schrecklich netten High-Society-Familien, die hinter einer einst glanzvollen Fassade (wie die Marshall Street Baths) völlig verrottet sind und ein Pandämonium finsterer Übeltäter und Psychopathen verbergen. Man belügt und betrügt einander, wobei das reichlich vorhandene Geld hilft, diese Exzesse bis ins Absurde zu steigern. Daneben gibt es noch eine hysterisch alternde Schauspielerin, ihre rollige Tochter, einen psychisch maroden Hausmeister sowie einen kannibalischen Witwer.
Noch gibt es also eine Menge zu feilen, lädt Gay Longworth ihrer Handlung zu viel Ballast auf. Potenzial hat die Jessie-Driver-Reihe zweifellos – und sei es nur deshalb, weil Longworth so geschickt zu liefern versteht, was die Mehrheit der Krimileser/innen wünscht: einen maßvoll unkonventionellen Thriller, der es angenehm gruseln lässt aber weder irritiert noch an Seelensaiten rührt, die man nicht unbedingt zur feierabendlichen Lesestunde in Aufruhr gebracht sehen möchte.
Autorin
Bisher ist über Gay Longworth (geb. 1970) nicht allzu viel bekannt – ein sicheres Indiz dafür, dass sie auf dem Krimimarkt noch nicht etabliert ist. Die üblichen Stützpfeiler einer möglichst werberelevanten Biografie sind bereits gesetzt. Da ist zum einen der lebenslange, intensive Wunsch zu schreiben, verknüpft mit dem langen, schwierigen Weg dorthin, auf dem es einige möglichst seltsame Jobs hinter sich zu bringen galt. In Longworthes Fall war dies u. a. ein Intermezzo in der Ölbranche, gefolgt von einem Einsatz als Animateurin in einem Club Med. 1997 erschien mit „Bimba“ ein erster Roman, dem bis heute drei weitere folgten. Seit 2004 hat Longworth keine Bücher mehr veröffentlicht.
Taschenbuch: 461 Seiten
Originaltitel: The Unquiet Dead (London: HarperCollins 2004)
Übersetzung: Karl-Heinz Ebnet
http://www.droemer-knaur.de
Der Autor vergibt: 



Ric Burns/James Sanders/Lisa Ades – New York. Die illustrierte Geschichte von 1609 bis heute
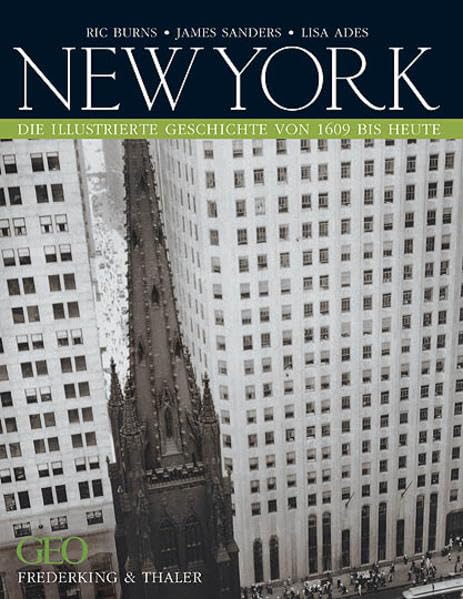
Es begann als zwölfstündige TV-Dokumentarfilmserie („New York. A Documentary Film“), die Ric Burns, Lisa Ades und der Architekt James Sanders 1999 realisierten. Jahre der vorbereitenden Planung waren dafür erforderlich, Schätze in Form bisher in dieser Breite nie ausgewerteter Archivalien wurden gehoben, gesichtet und präsentiert. Die Fülle des Stoffes schrie förmlich nach einem Begleitband, der New York auch nach der Ausstrahlung der Serie greifbar bleiben ließ.
Die Autoren stellten nicht einfach das Vorhandene zusammen, sondern erfanden das Rad quasi neu. Gemeinsam mit einem Stab kompetenter Berater, Wissenschaftler und Redakteure realisierten sie ein Buch, das sich zwar inhaltlich an der Fernsehvorlage orientiert, jedoch völlig unabhängig davon bestehen kann sowie Maßstäbe setzt: als „Buch zum Film“ und historische Darstellung gleichzeitig. Ric Burns/James Sanders/Lisa Ades – New York. Die illustrierte Geschichte von 1609 bis heute weiterlesen
Deaver, Jeffery – Tod eines Pornostars
Am Time Square in New York detoniert in einem heruntergekommenen Pornokino eine Bombe. Das „Schwert Jesu“, eine Gruppe religiöser Fanatiker, bekennt sich zu dem Anschlag. Zufällig am Ort des Geschehens ist die junge Nancy Drew, genannt Rune. Als schlecht bezahlte und nicht ernst genommene Produktionsassistentin und Mädchen für alles verfolgt sie mühsam ihren Traum von einer eigenen Karriere als Regisseurin von Dokumentarfilmen. Das Attentat gibt ihr eine Idee ein: Rune will einen Blick auf die moderne Sexindustrie werfen.
Die Pornoqueen Shelly Lowe ist durchaus angetan von diesem Projekt. Seit jeher sieht sie sich als ernsthafte Schauspielerin, die sogar Theaterstücke schreibt. Da Shelly in der Tat einen Kopf auf den Schultern trägt, weiß sie viel zu erzählen über die düsteren Abgründe einer Menschen verachtenden Szene – zu viel offensichtlich, denn eine zweite Bombe bringt sie kurz darauf zum Schweigen.
Rune hätte es beinahe ebenfalls erwischt. Sie macht die Bekanntschaft des Bombenexperten Alex Healey, der schnell auch privat Gefallen an ihr findet. Allerdings wird die aufblühende Beziehung auf harte Belastungsproben gestellt. Rune betätigt sich für ihren Film als Privatermittlerin, benimmt sich dabei wie eine Elefantin im Porzellanladen und bringt sich überdies in Lebensgefahr: Hinter den Anschlägen stecken keine wirrköpfigen Tugendbolde, sondern kühl kalkulierende, verbrecherische Geschäftsleute, denen es ausschließlich um Geld geht. Eine neugierige Schnüfflerin schätzen sie überhaupt nicht. Während weitere Bomben explodieren, setzt sich ein Killer auf Runes Spur. Sie kann ihm entwischen, aber ihre Glückssträhne wird nicht ewig halten …
Ein früher, in Deutschland bisher nicht veröffentlichter Thriller von Jeffery Deaver: Das weckt Erwartungen, ist doch dieser Schriftsteller hierzulande mit seinen Romanen um den querschnittsgelähmten Meisterdetektiv Lincoln Rhyme und seine Assistentin Amanda Sachs ein großer Wurf gelungen. Auch „Tod eines Pornostars“ gehört zu einer Serie, besser gesagt zu einer Trilogie um die junge Punkfrau Rune. Besonders erfolgreich scheint sie nicht gewesen zu sein, sonst hätte sie Autor Deaver nicht abgebrochen. Erst sein derzeitiger Ruhm lässt auch Rune wieder auftauchen.
Was wir hier lesen, würde ohne das Gütesiegel „Deaver“ in der Tat nur mäßiges Aufsehen erregen. Das liegt zum einen daran, dass „Tod eines Pornostars“ in einer versunkenen Epoche spielt. Erstaunlich, in welche geistige Entfernung 1990 bereits gerutscht ist. Rune zieht mit einer bleischweren Videokamera durch die Straßen, vor allem ist das Handy als Massenartikel noch unbekannt. Dies bedingt einige auf Telefonmangel basierende Spannungsszenen, die so heute einfach nicht mehr funktionieren.
Zum „period piece“ – zum „historischen“ Kriminalroman – reicht es freilich nicht. Philip Marlowe ohne Handy und Notebook – das irritiert uns kaum. Doch Runes New York ist noch nicht „exotisch“ genug gealtert. Dazu kommt der mäßig spannende Plot. Ein Bombenleger sät Angst und Schrecken, während ihm ein wortkarger Polizist und eine flippige Amateurdetektivin auf die Spur kommen. Die Konstellation ist bekannt, viel weiß Deaver nicht daraus zu machen. Schlimmer noch: Wiederum bekommt er seinen Hang zu Doppel- und Dreifach-Final-Überraschungen nicht in den Griff. Der übliche irre Bomber wird gefasst, aber er ist gar nicht der einzige Schuldige. Aus Hut Nr. 2 springen nun tatsächlich die ad acta gelegten irren Fundamentalisten. Und als das abgehakt ist, taucht aus der Versenkung noch eine ganz besondere Bekannte auf. Nein, in dieser Häufung wirkt das einfach nur aufdringlich.
Dann ist da der Hintergrund des cineastischen Rotlicht-Milieus. Deaver versucht den Spagat zwischen politisch korrekter moralischer Entrüstung und vorsichtiger Toleranz: Porno verdammt er nicht grundsätzlich, aber trotzdem gibt es nur Täter oder Opfer. Die Materie ist zweifellos komplex und objektiv schwierig zu thematisieren, doch Deaver verharrt etwas zu deutlich auf der Ebene des ebenso faszinierten wie angewiderten Beobachters.
Für einen männlichen Schriftsteller bedeutet es zweifellos eine Herausforderung, eine weibliche Hauptfigur zu schaffen. Andererseits geht er damit ein Risiko ein, zumal ein guter Teil der Schaffenskraft in den Versuch fließt, eine möglichst überzeugende Heldin zu kreieren. Deaver hat sich Mühe gegeben, doch Rune will trotzdem nur bedingt Gestalt annehmen. Sie wurde außerdem von der Zeit überrollt und noch nicht wieder freigegeben: Ein „Punk“ von 1990 wirkt anderthalb Jahrzehnte später lächerlich. Weitere zehn Jahre später mag sich das im Zuge eines Revivals ändern.
Sprengstoffexperte Healey wirkt wie Lincoln Rhyme, als der noch laufen konnte. Als Cowboy in der Wildnis von New York stilisiert ihn Deaver – auch so ein Klischee, das nicht mehr richtig funktioniert. Wesentlich mehr Glück hat der Verfasser mit den Nebenfiguren. Sobald die Handlung im maroden Studio von Runes chaotischen Chefs spielt, kommt sogar echter Humor auf. Der ist auch bitter nötig, denn im bösen Sexfilm-Studio finden wir nur rücksichtslose Ausbeuter hinter und Koks schniefende, vom Schicksal gebeutelte Sklaven vor der Kamera.
Ganz und gar nicht gelungen sind fatalerweise die zahlreichen Schurken dieses Krimispiels. Deaver setzt sie aus dem Baukasten für verrückte Serienmörder und religiöse Spinner zusammen. Immerhin wirken sie weder genial noch charismatisch, was mit der Realität übereinstimmt, was der Verfasser in diesem Fall sehr wahrscheinlich unfreiwillig geschafft hat.
Fazit: Eine mäßig spannende Ausgrabung, die sogar für den Deaver-Fan höchstens ein Kann aber ganz sicher kein Muss darstellt.
Anthony O’Neill – Der Hüter der Finsternis
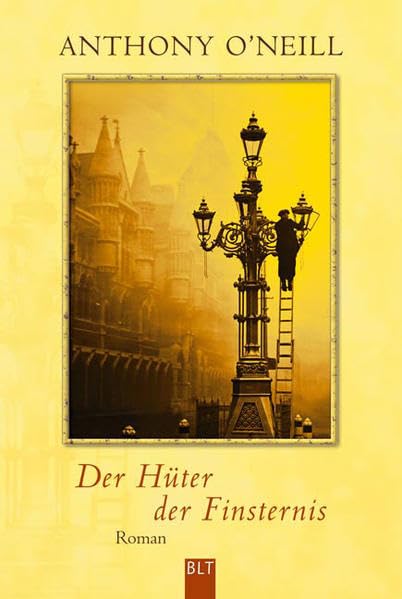
Anthony O’Neill – Der Hüter der Finsternis weiterlesen
Laurie R. King – Die Insel der flüsternden Stimmen
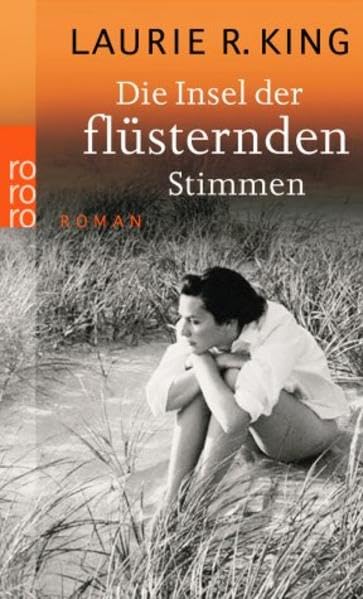
Laurie R. King – Die Insel der flüsternden Stimmen weiterlesen
Aaron Elkins – Yahi. Wald der Toten [Gideon Oliver 2]

Nancy Kilpatrick – Todessehnsucht

Nancy Kilpatrick – Todessehnsucht weiterlesen
Jack Ketchum – Evil
1958 ist die Welt der US-amerikanischen Mittelschicht noch in Ordnung. Man fürchtet nur die Roten drüben in Russland und lässt die Haustür offen, denn den Nachbarn vertraut man, und ein guter Bürger und Kirchgänger hat nichts zu verbergen. Kinder sind rechtlose Wesen und haben nicht nur den Eltern, sondern allen Erwachsenen zu gehorchen. Wenn sie sich einfügen, haben sie in dem kleinen Städtchen, in dem diese Geschichte spielt, ein angenehmes Leben, denn es gibt viele Freunde und natürliche Abenteuerspielplätze an der frischen Luft.
In diesem Sommer erfährt zwölfjährige David, dass ins Nachbarhaus zwei neue Bewohnerinnen eingezogen sind. Die Schwestern Meghan und Susan Loughlin haben ihre Eltern verloren. Sie ziehen zu Ruth Chandler, ihrer Tante, die selbst drei Kinder versorgen muss: eine schwere Aufgabe, nachdem sie ihr Mann verlassen hat. Die Kinder der Straße schätzen sie jedoch, denn sie hat immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen. Jack Ketchum – Evil weiterlesen
Ian Rankin – Puppenspiel

Ian Rankin – Puppenspiel weiterlesen