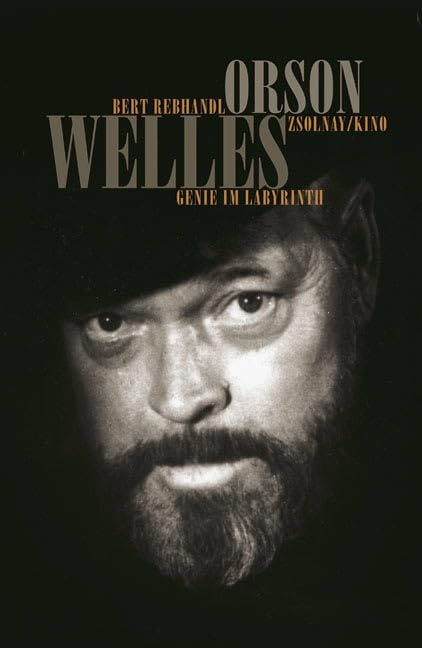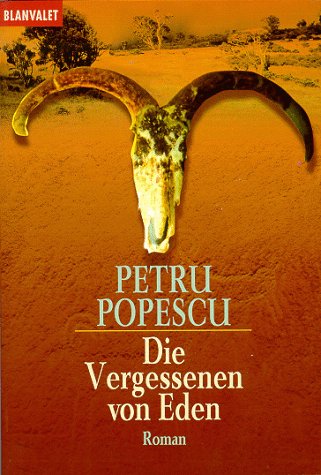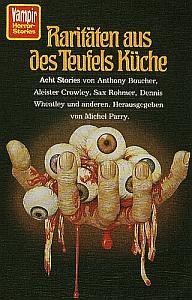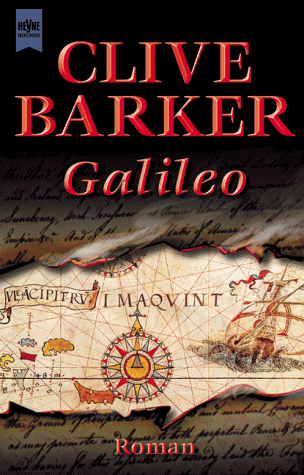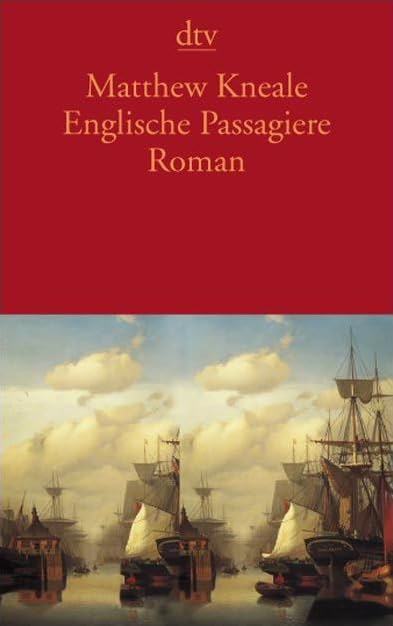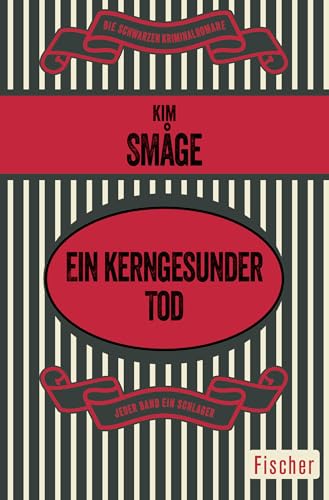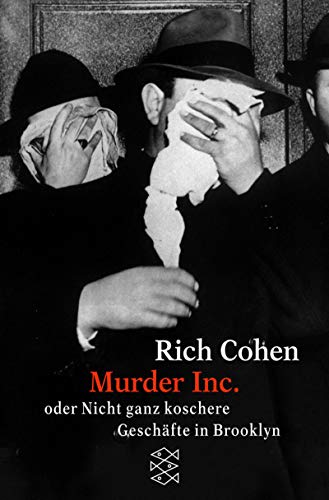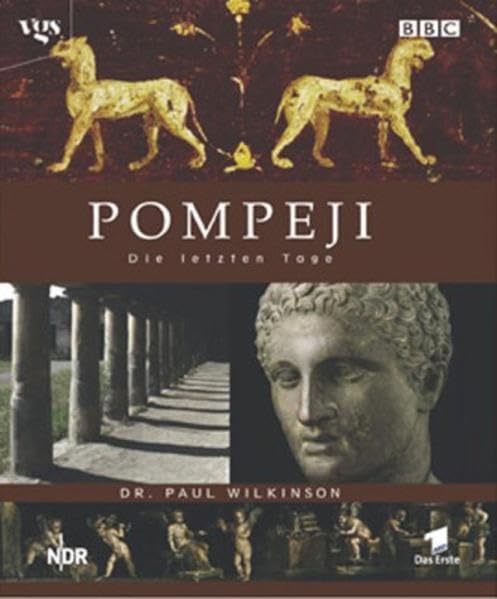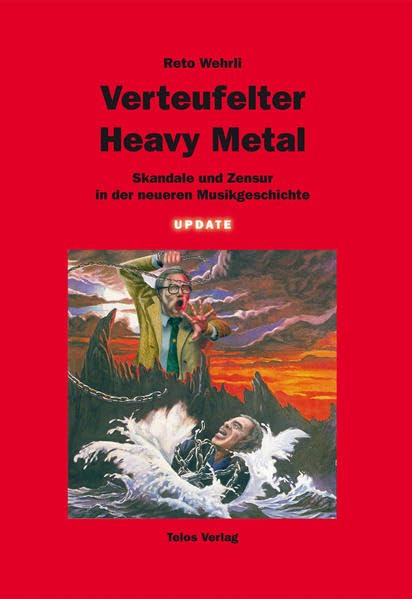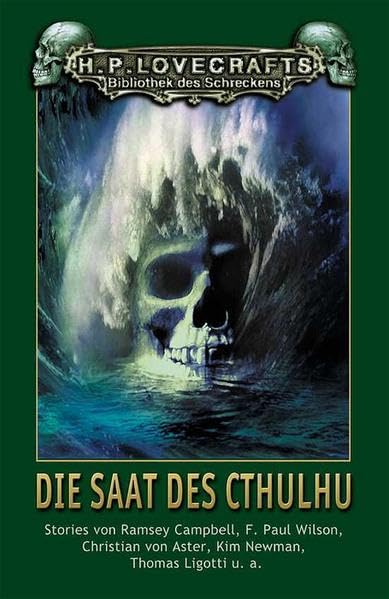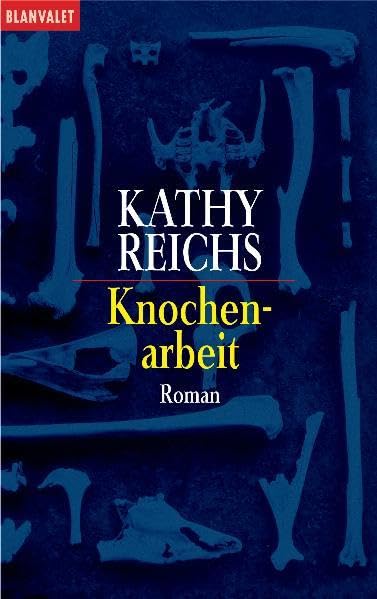Mit nur einem Jubiläum wäre man dem Radio-, Theater-, Kino-, Fernseh- und Zirkusmenschen Orson Welles wahrscheinlich nicht gerecht geworden. Also bejubelt bzw. betrauert man ihn 2005 doppelt: Am 6. Mai wäre er 90 Jahre alt geworden, am 9. Oktober jährt sich sein Todestag zum zwanzigsten Mal. Jetzt, wo er tot ist und nicht mehr stört, kann man ihn weltweit als Ausnahmetalent abfeiern. Das war er tatsächlich, obwohl das Genie mit seinem Spieltrieb niemals mithalten konnte und von inneren Konflikten stärker als lange deutlich wurde geprägt war. Orson Welles versuchte viel, es gelang ihm wenig – das Ergebnis ist ein Leben voller Experimente und Brüche, das sich je nach Veranlagung des Kritikers als reich & bunt oder tragisch interpretieren lässt.
Bert Rebhandl geht mit „Orson Welles. Leben im Labyrinth“ zwangsläufig den zweiten Weg. Er konzentriert sich auf die Widersprüche, die Welles’ Leben und Werk prägen, wobei er vor allem die Querverbindungen zwischen beiden Welten aufdeckt: Der öffentliche und der private Orson Welles sind Geschöpfe, die eine immer stärkere Personalunion eingehen, bis man sie schließlich nicht mehr unterscheiden kann. Welles selbst hat das ebenfalls nicht mehr geschafft – nach Rebhandl eine weitere Quelle seiner nur bedingt geglückten bzw. glücklichen Selbstmystifizierung.
Nach mehr als einem Vierteljahrhundert Welles-Literatur ist es schwer, zwischen Wahrheit, Mythos und Kritikerinterpretation zu unterscheiden. Rebhandl bezeichnet sein Werk ausdrücklich nicht als Forschungsarbeit. Er stützt sich auf Material, das zugänglich ist: Welles’ Kino- und Fernsehfilme, seine Texte, seine berühmten Fragmente und Seltsamkeiten, die er im ungebrochenen Schaffensrausch seiner isolierten späten Jahren zustande brachte.
Biografische Entdeckungen schließt Rebhandl aus. Sie lassen sich aus Welles’ Werk nur bedingt erschließen und werden daher nur dort explizit ins Spiel gebracht, wo sie für die Kunst eine unmittelbare Rolle spielen. Seine Darstellung dieser Kunst gliedert der Verfasser in drei Linien:
– eine kulturkritische, die am Beispiel von Orson Welles der Frage nachgeht, wie oder ob sich künstlerische Subjektivität in einer kunsthandwerklichen Industrie behaupten kann;
– eine medienhistorische, die Welles folgt, der eine Spur durch praktisch sämtliche mediale Ausdrucksformen des 20. Jahrhunderts zog;
– eine autobiografische, welche die Werke und persönlichen Äußerungen Welles’ nutzt, um seine multiple Persönlichkeit zu erkennen und zu entschlüsseln.
Rebhandl kommt zu dem Ergebnis, dass diese drei Linien niemals ein exaktes Gesamtbild des Menschen Orson Welles ergeben können; dazu hat dieser zu erfolgreich an seinem eigenen Welles-Bild gearbeitet. Auch Rebhandl interpretiert, wobei er mögliche Missverständnisse oder Fehler (besonders in den biografischen Passagen) keineswegs ausschließt.
Damit steht er nicht allein, obwohl viele seiner Vorgänger es nicht zugeben mochten. Orson Welles (1915-1985), die „Erste Person Singular“, der große Medien-Magier, der an seiner Maßlosigkeit und am Unverständnis einer Welt, die seine Grandiositäten nicht finanzieren wollte, langsam und kläglich zu Grunde ging: So etwa sieht das Welles-Bild aus, das gern gemalt wird. Die Vorlage lieferte der Meister selbst, der gleich mit mehreren Donnerschlägen seine Karriere startete (u. a. „Krieg der Welten“, 1938 – Welles lässt marsianische Invasoren in den USA landen und sorgt für eine landesweite Panik; „Citizen Kane“, 1941 – Welles schreibt, dreht und spielt den bzw. in einem der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte), um seinen Wunderkind-Status in den nächsten Jahren systematisch zu demontieren, ohne jemals Einsicht in die Tatsache zu zeigen, dass auch der bedeutendste Künstler das System nicht permanent vor den Kopf stoßen und erwarten kann, von ihm getragen und gefördert zu werden. Welles hat genau dies sein Leben lang gefordert, den Bogen überspannt und ist dennoch auf seinem einsamen Marsch gegen die Institutionen geblieben. Lange Zeit ist es ihm gelungen, das daraus resultierende Scheitern als Sieg des Individuums als Märtyrer der Kunst zu verbrämen.
Erst allmählich verschaffen sich Ketzer Laut, die a) das Scheitern eines Künstlers nicht automatisch mit dem Scheitern eines großen Künstlers gleichsetzen, b) künstlerische Größe nicht primär an den Schwierigkeiten messen, denen ein Künstler sich in der bösen Banausenwelt ausgesetzt sieht, und c) Welles, den Breitband-Künstler, und sein Werk unter die Lupe nehmen und dabei entdecken, dass dieser oft auch nur mit Wasser kocht, um es salopp auszudrücken.
Dies ist kein Wühlen in biografischem Müll, sondern eine Entmystifizierung, die an der Bedeutung Orson Welles’ für die Kunst des 20. Jahrhunderts rein gar nicht rüttelt. Schließlich gibt es einen Welles nach „Citizen Kane“, dem u. a. Regie-Meisterwerke wie „Othello“ (1952), „Touch of Evil“ (1958) oder „Chimes at Midnight“ (1966) gelangen – ganz zu schweigen vom Schauspieler Welles, der zwar grausigen Zelluloidmist drehte, um eigene Projekte finanzieren zu können, aber immer wieder zu Glanzleistungen auflief, wenn man ihm eine angemessene Rolle bot („The Third Man“, 1949; „Moby Dick“, 1956 oder [„Catch-22“,]http://www.powermetal.de/video/anzeigen.php?id__video=335 1970; um nur drei von mehr als 100 Filmen nicht von aber mit Welles zu nennen).
Bücher über Genies – gerade über missverstandene – neigen zu einer gewissen Seitenfülle. Im Falle von Orson Welles, der sich gern als verhinderter Renaissancemensch sah, läge dies besonders nahe. Viele von Ehrfurcht gepackte Welles-Biografen und –Interpreten sind in diese Richtung gegangen. Bert Rebhandl verweigert sich dem. Er fasst zusammen und interpretiert neu, wofür ihm 192 Seiten reichen. Als Leser hat man nicht das Gefühl, dabei informativ zu kurz zu kommen.
Vor allem wirkt Rebhandls Buch nicht wie ein Schnellschuss zum Welles-Jubiläum, obwohl es natürlich von dem weltweiten Rummel – so stand u. a. im August 2005 eine Retrospektive von Welles-Werken auf dem Filmfestival von Locarno an – profitiert. Erstaunlicherweise liegt Welles’ filmischer Nachlass nicht irgendwo in den USA, wo ihm das Filmestablishment seine Eskapaden nie wirklich verzieh, sondern in Europa, das ihn wesentlich herzlicher empfing. (Finanziell auf dem Trockenen ließ man ihn freilich auch hier sitzen.) In München bemüht man sich – ebenso hilfsbereit wie argwöhnisch beobachtet von Welles’ letzter Lebensgefährtin Oja Kodar – seit 1995 um dieses Erbe, das Bert Rebhandl die Chance bot, manchen selten gesehenen oder gelesenen Film oder Text in seine Betrachtungen einfließen zu lassen.
Hier und da verfällt Rebhandl auf genau den Fehler, welchen er auch vielen Welles-Kritikern vorwirft: Er verbeißt sich um seiner Grundhypothese willen in Einzelheiten, die er förmlich zu Tode interpretiert, ohne dabei überzeugen zu können. Letztlich ist es „Rebhandls Welles“, der uns hier vorgestellt wird. Aber das hatte uns der Autor ja gesagt, also überspringen wir solche Passagen und werden rasch wieder mit angenehm formulierter Sachlichkeit belohnt, die uns die Lektüre zum informationsreichen Vergnügen werden lässt.