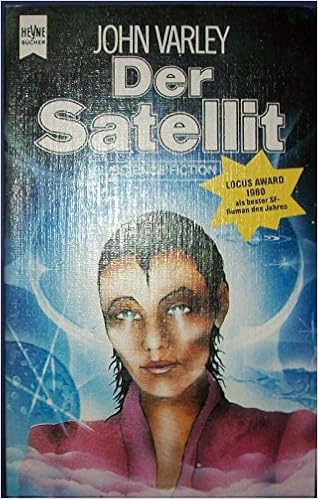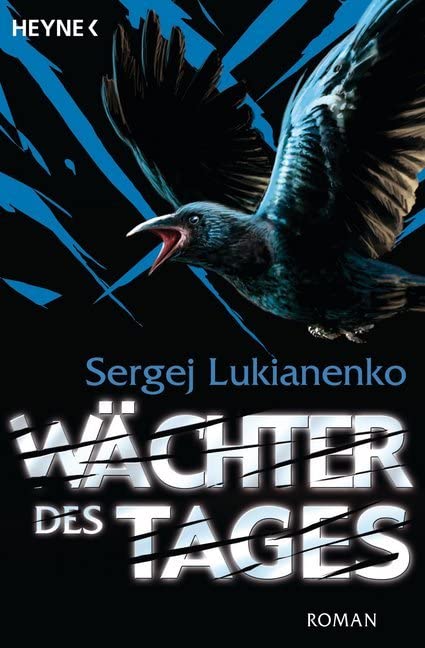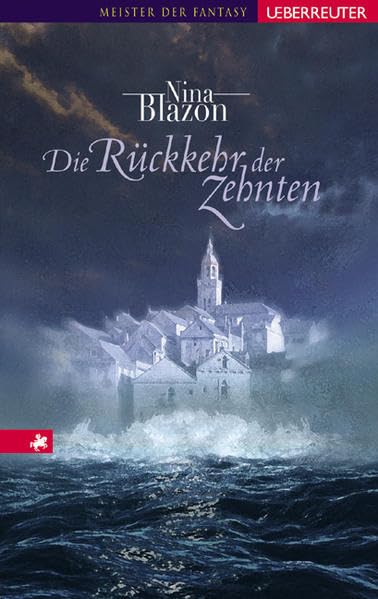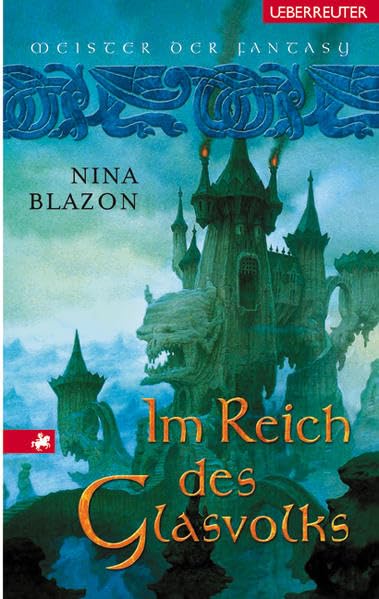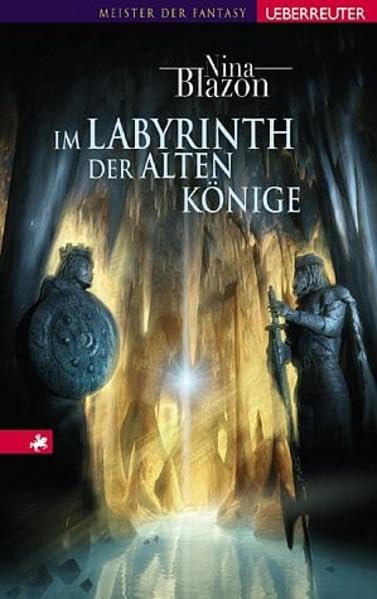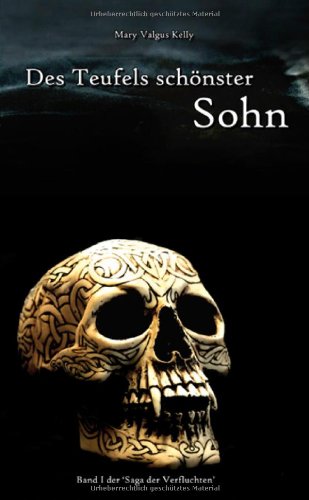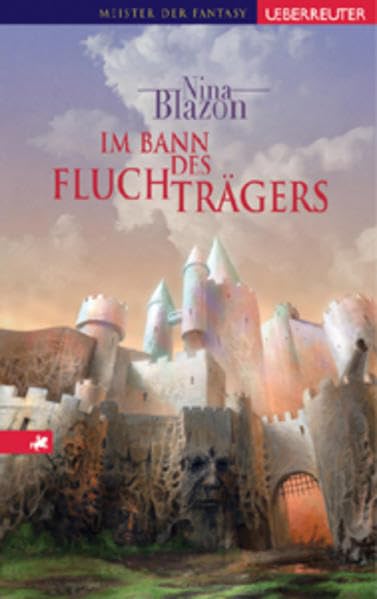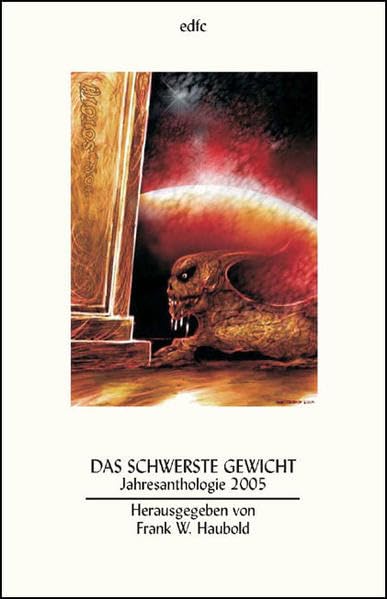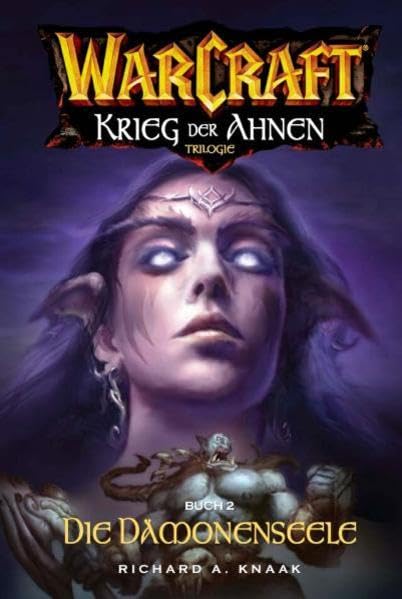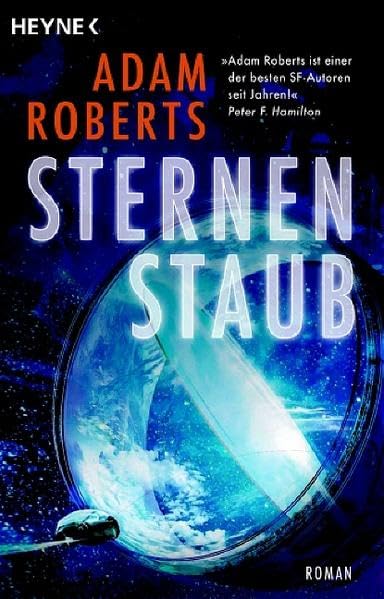Vernor Vinge (* 10. Oktober 1944) ist in Deutschland vor allem durch seine beiden jeweils mit dem |Hugo Award| ausgezeichneten Romane „Ein Feuer auf der Tiefe“ (1992) und [„Eine Tiefe am Himmel“ 364 (1999) bekannt. Sie wurden ebenfalls für den |Nebula Award| nominiert, „Eine Tiefe am Himmel“ wurde in Deutschland zusätzlich mit dem Kurd-Laßwitz-Preis prämiert.
Bis zum Jahr 2002 dozierte der Mathematiker und Computerwissenschaftler Vernor Vinge an der San Diego State University, seitdem konzentriert er sich ganz auf seine schriftstellerische Tätigkeit.
Sein neuester in Deutschland erschienener Band „Die Tiefen der Zeit“ ist jedoch trotz des ähnlich klingenden Titels keine Fortsetzung seiner beiden erfolgreichen Romane um die „Zonen des Bewusstseins“, sondern eine Sammlung von achtzehn Kurzgeschichten, die bis auf zwei Ausnahmen in „The Collected Stories of Vernor Vinge“ (Tor Books 2001) enthalten sind. Einige Kommentare wurden aktualisiert, zu „Das Cookie-Monster“ und „Wahre Namen“ wurden sie von Vernor Vinge eigens für die deutsche Ausgabe verfasst und von Erik Simon, der vorliegende ältere Übersetzungen überarbeitet hat, ebenso wie das Vorwort übersetzt.
Die Erzählungen sind thematisch sortiert. Beginnend mit „Bücherwurm, lauf!“, der ältesten Erzählung Vinges aus dem Jahr 1966, zeigt Vinge die Veränderungen, die neue Technologien für die menschliche Gesellschaft bedeuten. Ansätze der Thematik Verschmelzung von Mensch und Maschine im Lauf seiner Evolution sind ebenfalls zu erkennen.
Zahlreiche weitere Erzählungen handeln von postapokalyptischen Szenarien, in denen die gesamte Nordhalbkugel der Erde oder die ganze Menschheit vernichtet wurden. Verschiedene Formen postatomarer Gesellschaften werden vorgestellt, einige davon unter den Einfluss von Aliens.
Drei Erzählungen sind mit nur fünf beziehungsweise sechzehn und sechsundzwanzig Seiten sehr kurz geraten, qualitativ sind diese drei leider auch nicht besser: Insbesondere die titelgebende Erzählung „Tiefen der Zeit“ gehört zu den schwächsten dieser Sammlung. Die für den Hugo-Award nominierte „Barbarenprinzessin“ ist unverständlicherweise als einzige Erzählungen des aus drei Kurzgeschichten bestehenden Romans „Grimms World“ in diesem Sammelband enthalten und konnte mich leider ebenfalls nicht überzeugen.
Davon abgesehen bietet der Sammelband höchst interessante und hochwertig übersetzte Kost; die Nachbearbeitung von Erik Simon zahlte sich hier aus. Interessanterweise fielen mir nur bei der von ihm selbst übersetzten „Barbarenprinzessin“ einige wenige Setzfehler auf.
Auffallend ist der starke amerikanische Einschlag der meisten Geschichten, was vielleicht darin begründet ist, dass sie größtenteils im |Analog Science Fiction and Fact|-Magazin erstveröffentlicht wurden. Einige Thematiken sind heute nicht mehr aktuell, wie russisch-amerikanische Konflikte der Zeit des Kalten Krieges, oder die auf die Apartheid-Problematik abzielende Geschichte „Absonderung“.
Bemerkenswert ist die sprunghafte Qualität der Erzählungen. Vinge ist nicht kontinuierlich besser geworden; eine der besten Erzählungen dieser Sammlung, „Kampflose Eroberung“, stammt bereits aus dem Jahr 1968 und stellt viele der später veröffentlichten Geschichten inhaltlich und schriftstellerisch in den Schatten. Vinge war stets eher ein Ideenschriftsteller denn ein Talent in der Darstellung von Charakteren; in dieser Geschichte sowie in der mit William Rupp geschriebenen Erzählung „Gerechter Frieden“ zeigt er jedoch, dass er auch dies beherrscht. Etwas knöchern und technokratisch wirken dagegen einige der frühen Geschichten in diesem Roman, was leider auch in späteren Storys immer wieder passiert.
Interessanterweise schrieb Vernor Vinge gerade seine visionärsten Ideen in seinen frühen Erzählungen nieder; seine späteren Werke beziehen sich sehr oft auf seine zu dieser Zeit bereits erschienenen Romanwelten und sind für Leser, die diese nicht kennen, schwer verständlich.
Empfehlen kann ich diesen Sammelband auch aus diesem Grund eher Vinge-Kennern denn Neueinsteigern. Etwas irritierend ist, dass dieses Buch auf der Rückseite nirgends als Sammelband gekennzeichnet wird. Dies könnte Leser in den Irrglauben versetzen, eine Fortsetzung seiner „Zonen des Bewusstseins“-Reihe zu kaufen. Mit den prämierten Romanen dieser Reihe kann dieser Sammelband nicht ganz gleichziehen.
Meine persönlichen Highlights stellten „Kampflose Eroberung“, „Wahre Namen“, „Weitschuss“, „Spiel mit dem Schrecken“, „Gerechter Frieden“ sowie „Die Plapperin“ dar.
_Einzelbesprechungen_
_Warnung:_ |Es ist möglich, dass einige Kommentare zu den Geschichten als „Spoiler“ angesehen werden könnten. Ich hab mich dennoch entschieden, nicht auf sie zu verzichten, denn stets erläutert Vinge bereits im jeder Geschichte vorangestellten Vorwort die grundlegenden Gedanken hinter der folgenden Story und fügt weitere im Nachwort hinzu. Ich habe mich hier bewusst noch etwas mehr zurückgehalten als Vinge selbst.|
_Bücherwurm, lauf! / Bookworm, Run!_ (1966, Erik Simon)
|Die USA haben die Sowjetunion weit überflügelt: Bender-Fusionselemente machen Kraftwerke überflüssig, was einen Wirtschaftskollaps zur Folge hatte, von dem man sich aber schnell erholt hat. Der Ostblock besitzt diese Technologie nicht und ist in Auflösung und Anarchie begriffen, ein Schatten seiner einstigen Größe.
Doch die technologischen Geheimnisse drohen verloren zu gehen: Der Schimpanse Norman wurde zu experimentellen Zwecken per Funk an einen Computer mit Zugriff auf eine riesige Datenbank angeschlossen, seine durch diese und den Computer gesteigerte Intelligenz wird zur Bedrohung, als er auch Zugriff auf streng geheime Daten erhält und aus dem Testgelände entkommt …
Der Affe zeigt sich gewitzt und kann seinen Verfolgern entkommen, nicht zuletzt dank seines Zugriffs auf spannende Spionage- und Science-Fiction-Romane, denen er viele Anregungen entnehmen kann. Als er sich sicher ist, dass man ihn töten wird, sobald man ihn gestellt hat, sucht er seine Rettung als Überläufer …|
Vinge geht den Bedenken nach, welche Macht ein solcherart vernetzter Mensch hätte. Die Bender-Fusionselemente und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft nehmen nur einen geringen Raum ein. Eine Fortsetzung mit einem „Über“-Menschen anstelle des Affen lehnte sein Lektor ab; Vinge selbst räumt ein, man würde sich einer Art Singularität (ein Lieblingsbegriff Vernor Vinges) nähern, an der Extrapolation nicht mehr ausreicht und man an die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft gelangt.
_Der Mitarbeiter / The Accomplice_ (1967, Franziska Zinn, überarbeitet von Erik Simon)
|Robert Royce, Chef von Royce Technologies, erfährt von seinem Sicherheitsingenieur, dass jemand unbefugt 70 Stunden Rechenzeit des Supercomputers 4D5 im Wert von rund vier Millionen Dollar unterschlagen hat.
Die Nachforschungen führen ihn zu einem seiner besten und exzentrischsten Mitarbeiter, Howard Prentice. Dieser hat eine neue, computergestützte Kunstform geschaffen und sich deshalb heimlich Rechenzeit abgezweigt.|
Diese Geschichte basiert auf der von Gordon Moore 1965 gemachten Beobachtung, dass gewisse Aspekte der Rechenleistung von Computern sich alle ein, zwei Jahre zu verdoppeln scheinen. Vinge hatte eine Vision, wie man mithilfe eines Scanners (in dieser Geschichte noch „Bildlesegerät“ genannt) und eines leistungsstarken Computers aus gezeichneten Bildern einen Animationsfilm generieren könnte. Auch wenn ihm selbst einige seiner Annahmen und aus heutiger Sicht seltsam erscheinenden Technologien peinlich sind – beweisen die Pixar-Studios sowie ILM nicht, dass Computer durchaus einen Film nachbearbeiten oder erschaffen können? Vinges Ideen, Bilder einzuscannen und den Computer dazu passende Animationen errechnen zu lassen, sind zwar krude, völlig falsch lag er mit dieser Einschätzung jedoch nicht. Ebenso mit der Idee, dass Rechenzeit in der Zukunft dank erschwinglicher und leistungsstärkerer Rechner wesentlich günstiger bis kostenlos sein würde.
_Wahre Namen / True Names_ (1981, Hannes Riffel)
|Der „Dämon“ Mr. Slippery wird von den Behörden enttarnt: Man hat seine wahre Identität, seinen wahren Namen herausgefunden und kann ihn nun zur Mitarbeit erpressen. Denn Geheimbünde der so genannten „Dämonen“ – im Cyberspace dominante Persönlichkeiten, die das Netz virtuos beherrschen, sich oft derbe Späße erlauben oder von vorneherein kriminelle Absichten verfolgen – sind die Plage dieser Zeit.
Der geheimnisvolle „Postbote“ scheint politische Ambitionen zu verfolgen; man setzt den Insider Mr. Slippery als verdeckten Ermittler auf ihn an. Mr. Slippery findet zu seinem Erschrecken heraus, dass der Postbote scheinbar einige Mitglieder der Geheimbünde enttarnt, real ermordet und ihre virtuellen Persönlichkeiten übernommen hat. Das Geheimnis um den Postboten wird umso bedrohlicher und ungeheuerlicher, je näher sich Mr. Slippery an die Wahrheit heranpirscht.|
Eine Hackergeschichte à la Vinge. Seine virtuelle Welt ist eine Fantasywelt voller Magie, in der die Rote Hexe und Robin Hood sich ein Stelldichein mit DON.MAC und anderen Persönlichkeiten geben. Die Stärke dieser Avatare liegt in der Anonymität ihrer körperlichen Existenz; diese herauszufinden hat denselben Effekt wie die Kenntnis des wahren Namens eines Magiers im Märchen: Er wird angreifbar und man gewinnt Macht über ihn. Die Identität des Postboten zu ermitteln, erweist sich als schwierig und birgt einige Überraschungen für den Leser. Eine der besten und mit 104 Seiten auch die umfangreichste Geschichte dieser Sammlung.
_Der Lehrling des Fahrenden Händlers / The Peddler’s Apprentice_ (1975, Sylvia Pukallus)
|Graf Fürneham I. von Füffen hat ein Problem: Das Südreich und sein alter Rivale Hollerich Haifischzahn sehen ihn als Bedrohung an und ziehen vereint gegen ihn zu Feld. Fürneham sieht eine Chance in der Magie eines fahrenden Händlers Zagir. Dieser kommt aus dem fernen Sharn, seine Magie würde ihm den Sieg ermöglichen.|
Der Händler entpuppt sich als Zeitreisender aus der Zukunft, deren Waren und Technologie den mittelalterlichen Bewohnern wie ein Wunder erscheinen müssen. Doch diesmal ist der Händler zu früh angekommen: Er hätte eine höher entwickelte Zivilisation erwartet. Eine „Weltregierung“ hat in das Rad der Geschichte eingegriffen und hält die Zivilisation in kontrollierter Stasis. Bisher endeten alle Zivilisationen mit ihrer eigenen Vernichtung, dieses Mal ist es gelungen, den Kreislauf zu unterbrechen. Persönliche Aggressivität und technischer Forschungsgeist werden als Bedrohung angesehen und unterdrückt. Der Händler aus der Zukunft ist eine Bedrohung für dieses System.
Diese Geschichte enstand in Zusammenarbeit mit Vernor Vinges damaliger Frau Joan D. Vinge. Die Moral der Geschichte ist die Unentscheidbarkeit: Die erzwungene Stasis ist eine Bevormundung und Unterdrückung der freien Entscheidungsfähigkeit des Menschen. Nachdem der Händler den Menschen hilft, sich von diesem Joch zu befreien, muss man leider erleben, wie Graf Fürneham nach den Geheimnissen der Zukunft strebt und zum Krieg rüstet.
_Die Unregierten / The Ungoverned_ (1985, Erik Simon)
|Nach einem Atomkrieg sind die Vereinigten Staaten in zahllose kleine Nationen zersplittert. Große Teile der Bevölkerung werden von mafiaähnlichen „Sicherheitsdiensten“, die sich selbst zum Beispiel „Michigan State Police“ oder „Al’s Protection Racket“ nennen, kontrolliert und gegen andere Sicherheitsdienste verteidigt. Die geeinte neumexikanische Republik rüstet zur Eroberung dieser vermeintlich herrenlosen Gebiete und dringt mit massiven Panzer- und Luftstreitkräften in das Gebiet der Sicherheitsdienste ein. Doch in dem vermeintlich wehrlosen Land ist jeder einzelne Bewohner mit Waffen von beträchtlicher Zerstörungskraft ausgestattet …|
Vinge präsentiert seine Vision einer anarcho-kapitalistischen Gesellschaft mit ausgeprägt individuellen und gewalttätigen Zügen, die dennoch friedlich koexistieren könnte, solange niemand das Gleichgewicht des Schreckens zu seinen Gunsten beeinflussen will. Waffenhändler verkaufen an den Meistbietenden, alte Depots der US Army sind Fundgruben für den Entdecker. An die Stelle nuklearer Monopolmächte treten einzelne Personen mit Militärausrüstung bis hin zu Massenvernichtungswaffen, denen gegenüber selbst ein ganzer Staat klein beigeben muss. Vinge spricht damit eine sehr moderne Furcht an; fühlt man sich doch heute bereits bedroht, sollte ein Staat wie der Iran in den Besitz solcher Waffen geraten.
_Weitschuss / Long Shot_ (1972, Erik Simon)
|Eine Raumsonde wird auf die lange Reise in das Alpha-Centauri-System geschickt. Die „Ilse“ genannte künstliche Intelligenz verliert jedoch den Kontakt zur Erde, die sich nach einem sprunghaften Ansteigen der Sonnenaktivität auf das Zehnfache plötzlich nicht mehr meldet. Ilse setzt ihre Mission fort und überprüft gewissenhaft ihre Funktion auf der langen Reise, die von zahlreichen Systemausfällen geplagt ist. Zu ihrem Entsetzen hat sie über die Jahrhunderte auch den selten gebrauchten Teil ihres Speichers verloren, der Ziel und Zweck ihrer Mission enthält. Ilse versucht, aus ihrer Form und Beschaffenheit sowie den erhaltenen Teilen ihres Speichers sowie ihrer Nutzlast, die hauptsächlich aus gefrorenem Wasser und einigen wenigen Mikroorganismen besteht, auf ihre Mission zu schließen. Im Alpha-Centauri-System angekommen, macht sie sich auf die Suche nach Planeten mit bestimmten, eng eingegrenzten Parametern.|
Der Erzähler berichtet aus der analytischen und maschinenhaft geduldigen Perspektive Ilses. Deshalb bleibt die Mission Ilses bis zur Auflösung am Ende für den Leser ein Geheimnis, auch wenn man sie sich anhand der beschriebenen Details und Vinges Vorwort schon vorher erschließen kann. Diese vielleicht faszinierendste Geschichte des Sammelbands schreit geradezu nach einer Fortsetzung, die Vinge zwar bereits in Erwägung gezogen, aber leider noch nicht geschrieben hat.
_Absonderung / Apartness_ (1965, Erik Simon)
|Eine südamerikanische Expedition entdeckt auf einer Insel der Antarktis einen primitiven Stamm, den sie erforscht. Es kommt zu Auseinandersetzungen und man zieht sich zurück. Der Botschafter der Zulunder zeigt sich sehr interessiert an dieser Entdeckung der Südamerikaner, denn die beiden dort gefundenen Schiffswracks stehen in Zusammenhang mit der Vertreibung der letzten Weißen aus Afrika nach dem nuklearen Desaster, das die komplette Nordhalbkugel verwüstet hat.|
Mit 26 Seiten ist diese Geschichte sehr kurz, und sie basiert auf nur zwei Gedanken: Warum gibt es in der Antarktis keine Eskimos? Warum leben keine Menschen dort? Was müsste passieren, damit Menschen sich in dieser unwirtlichen Gegend ansiedeln?
Vinge macht betroffen mit der Häme der schwarzen Zulunder, die sich an der Lage der primitiven Nachfahren der weißen Oberschicht ergötzen. Diese floh damals mit zwei Schiffen aus Südafrika, bekam in Südamerika kein Asyl und muss nun in der Antarktis dahinvegetieren.
Der zweite Gedanke ist die Parabel auf die gewünschte Rassentrennung und das Konzept der Apartheid an sich, das 1965 noch sehr aktuell war. Sie ist kurz, einprägsam und macht betroffen:
„Es wird uns ein Vergnügen sein, zu sehen, wie sie sich ihrer Überlegenheit erfreuen.“ Lunama beugte sich noch eindringlicher vor. „Jetzt haben sie endlich die Absonderung von uns, die ihresgleichen immer wollte. |Sollen sie darin verfaulen| …“ (S. 333)
_Kampflose Eroberung / Conquest by Default_ (1968, Erik Simon)
|Ron Melmwn ist ein Anthropologe des „Pwrlyg“ Konsortiums, das in Australien einen Stützpunkt auf der von einem Atomkrieg weitgehend verwüsteten Erde unterhält. Man plant, die verseuchten Zonen zu besiedeln, ist aber sonst freundlich zu den Menschen und hilft ihnen sogar. Doch es gibt auch Stimmen, die eine Ausrottung der Menschheit fordern, denn die Terroranschläge der Organisation „Merlyn“ kosten das Konsortium viele Leben und Geld. Man argumentiert, es wäre einfacher, diese Welt ohne störende Einflüsse wie eine andere Spezies oder Terroristen neu zu besiedeln.
Melmwn untersucht, warum einige Menschen gegen die Pwrlyg rebellieren. Ist die in zahllose Unternehmen aufgeteilte, von Unparteiischen in der Art eines Kartellamts überwachte Aliengesellschaft nicht der perfekte Weg, um Machtmissbrauch und Kriege wie durch die Regierungen zu verhindern? Sind grenzloser Individualismus mit nur geringen gesellschaftlichen Regeln und ein wahres multikulturelles Nebeneinander nicht auch ein Traum der Menschheit?
Er erkennt, dass trotz aller guten Absichten die Menschheit Widerstand leisten muss, wenn sie ihren eigenen Weg gehen will. Doch es scheint keinen Ausweg zu geben; kulturelle Assimilation oder die totale Vernichtung ist die Wahl, vor der die Menschheit gestellt wird. Mary Dahlmann erzählt Melmwn vom Schicksal der Indianer, und auch andere hochrangige Aliens scheinen das Dilemma der Menschheit begriffen zu haben …|
Diese Geschichte gehört zu den Highlights des Sammelbands. Beeindruckend schildert Vinge, wie die hilfsbereiten Aliens auch ohne Gewalt die Menschheit vernichten können, bis nur noch wenige „Natives“ in der Art der nordamerikanischen Indianer übrig geblieben sind, deren Kultur und Lebensweise es kaum anders ergangen ist.
Dabei erschüttert das Dilemma: Kampf, um sich selbst zu erhalten, und die Vernichtung durch die Aliens riskieren? Oder sich anpassen und langsam untergehen? Oder werden sich die Aliens zurückziehen, die Menschheit sich selbst überlassen?
_Die Tiefen der Zeit / The Whirligig of Time_ (1974, Werner Vetter, überarbeitet von Erik Simon)
|Nach einem verheerenden Atomkrieg entstand das Kaiserreich der Menschheit. Dank der Erfindung des Raumantriebs konnte man sich über das ganze Sonnensystem ausbreiten. Die herrschende Dynastie geht mit den Nachkommen der Verlierer des letzten Kriegs unmenschlich und selbstherrlich um. Alle Erinnerungen an die Vergangenheit werden gezielt unterdrückt, ebenso einige Bereiche der Wissenschaft, die völlig unter der Kontrolle des Kaisers steht. Ein Terrorregime, das einer späten Rache zum Opfer fallen wird …|
Mit 26 Seiten erneut eine sehr kurze Geschichte, die inhaltlich vor Klischees nur so trieft. Vinge hat diesmal auf ein Nachwort verzichtet, auch sein Vorwort ist diesmal belanglos und kurz, er redet um den in meinen Augen peinlichen Kern der Geschichte herum.
Die böse und verderbte Herrscherschicht trägt an die russische Romanov-Dynastie erinnernde Namen, ihre armer, unterdrückter Hofnarr die Uniform der US Army. Von den Künsten schätzt der Kaiser nur „heroische Architektur“, die er für zahllose gigantische Denkmäler seiner selbst benötigt. Sein Sohn ist ein verwöhnter Fratz und behandelt wunderschöne Frauen wie Spielzeug. Kurz, eine schrecklich nette Familie.
Was ist nun der Sinn der Geschichte? In meinen Augen, ihren viel versprechenden und zu den anderen Vinge-Romanen der „Zonen des Bewusstseins“ passenden Namen, „Die Tiefen der Zeit“, für diese Sammlung herzugeben. Der Kaiser findet einen verirrten Blindgänger des Atomkriegs und nimmt ihn, die Gefahr verkennend, auf Wunsch seines Sohns an Bord ihres Raumschiffs. Die ganze kaiserliche Familie explodiert mitsamt ihres amerikanischen Hofnarren, der vermutlich zusätzlich aus hämischer Freude gleich doppelt explodiert ist. Diese Geschichte ist geprägt von dem Geist vergangener Ost-West-Konflikte und aus heutiger Sicht unerträglich; sie kann weder schriftstellerisch und inhaltlich mit ihren Rachegedanken und der klischeehaften Schwarz-Weiß-Malerei überzeugen.
_Spiel mit dem Schrecken / Bomb Scare_ (1970 Franziska Zinn, überarbeitet von Erik Simon)
|Die Dorvik, eine fortschrittliche Rasse, die sich selbst als die „Söhne des Sandes“ bezeichnet, sind eine kriegerische, an irdische Reitervölker erinnernde Spezies. Ihre Lebensauffassung ist extrem sozialdarwinistisch, sie dulden keine anderen Völker neben sich und unterwerfen sie oder rotten sie aus.
Dank ihres Materie-Energie-Konverters sind die Dorvik in der Lage, gigantische Schlachtschiffe in den Weltraum zu bringen und sie mit furchtbaren Waffen auf derselben Basis zu bestücken. Die primitive Menschheit wäre in ihrem kleinen Sonnensystem an und für sich kein Problem für die Dorvik, doch bei aller Primitivität besitzen sie eine Abwehrwaffe gegen die Konverter der Dorvik. Da die Eroberung des Sonnensystems deshalb mit primitiven Waffen betrieben werden muss, häufen sich die Verluste der Dorvik. Prinz Lal e’Dorvik beschließt, die Erde zu sprengen, um so den Widerstand zu brechen.
Doch zwei jugendliche Aliens bedrohen sowohl Dorvik als auch die Menschen: Sie regen mit ihrem kleinen, nur neun Meter großen Raumschiff die Sonne zur Nova an und verstärken ihre Energien, die sie auf einen Schlag freisetzen wollen. Das Ergebnis wäre eine ins unermessliche verstärkte Supernova, die nicht nur das gesamte Sonnensystem, sondern unaufhaltsam, nur durch die Lichtgeschwindigkeit verzögert, alle Welten des Dorvik-Raums zerstören würde.|
Hier sind sie, die guten alten BEMs (Bug Eyed Monsters). Die Dorvik sind kalte, brutale, schuppige, reptilienartige Eroberer, die kleine Säugetiere, Milvaks, als Hors d’oeuvres gerne mal mit der Kralle aufspießen, sich an ihren Zuckungen ergötzen und sie aussaugen.
Die Geschichte wird zum Großteil aus der Sicht ihres Kommandeurs Prinz Lal erzählt, der die Menschheit gar nicht erst mit einem Namen versieht, sondern stets nur vom |Feind| redet. Er will sie alleine schon aus dem Grund vernichten, dass sie ein Abwehrmittel gegen die Überlegenheitswaffe der Dorvik besitzen. Die Geschichte ist sehr humorig und voller Ironie: Zwei Alien-Bengel mischen sich als dritte Partei ein und werden von den Dorvik attackiert. Dank ihrer grenzenlosen technologischen Überlegenheit können diese ihnen nichts anhaben, aber diesen Affront wollen sie nicht auf sich sitzen lassen und beginnen, die Sonne zur Explosion anzuregen. Bis ihre Mutter erscheint und ihnen ordentlich die Leviten liest …
Die Dorvik blasen die Vernichtung des Sonnensystems ab und nehmen Friedensverhandlungen mit den Menschen auf. Prinz Lal hat gehöriges Muffensausen bekommen und verzweifelt an der Tatsache, dass selbst alle fortschrittlichen Rassen zusammen wohl nicht ausreichen würden, um ihre Sonnen gegen diesen |Feind| zu beschützen. Wie ein trotziges Kind reagiert der große Kriegsherr auf diese „Bedrohung“, nicht ahnend, dass es sich nur um den ungezogenen Streich zweier Jugendlicher handelte. Doch dieser Streich bedeutet die Rettung der Menschheit und anderer Rassen:
„Alles, was lebt, muss sich gegen sie verbünden.“ Zornig schüttelte er seine Klaue gegen den Himmel. (S. 422)
_Die Wissenschaftsmesse / Science Fair_ (1971, Erik Simon)
|Der erfolgreiche Industriespion Leandru Ngiarxis bvo-Ngiarxis wird von der hübschen Tochter des genialen Wissenschaftlers Beoling Dragnor bvo-Grawn um Hilfe angefleht: Er soll ihren Vater auf der Wissenschaftsmesse beschützen. Der Fürst von Grawn und Eigentümer des gleichnamigen Unternehmens möchte ihn umbringen, da er sich von seinem Clan losgesagt hat und möglicherweise wissenschaftliche Geheimnisse an die Konkurrenz weitergeben könnte.
Doch es geht um weitaus mehr als kleinliche wirtschaftliche Interessen: Beoling Dragnor hat eine Entdeckung gemacht, die die Zukunft ihrer auf einer Eiswelt in tiefer Dunkelheit lebenden Spezies betrifft.|
Mit 14 Seiten ist dies die kürzeste Geschichte, die Vinge jemals geschrieben und veröffentlicht hat. Obwohl man davon ausgeht, dass es sich um Menschen handelt, kann man sich nicht sicher sein: Eine lebensfeindliche Dunkelwelt des ewigen Eises, bevölkert von Wesen die im Infrarotbereich sehen, deutet nicht gerade darauf hin. Die Gesellschaft ist in Industrie-Clans aufgeteilt, die Clanzugehörigkeit wird durch das Suffix bvo-Clanname angezeigt. Obwohl diese Welt hart und unerbittlich ist, arbeitet man gegeneinander und für den eigenen Profit. Die Entdeckung Beoling Dragnors zeigt eine Bedrohung dieser Wesen, die sie nur durch Zusammenarbeit vielleicht abwenden können.
Vinge spielt hier unter anderem auf globale Umweltprobleme unserer Welt an, die nur durch internationale Kooperation gelöst werden können. Doch Profit und Gewinnstreben, Wettbewerb zwischen den Staaten und ihren Unternehmen blockieren bekanntermaßen viele Maßnahmen zum Schutz der Umwelt – was uns bei diesen Aliens so unsinnig erscheint, ist auch in unserer Welt unsinnig, aber dennoch vorhanden!
_Edelstein / Gemstone_ (1971, Erik Simon)
|Die kleine Sanda verbringt im Sommer 1957 einen langweiligen Urlaub bei ihrer Großmutter. Doch es spukt im Haus ihrer Großmutter. Ein seltsamer „Edelstein“ frisst Plastikblumen und spuckt Diamanten aus. Bei Berührung erzeugt er seltsame Gefühle, Sanda meint, dass er lebt. Doch erst der Einbruch einer Bande, die der ungewöhnliche Reichtum der alten Frau auf den Plan gebracht hat, lässt Sanda erkennen, was genau der „Edelstein“ eigentlich ist.|
Sein Lektor Stanley Schmidt hätte diese Geschichte zuerst abgelehnt, erklärt Vinge. Sie sei auch wirklich das Unausgewogenste, das er je geschrieben habe, könne sich nicht entscheiden, um was es eigentlich geht.
Dennoch ist „Edelstein“ vielleicht gerade deshalb so interessant. Vinge hat die Erinnerung an einen langweiligen Urlaub mit seiner sehr eigenen Interpretation des Films „Das Ding aus einer anderen Welt“ vermengt, dabei kam eine Art Gruselvariante des viel später erschienenen „E.T.“-Films von Steven Spielberg heraus. Allerdings sind nur gewisse Elemente dieser Geschichten ähnlich, die Erkundung und Erfahrung des fremdartigen Wesens des „Edelsteins“ macht den Reiz der Geschichte aus, die zusätzlich noch leichte Konflikte zwischen Großmutter und Enkeltochter aufweist, was bei einer Kurzgeschichte wie dieser abschweifend und irritierend wirken kann.
_Gerechter Frieden / Just Peace_ (1971, Erik Simon)
|Ein duplizierter Agent und Botschafter der Erde soll auf einem krisengeschüttelten Planeten des Delta-Pavonis-Systems Frieden schaffen. Doch die beiden Parteien zeigen sich uneinsichtig und bekämpfen sich lieber bis zur gegenseitigen Vernichtung als die Vermittlung anzunehmen. Der Agent beschließt, sie zu ihrem Glück zu zwingen. Dazu greift er zu radikalen Mitteln und terrorisiert beide Seiten, die daraufhin das Kriegsbeil begraben und sich auf den neuen, gemeinsamen Feind konzentrieren.|
Diese Geschichte schrieb Vinge zusammen mit seinem Freund William Rupp. Sie erinnert ein wenig an „Spiel mit dem Schrecken“: Erneut werden zwei verfeindete Parteien durch einen gemeinsamen „Feind“ geeint. Es werden jedoch einige neue Aspekte aufgegriffen, wie die Möglichkeit, Körper und/oder Bewusstsein zu übertragen, zu „klonen“ oder zu „duplizieren“. Der springende Punkt an der Geschichte ist die menschenverachtende Brutalität, mit der der Agent vorgeht, gar vorgehen muss, die abertausende das Leben kostet – und dennoch eine ganze Welt rettet. Dieses moralische Dilemma ist zentral für die Geschichte, in der Vinge und Rupp im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten dieser Sammlung viel Zeit auf die Charakterisierung des Hauptcharakters verwenden, die demzufolge auch wesentlich lebendiger und unterhaltsamer als sonst gelungen ist, was dem Lesevergnüngen ausgesprochen gut tut.
_Mit der Sünde geboren / Original Sin_ (1972, Joachim Körber, überarbeitet von Erik Simon)
|Die Shimaner sind die zweite intelligente Spezies, der die Menschheit je begegnet ist. Bei der Landung der Menschheit lebten sie noch im Paläolithikum. Doch sie lernen unheimlich schnell, besitzen eine überragende Intelligenz und eine bemerkenswerte Gabe zum logischen und problemlösenden Denken. Deshalb importiert man viele Shimaner auf die Erde, um sie zur Lösung verzwickter Problemfälle einzusetzen. Die Shimaner haben einen Traum, den auch die Menschheit teilt: Unsterblichkeit. Aber leider leben sie nur knapp 25 Monate. Ungeduldig und aggressiv erscheinen sie deshalb den Menschen; ein shimanischer Projektmanager duldet keine Verzögerungen, was man allgemein ihrer niedrigen Lebensspanne zuschreibt.
Ein gewisser Samuelson bietet den Shimanern Raumschiffe an, mit denen sie in den Weltraum expandieren können. Als Konkurrent der Menschheit, die sich immer mehr auf sie verlässt und degeneriert …|
Diese Geschichte steht in Kontrast zu einem sonst sehr üblichen Schema: Weise, langlebige und großmütige Außerirdische mit höherer Intelligenz und Wissen stehen normalerweise einer kurzlebigen, aggressiven und dümmeren Menschheit gegenüber. Vinge hat dieses Schema hier verdreht: Hier ist die kurzlebige und aggressive Spezies intelligenter als die Menschen, deren Großmut ihnen schlecht gelohnt werden könnte. Das „Sein bestimmt das Bewusstsein“, meinte Marx, und unter dieser Prämisse muss man auch die höllischen Zustände auf Shima verstehen, die dem Leser vor Augen geführt werden: Die Shimaner durchleben in kurzen Zeitspannen alle Sünden und Grausamkeiten der Menschheit – und nun droht ihre Expansion zu anderen Sternen, was ein gewaltiges Gefahrenpotenzial für die Menschheit darstellt.
_Die Plapperin / The Blabber_ (1988, Erik Simon)
Obwohl Vernor Vinge „Die Plapperin“ lange vor „Ein Feuer auf der Tiefe“ und [„Eine Tiefe am Himmel“ 364 geschrieben hat, kann man diese Geschichte als Erweiterung dieser beiden Romane ansehen. In der Tat ist die Idee der auf mehrere Körper verteilten Bewusstseinsteile der Klauenwesen in der Plapperin sehr ähnlich zu „Ein Feuer auf der Tiefe“.
_Warnung:_
Da diese Geschichte in Vinges „Zonen des Bewusstseins“-Universum spielt, sollte sie nur gelesen werden, sofern man „Ein Feuer auf der Tiefe“ bereits gelesen hat. Ansonsten stößt man auf nirgends erklärte Konzepte, kann Vinge nicht folgen und verdirbt sich möglicherweise den Spaß an „Ein Feuer auf der Tiefe“.
_Gewinne einen Nobelpreis! / Win a Nobel Prize!_ (2000, Erik Simon)
Im Jahr 2000 schrieb Vernor Vinge für das wöchentliche erscheinende |Nature|-Magazin wie viele andere SF-Autoren nach der Idee des Redakteurs Henry Gee eine maximal drei Seiten lange Geschichte, die einen Ausblick ins nächste Jahrhundert bieten soll.
Vinge schreibt in der Form einer E-Mail mit zahlreichen Hyperlinks (die Links sind in der Druckausgabe unterstrichen, aber ohne URL) und berichtet über eine Technologie, die Erinnerungen an seine erste Geschichte weckt: Die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Alles in allem kein neuer Gedanke und nur mäßig originell geschrieben.
_Die Barbarenprinzessin / The Barbarian Princess_ (1986, Erik Simon)
|Verleger Rey Guille reist mit seiner Barke auf einer Welt umher, die aus zahllosen Archipelagos besteht. Große Teile dieser Welt befinden sich noch im Stadium tiefer Barbarei, der Entwicklungsstand von Rey Guilles Mannschaft ist schwer einzuschätzen, Buchdruck und Seefahrt auf dem Stand des 15. Jahrhunderts beherrschen sie jedoch bereits.
Seine populärste Serie ist die über Hrala, eine über einen Meter achtzig große, phantastisch gebaute, unglaublich starke und geschickte, rachsüchtige und triebhafte Barbarenprinzessin. Eines Tages bringt man ihm eine echte Barbarin an Bord, deren unaussprechlichen Namen er zu Tatja Grimm verkürzt. Sie ist sehr groß; auch wenn sie rotes statt schwarzem Haar hat und der Busen viel zu klein ist, meint man, aus ihr eine perfekte Hrala für Werbezwecke machen zu können.
Die in der Zivilisation sehr verloren wirkende Tatja darf bald ihre Schauspielkünste beweisen: Guille und seine Crew werden bei Nachforschungen über das Schicksal der Besatzung einer geenterten Barke von Wilden gefangen genommen. Mit billigem Flitter als Rüstung und einem hölzernen Schwert, das, mit Glitzersteinchen besetzt und silberner Farbe bestrichen, keinen Hieb verkraften würde, macht sie sich daran, die Einheimischen in der Rolle von Hrala das Fürchen zu lehren und Rey zu retten.|
Diese Erzählung wurde im Jahre 1987 für den Hugo-Award nominiert. Dabei muss man wohl den in Deutschland bisher noch nicht veröffentlichten Roman „Grimm’s World“ kennen, denn der Weltentwurf ist nur sehr vage und unbefriedigend lückenhaft, selbst für eine Erzählung. Mit Rey Guille und Hrala, der Barbarenprinzessin, sind Anspielungen auf den bekannten Science-Fiction-Schriftsteller und Herausgeber Lester del Rey sowie Robert E. Howards Conan- und Red-Sonja-Erzählungen enhalten.
Die Geschichte ist keineswegs als Persiflage zu verstehen, denn Tatja spielt ihre Rolle so gut und mutig gegenüber den bewaffneten Wilden, dass Rey am Ende glaubt, einer Besucherin von einem anderen Stern, einer Göttin, gegenüber zu stehen.
Überzeugen konnte mich diese Geschichte allerdings nicht: Man kann sie nicht mit der Heroic Fantasy eines Robert E. Howard vergleichen, noch handelt es sich um Science-Fiction im herkömmlichen Sinne. Diese Geschichte erschien mir sehr inkonsistent; es ist nie klar, ob die Wilden die Hrala-Geschichten kannten oder überhaupt lesen konnten, aber die Show beeindruckte sie genug, um ihre Gefangenen freizulassen.
Dass die Barke, auf der Rey Guille lebt, ein gigantisches Schiff von der Größe einer Kleinstadt ist, und dass Tatja wirklich schlauer ist als die Barbaren, bei denen sie aufgewachsen ist, und sogar schlauer als die Leute an Bord der Barke und sie in der Folge versucht, sich zur Herrin derselben aufzuschwingen, konnte ich nur durch Recherche herausfinden.
Der Roman „Grimm’s World“ besteht aus drei Kurzgeschichten, die relativ wenig Kohärenz besitzen und eher dem Fantasy-Genre mit anthropologischen Einschlägen zuzuordnen sind. „Die Barbarenprinzessin“ ist die erste dieser Geschichten; was sie von den beiden anderen getrennt in diesem Sammelband zu suchen hat, ist fraglich. Lust auf „Grimm’s World“ hat sie nicht gerade gemacht.
_Das Cookie-Monster / The Cookie Monster_ (2003, Erik Simon)
Eine weitere Geschichte zu Vinges Lieblingsbegriff und -thema „Technische Singularität“: Was wäre, wenn es KIs gäbe, die nicht viel intelligenter als wir wären, aber mehrere tausend Mal schneller denken könnten?
Diese KIs könnten innerhalb weniger Augenblicke Weisheit erlangen, die einem Menschen verschlossen bliebe. Was wäre, wenn diese KIs ihre Erfahrungen speichern und an andere KIs weitergeben würden?
Bis diese Geschichte anfängt, interessant zu werden, vergeht leider geraume Zeit. Erst ab dem Kontakt Dixie Maes mit Rob Stern kann diese Erzählung gefallen; die wirklich interessanten angesprochenen Thematiken kommen dann leider arg kurz. Als krönenden Abschluss des Sammelbands hätte ich mir eine andere Geschichte gewünscht; obwohl neueren Datums, konnte sie mich ähnlich wie die „Barbarenprinzessin“ nicht ansprechen.