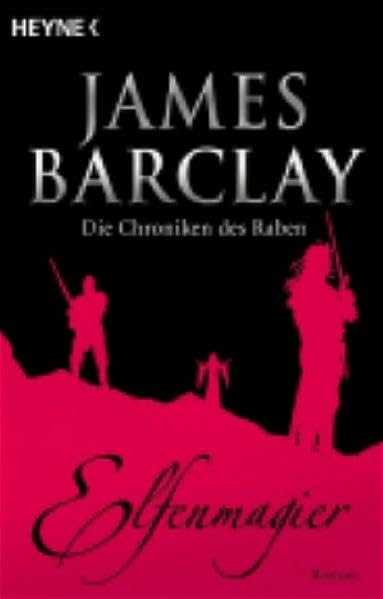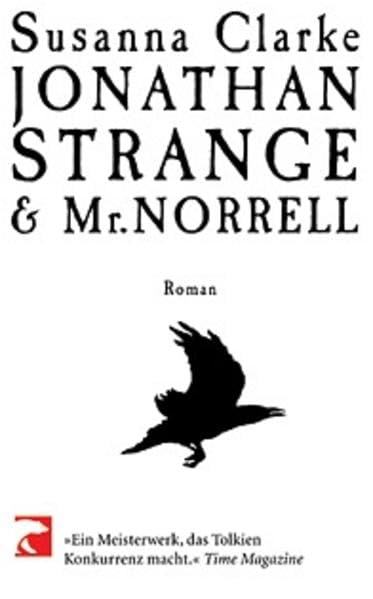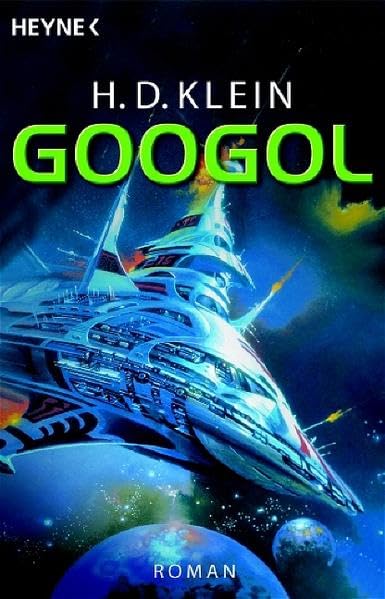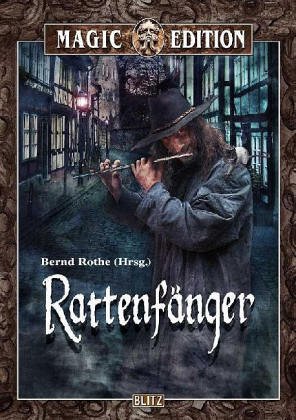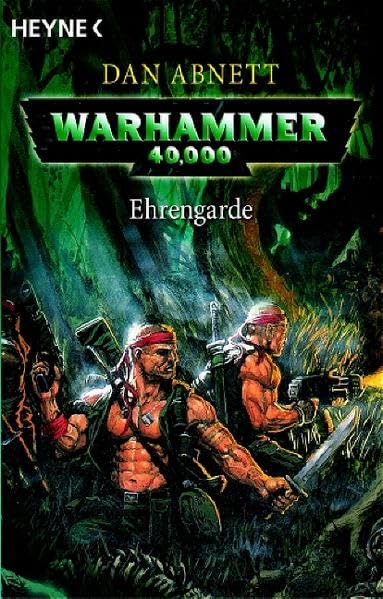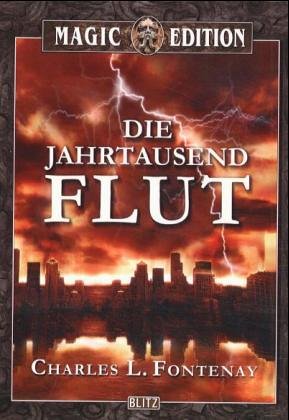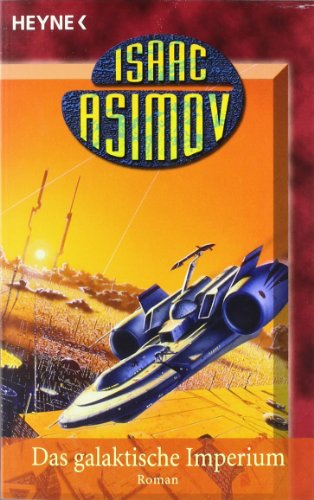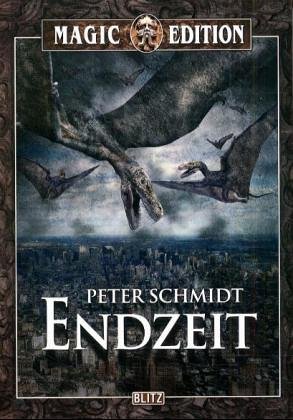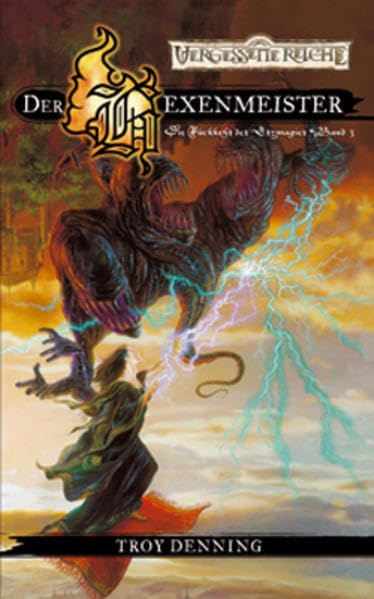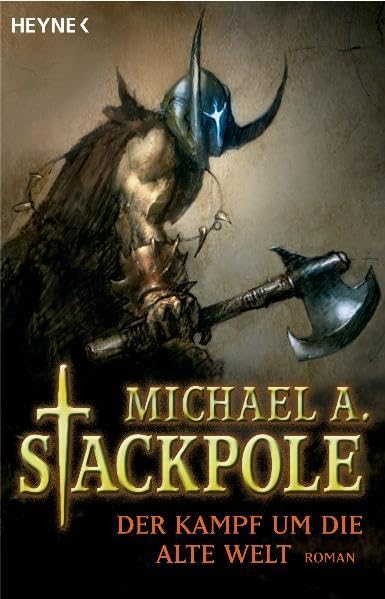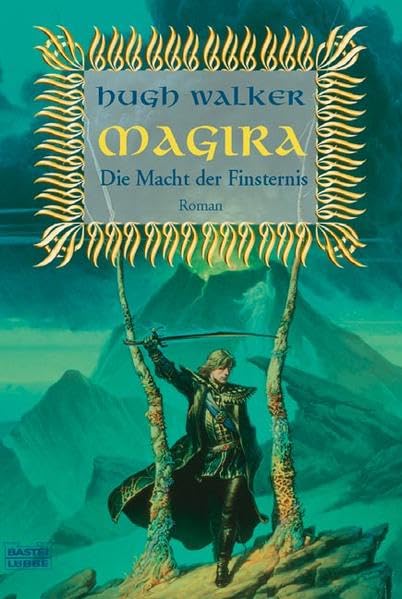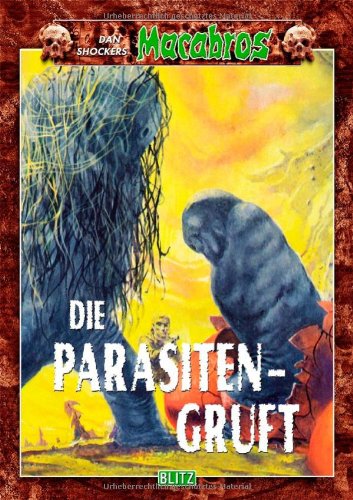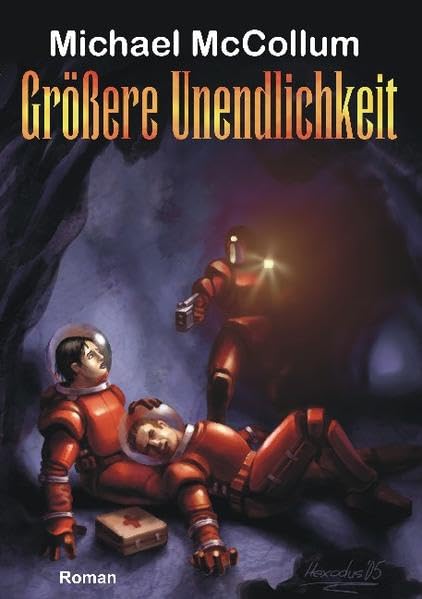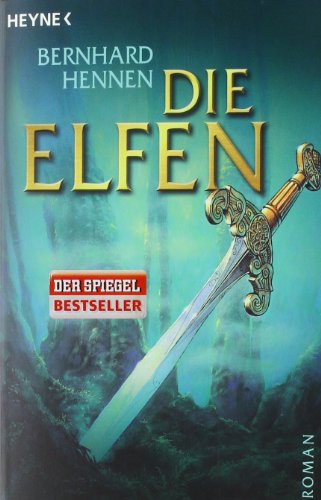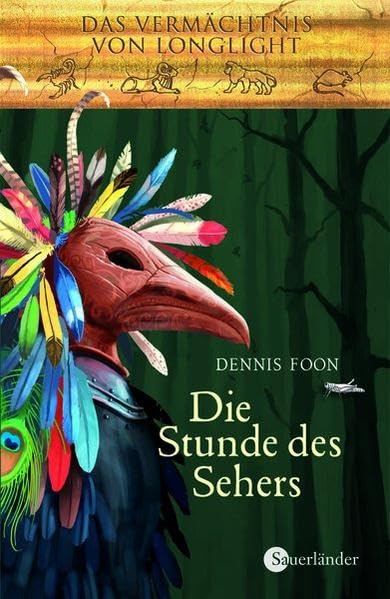Reichlich anderthalb Jahre hat es gedauert, bis die ungeduldig erwartete Fortsetzung von [„Ilium“ 346 (Heyne, 2004) nunmehr erschienen ist – keine sehr lange Zeit, wenn man den veritablen Umfang (960 Seiten!) des neuen Bandes und die aufwendige Übersetzungsarbeit berücksichtigt. Peter Robert, der schon „Ilium“ übersetzt hatte, hat diese gewiss nicht leichte Aufgabe in sprachlich-stilistischer Hinsicht hervorragend gemeistert. Leider ist das auch schon das einzig Positive, was aus Sicht des Rezensenten zu „Olympus“ gesagt werden kann.
„Ein epochales Werk – nach seinem preisgekrönten Roman ‚Ilium‘ stellt Dan Simmons mit ‚Olympus‘ einmal mehr unter Beweis, dass er der bedeutendste mythenschaffende Schriftsteller unserer Zeit ist“, verkündet vollmundig der Verlag auf dem Rücktitel – ein Anspruch, dem das vorliegende Werk leider zu keinem Zeitpunkt gerecht werden kann. Angeblich erzählt das Buch die Geschichte von Thomas Hockenberry, Philosophie-Professor und Homer-Experte aus „Ilium“, weiter, was jedoch nur sehr eingeschränkt der Fall ist, denn Hockenberry spielt in der Fortsetzung eine eher untergeordnete Rolle. Andere Protagonisten wie der Altmensch Harmann und seine schwangere Freundin Ada werden weitaus intensiver und liebevoller geschildert, wie sich insgesamt das Geschehen weitgehend auf die „alte“ Erde verlagert.
Bezog „Ilium“ seinen Charme aus dem Gegensatz zwischen der zumeist nur angedeuteten Hochtechnologie einer fernen Zukunft und dem antiken Gemetzel zwischen Griechen und Trojanern, wobei die Götter eine sehr undurchsichtige und deshalb geheimnisvolle Rolle spielten, so versteht es der Autor in der Fortsetzung nicht, weiter mit diesem Pfund zu wuchern. Zwar geht die Schlacht weiter – blutiger als je zuvor, nachdem die Menschen ihren Kampf gegen die Götter aufgegeben haben und der Kampf um „Ilium“ in scheinbar geordneteren Bahnen seine Fortsetzung nimmt (allerdings ohne den „Göttervater“ Zeus, der von Hera in eine Falle gelockt und in einen Dauerschlaf versetzt wurde), auf Dauer langweilen die exzessiven Schlachtszenen jedoch nur noch, zumal die zahlreichen Wendungen des Geschehens willkürlich und aufgesetzt erscheinen.
Inzwischen haben sich die Moravecs (von Menschen konstruierte roboterähnliche Entitäten mit künstlicher Intelligenz) auf den Weg in Richtung Erde gemacht, da sie dort den Ursprung des Konflikts vermuten. Mit an Bord sind der von Ilium entführte Odysseus und (zeitweise) Thomas Hockenberry, dessen Rolle bis zuletzt unklar bleibt. Ebenso undurchsichtig erscheint das Geschehen auf der alten Erde, wo sich die Voynixe (ehemals dienstbare Roboterwesen) gegen die Altmenschen erhoben haben und diese zu Hunderten massakrieren. Harman, Daeman und Ada überleben den Angriff zunächst, allerdings scheint ihre Lage zunehmend aussichtslos, zumal sich zusätzlich zur Voynix-Plage eine ebenso mächtige wie übelwollende Gottheit namens Setebos auf Mutter Erde niedergelassen hat und einen Zufluchtsort der Altmenschen nach dem anderen unter tödlich-blauem Eis ersticken lässt. Auch der Magier Prospero ist wieder mit von der Partie, ebenso wie die blutgierige Kreatur Caliban, der bereits der überwiegende Teil der so genannten „Nachmenschen“ zum Opfer gefallen ist.
Einer bzw. eine dieser Nachmenschen hat allerdings in einem Sarkophag auf dem Gipfel des Himalaya überlebt, und es bleibt Harman im Rahmen einer äußerst rätselhaften Mission vorbehalten, diese jüngere Version der „ewigen Jüdin“ Savi wiederzuerwecken. Die junge Frau namens Moira verfügt über im Wortsinne unglaubliche Fähigkeiten, die – wie sich später herausstellt – zu großen Teilen auch den Altmenschen zur Verfügung stehen. Die Erklärung bleibt vage, sowohl von genetischer Manipulation als auch von Nanotechnologie ist die Rede, was z. B. angesichts der Fähigkeit zum „Freifaxen“ (sich an einen beliebigen Ort versetzen) mehr als fragwürdig erscheint.
Überhaupt benutzt der Autor die spektakulärsten wissenschaftlichen Ideen der Neuzeit ohne erkennbare Skrupel oder den Versuch einer seriösen Begründung. Es wimmelt von Bran-Löchern, alternativen Universen, Logosphären-Avatars und sogar den guten alten Black Holes in Miniaturausführung, die Dan Simmons zu einem pseudowissenschaftlichen Cocktail mischt, der sich mit zunehmender Länge des Werkes als unverdaulich erweist. Spätestens nach der Hälfte des Buches fragt sich der Leser ernsthaft, was denn das Ganze nun eigentlich soll, und die Antwort – so man denn überhaupt von einer solchen sprechen kann – fällt leider alles andere als befriedigend aus und offenbart einen gewissen Hang des Autors zur Metaphysik. Zu den metaphysischen Schrecken gesellt sich dann auch noch menschliche Bosheit, die zu allem Überfluss auch noch in ein ideologisches Gut-Böse-Raster gepresst wird.
Wie nach dem 11. September offenbar modern und mehrheitsfähig, sind es die bösen Moslems, die die Erde mittels einer Seuche fast vollständig entvölkert haben und nur durch unsere Helden daran gehindert werden können, die alte Erde sozusagen post mortem mittels einiger hundert Schwarzer Löcher in eine Staubwolke zu verwandeln. Derartige ideologisch-politische Konstrukte mögen bei Near-Future-Szenarien ihre Berechtigung haben; bei einer Handlung, die angeblich mehrere tausend Jahre in der Zukunft spielen soll, wirken sie etwa so glaubwürdig wie ein Mongolensturm auf den Asteroidengürtel und alles andere als „mythenschaffend“.
Beinahe noch ärgerlicher ist die Neigung des Autors, mittels exzessiver Sex- und Gewaltszenen ein Publikum zu erreichen, das wohl sonst keine Bücher lesen würde. Die entsprechenden Organe haben zumeist Unterarmlänge (nur kein Neid) und Körpersäfte werden mindestens literweise ausgeschüttet bzw. mit Hieb und Stichwaffen extrahiert. Die Figur des Achilles wird vermutlich einzig aus diesem Grund so ausgiebig geschildert, denn sinnvoll erscheinen die Aktivitäten des Achäerhelden zu keinem Zeitpunkt.
Leider ist dieses Fazit der weitgehenden Sinnfreiheit des Gesamtwerkes das Einzige, was dem geneigten Rezensenten nach der Lektüre der fast 1000 Seiten geblieben ist. Normalerweise werden inhaltliche Defizite bei Dan Simmons‘ Büchern durch ein hohes Maß an Spannung kompensiert (was bei „Ilium“ durchaus noch der Fall war), doch auch die fehlt bei „Olympus“ über weite Strecken. Die Protagonisten sind erstens zu zahlreich, um Interesse an den Geschicken des Einzelnen aufkommen zu lassen, und der letztendliche Erfolg der Unternehmungen der „Guten“ scheint von Beginn an wenig zweifelhaft. So stellt sich „Olympus“ am Ende als eine ärgerliche Kombination von Seitenschinderei, Spannungsarmut, Pseudowissenschaftlichkeit und ideologischer Determiniertheit dar, mit der der Autor der genialen Hyperion-Gesänge weder sich noch dem Publikum einen Gefallen getan hat.
|gelesen von [Frank W. Haubold]http://www.cis-gate.de/homepages/haubold/home.htm
Übertragung aus der alten in die reformierte Rechtschreibung durch den Editor|