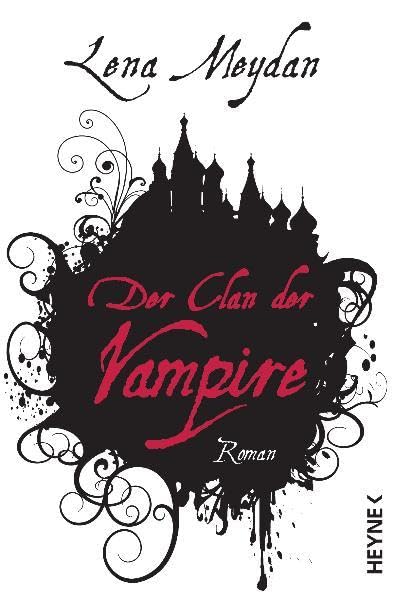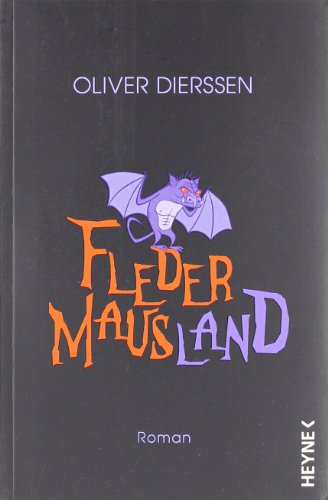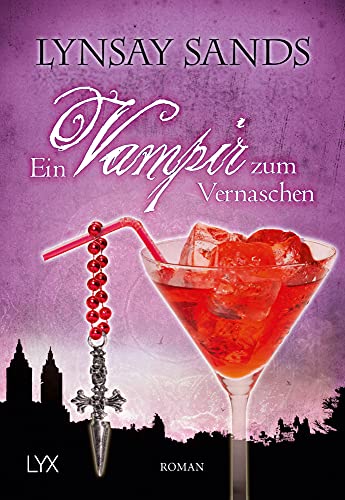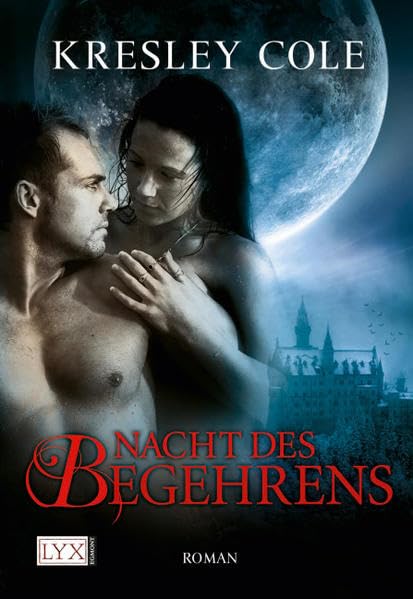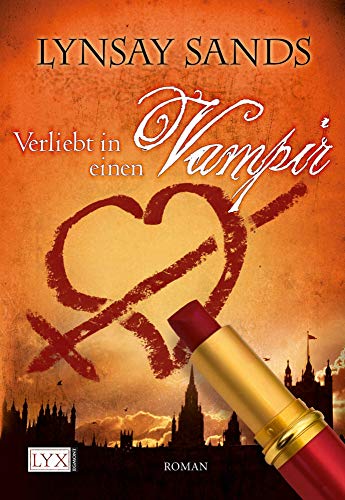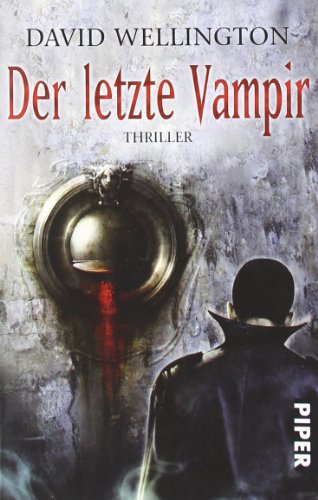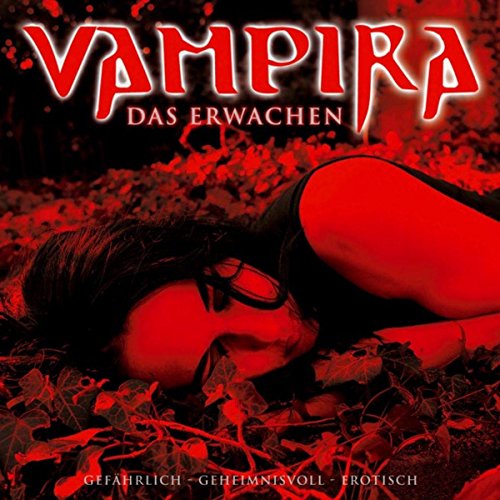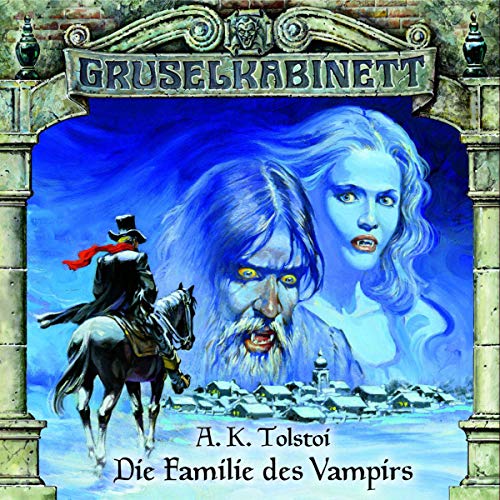Lena Meydan – das klingt wie eines dieser Fantasy-Pseudonyme, unter denen amerikanische Autorinnen ihre Vampirromanzen unters lesende Volk bringen. Und tatsächlich ist Lena Meydan – entgegen der Tatsache, dass es eine Webseite mit Kurzbio und Steckbrief gibt – ein Pseudonym, hinter dem sich die drei russischen Schriftsteller Alexey Pehov, Elena Bitschkowa und Natalja Turtschaninowa verbergen. Eigentlich ein unnötiger Schachzug, genießt russische Fantasy hierzulande doch spätestens seit der Wächter-Trilogie einen durchaus guten Ruf. Außerdem heißt es über Lena Meydans Roman „Clan der Vampire“, er sei für den internationalen Markt umgeschrieben worden. Man dachte wohl, sich auf dem internationalen Parkett dem momentan gängigen niedrigen Niveau wenigstens annähern zu müssen. Glücklicherweise ist das nicht gelungen. Denn auch wenn der englische Titel „Twilight Forever Rising“ das Buch mit Gewalt in die Meyer-Ecke drängen will und auch der deutsche Klappentext versucht, das Gewicht auf die Liebesgeschichte zu legen, so handelt es sich bei „Clan der Vampire“ doch keineswegs um eine rührselige Vampirschmonzette. Wer also aufgrund des Marketings die Finger von diesem Roman lässt, verpasst unter Umständen ein gutes Buch.
Tatsächlich hat „Clan der Vampire“ (der russische Originaltitel ist „Kindret“) dafür einiges mit dem Rollenspiel „Vampire – The Masquerade“ zu tun. Diese geistige Verwandtschaft tragen die drei Autoren als Banner offensichtlich auf dem Buchdeckel: „Kindred“ (bzw. deutsch „Clan der Vampire“ – dafür ein Bonuspunkt für die korrekte deutsche Übersetzung) war eine kurzlebige Serie, die auf dem Rollenspiel fußte. Dass Vampire sich in Clans, also bestimmte Familien, unterteilen, die verschiedene Eigenschaften besitzen und sich in menschliche Politik und Wirtschaft einmischen, ist der gedankliche Grundpfeiler des Romans. Protagonist ist Darrel Dachanawar, ein Telepath, der für seinen Clan andere Vampire, aber gern auch menschliche Geschäftspartner aushorcht. Während die Moskauer Vampire – oder Blutsbrüder, wie sie sich selbst nennen – menschliche Emotionen und Handlungsmuster kaum noch nachvollziehen können, hält sich Darrel gern in der Welt der Menschen auf. Dabei begegnet ihm Lorraine, mit der ihn bald eine zarte Romanze verbindet. Doch eine Verbindung zwischen einem Menschenmädchen und einem Vampir kann nicht lange gut gehen. Schon gar nicht, wenn die Balance der verschiedenen Familien ohnehin gestört ist und jeder mit geschickt eingefädelten Intrigen versucht, die Oberhand zu gewinnen.
Doch „Clan der Vampire“ handelt nicht nur von Darrel. Seine Geschichte ist zwar der rote Faden, der sich durch den Roman zieht. Doch daneben erfährt der Leser noch ganz viel über andere Vampirfamilien und deren Oberhäupter. Die Erzählperspektive wechselt häufig. Mal folgt man Miklosch Balsa, dem Oberhaupt der Tschornis, mal Paula, einer Feriartos. Zusammen ergeben all diese Geschichten dann ein großes Mosaik. Das heißt aber auch, dass sich die Handlung nur langsam entschlüsselt. Als Leser muss man Geduld mitbringen. Nicht nur braucht es eine Weile, bis man all die verschiedenen Familien und ihre wichtigsten Figuren auseinanderhalten kann, auch spielen sich viele Handlungsstränge parallel ab und ergeben erst am Ende des Buches Sinn. Wer diese Geduld aufbringt wird allerdings belohnt: „Clan der Vampire“ ist – trotz der abgekupferten Grundidee – ein originelles und vor allem spannendes Buch. Und gerade die zahlreichen Erzählperspektiven stellen sicher, dass jeder Leser einen Charakter findet, der ihn persönlich anspricht.
So gibt es zwar durchaus eine Liebesgeschichte zwischen Darrel und Lorraine, doch diese ist eben nur ein kleines Mosaiksteinchen im großen Ganzen – „Clan der Vampire“ ist keineswegs ein Liebesroman. Mancher Leser interessiert sich vielleicht eher für Miklosch, das schmale, blonde Oberhaupt der Tschornis, der gern komponiert und einen Hygienetick hat, aber gleichzeitig unglaublich brutal sein kann und sich eine ganze Armee von Söldnern hält. Oder vielleicht doch lieber Christoph, der französische Ritter, der in einer Wohnung lebt, die er alle drei Monate komplett umräumt und der Leichen wiederwecken kann. Jede Figur wird mit der gleichen Liebe zum Detail dargestellt – niemand ist einfach nur gut oder böse, einfach nur schwarz oder weiß. Und es ist genau diese differenzierte Darstellung, die „Clan der Vampire“ so lesenswert macht.
Was ein wenig zu kurz kommt – gerade für einen deutschen Leser – ist das Setting. „Clan der Vampire“ spielt in einem fast kontemporären Moskau (die russische Originalausgabe gibt über jedem Kapitel einen Tag im Jahr 2004 an, in der deutschen Ausgabe wurde diese genaue zeitliche Verortung weggelassen). Leider jedoch spielt Moskau als Ort der Handlung kaum eine Rolle und wäre, wenn nicht einige bekannte Gebäude oder Straßen erwähnt würden, sogar vollkommen austauschbar. Stattdessen entführen die Autoren in Clubs und Restaurants, die so hipp und beliebig sind, dass sie sich auch in jeder anderen Großstadt dieser Welt befinden könnten. Das ist ein bisschen schade, würde ein gut beschriebener Handlungsort doch ungemein zur Atmosphäre des Romans beitragen. Vampire in einem finsteren Moskau? Wer kann da widerstehen?
Natürlich muss auch dazu gesagt werden, dass dieser Roman der Auftakt zu einer Tetralogie ist. Deshalb endet „Clan der Vampire“ mit einem ordentlichen Cliffhanger. Das Autorentrio hat sich viel Zeit genommen, eine Romanwelt aufzubauen und zu gestalten. Wie im Schachspiel werden die verschiedenen Figuren platziert und zueinander in verschiedenen Beziehungen gestellt. Im Verlauf des Romans gibt es erste Schachzüge, doch wird sich erst in den Fortsetzungen zeigen, in welche Richtung das Spiel sich entwickelt. Die Familien stehen am Beginn eines Kriegs um die Vorherrschaft. Wer daraus als Sieger hervorgeht, wird sicher erst der vierte Band zeigen. Hoffen wir, dass der deutschsprachige Markt nicht zu lange auf die Fortsetzungen warten muss. Es passiert heutzutage schließlich nicht mehr allzu häufig, dass originelle, düstere und unterhaltsame Vampirliteratur veröffentlicht wird. Ein echter Pageturner!
|Taschenbuch: 560 Seiten
Originaltitel: Kindret, Krownye bratja
ISBN-13: 978-3453266902|
[www.randomhouse.de/heyne]http://www.randomhouse.de/heyne