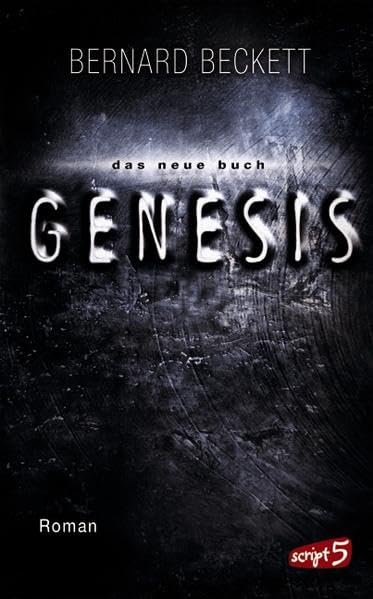
Klingt fast ein wenig nach einem Verschwörungsthriller. Ist es aber nicht. Ich würde dieses Buch nicht einmal als Unterhaltungsliteratur bezeichnen.
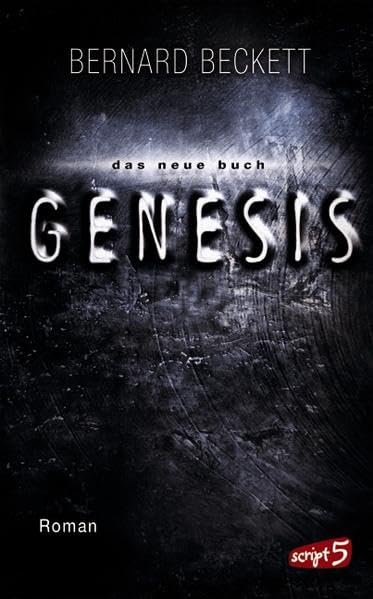
Klingt fast ein wenig nach einem Verschwörungsthriller. Ist es aber nicht. Ich würde dieses Buch nicht einmal als Unterhaltungsliteratur bezeichnen.
Band 1: [Charlie Bone und das Geheimnis der sprechenden Bilder]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1992
Band 2: [Charlie Bone und die magische Zeitkugel]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=2448
Band 3: [Charlie Bone und das Geheimnis der blauen Schlange]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3308
Band 4: [Charlie Bone und das Schloß der tausend Spiegel]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3308
Band 5: [Charlie Bone und der rote König]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3468
Band 6: [Charlie Bone und das magische Schwert]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4685
Band 7: [Charlie Bone und der Schattenlord]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5670
Diesmal stecken Charlie und seine Freunde wirklich in ernsten Schwierigkeiten! Schlimm genug, dass der Stadtrat, nachdem er im letzten Band bereits die Schließung des Cafés |Zum glücklichen Haustier| verfügt hat, jetzt das Ehepaar Onimous komplett auf die Straße setzt und dass Tancred, der eigentlich nach seinem Duell mit Dagbert von den Bloors für tot gehalten wird, beinahe auffliegt, als er allein auf der Straße unterwegs ist. Aber dabei bleibt es nicht. Das Gelichter in der Piminy Street scheint sich plötzlich sprunghaft zu vermehren, im Bloor taucht nicht nur ein Magier mit einem verzauberten Schwert auf, sondern auch Dagberts Vater, und dann gerät auch noch Olivia ins Visier der Bloors und Darkwoods! Charlies Eltern sind immer noch auf See, in höchster Gefahr ertränkt zu werden, und Billy Raven befindet sich noch immer in dem Gemälde von Schloss Badlock!
Diesmal sieht es so aus, als wären es der Rettungsaktionen ein paar zu viele!
_Neuzugänge in der_ Charakterzeichnung sind diesmal nicht zu verzeichnen. Zumindest lässt sich Ashkelan Kapaldi kaum als vollwertiger Charakter bezeichnen, zu knapp ist er skizziert und zu kurz ist sein Gastspiel.
Auch was die Charakterentwicklung angeht, tut sich nicht mehr viel, allein Dagbert scheint im Zusammenhang mit der Konfrontation zwischen ihm und seinem Vater, die ihm durch den Familienfluch auferlegt wurde, noch eine gewisse Wandlung durchzumachen.
Dafür hat Jenny Nimmo diesmal auch auf Charaktere zurück gegriffen, die die Handlung längst verlassen hatten oder nur noch ganz am Rande vor kamen, darunter Alice Angel, die Schmiedin Mrs. Kettle und Tante Venetias Stiefsohn Eric.
Mit anderen Worten: sie hat fast das gesamte Arsenal aufgeboten.
Auch die Handlung bringt noch einmal eine geballte Masse an Möglichkeiten auf den Tisch, die die Autorin bisher nicht ausgeschöpft hat, sodass sich diesmal kaum sagen lässt, welches eigentlich der Hauptstrang ist. Tatsächlich ist die Gewichtung der einzelnen Aspekte ziemlich ausgeglichen. Für die Schwierigkeiten, in die Olivia gerät, hat die Autorin auf ein bereits bekanntes Detail zurück gegriffen, was aber nichts schadet, da es angesichts von Olivias Charakter einfach passend gewählt und damit schlüssig ist. Neu dagegen ist der Wasserglobus, eine interessante Idee, die mir besonders gut gefallen hat. Fast fand ich es schade, dass er nur so relativ kurz eine Rolle spielt, wenn auch eine recht spektakuläre.
Aber so ging es nicht nur diesem Punkt. Durch die große Menge an Einzelheiten ist einfach kein Platz für eine genauere Ausarbeitung. Am deutlichsten wird das spürbar in der Figur des Ashkelan Kapaldi, der so gut wie kein eigenes Profil aufweist, da er nicht auf eine Vorgeschichte aus anderen Bänden zurückgreifen kann und als erstes wieder verschwindet.
Dennoch empfand ich diese unvermeidliche Folge nicht als Manko. Denn durch die schiere Menge an Schwierigkeiten und Ärger, den die Bloors mit ihren neuesten Plänen auslösen, ist einfach immer irgendetwas los. Und obwohl Jenny Nimmo – um es grob auszudrücken – die einzelnen Bauklötze Stein für Stein erst auf- und dann wieder abbaut, lassen sich die einzelnen Bestandteile doch nicht so einfach voneinander trennen, wie es in diesem Vergleich womöglich klingt. Der Wasserglobus spielt nicht nur im Zusammenhang mit Charlies Eltern eine Rolle, sondern auch in der Auseinandersetzung zwischen Dagbert und seinem Vater und Olivias Schwierigkeiten mit den Darkwoods haben ihre Ursache in einer Aktion, deren Auslöser eigentlich das Testament war, hinter dem alle her sind.
Entscheidend ist die Wirkung, die der Bausteinvergleich beschreibt: Der Leser hat das Gefühl, dass sich Klotz für Klotz eine Schwierigkeit nach der anderen vor Charlie und seinen Freunden auftürmt, bis die Mauer fast unüberwindbar erscheint, was gehörig die Spannung hochtreibt. Auch sorgt die bröckchenweise Bewältigung für Übersichtlichkeit – immerhin ist die Zielgruppe noch immer unter den jüngsten Lesern zu suchen – und verhindert gleichzeitig, dass die Spannung zu schnell wieder abflaut. Tatsächlich kann die Autorin den Bogen bis zum endgültigen Showdown gestrafft halten, bei dem es dann nochmal so richtig wild wird und der mit einer kurzen Überraschung am Ende aufwartet. Ich weiß nicht mehr, ab wann ich das Ende ahnte, aber es war ziemlich spät!
Um es kurz zu machen: Jenny Nimmo ist zum Abschluss ihres Zyklus‘ noch einmal richtig zur Hochform aufgelaufen. Denn trotz der vielen Einzelteile, aus denen die Handlung dieses letzten Bandes zusammengesetzt ist, kommt das Buch wie aus einem Guss daher, keine Geholper, kein Stocken. Auch hat die Autorin sich nicht damit begnügt, nur auf alte Bekannte und bereits bewährte Ideen zurück zu greifen, was durchaus kein Fehler war, sondern sie hat sich auch diesmal die Mühe gemacht, sich wieder etwas Neues und Interessantes auszudenken, haben doch gerade diese Ideen – wie der Wasserglobus, die Zeitkugel oder Amorets Spiegel – einen Großteil des Zaubers ihrer Bücher ausgemacht. Beides zusammen zeigt noch einmal die Vielfalt des Zyklus‘ in Ideen und Figuren. Die Frage, warum Dagberts Launen nach der Auseinandersetzung mit seinem Vater auf einmal nicht mehr dem Mondzyklus unterworfen sein sollten, ist da ebenso rasch vergessen wie die Tatsache, dass nirgendwo so recht klar wird, wozu genau eigentlich Ashkelan Kapaldi aus seinem Gemälde geholt wurde.
_Insgesamt fand ich_ |Die Kinder des roten Königs| bunt, ideenreich, turbulent und lesenswert. Ein Beweis dafür, dass Geschichten weder Mord und Totschlag noch eklige Monster benötigen, um spannend und unterhaltsam zu sein.
_Jenny Nimmo_ arbeitete unter anderem als Schauspielerin, Lehrerin und im Kinderprogramm der |BBC|. Geschichten erzählte sie schon als Kind, Bücher schreibt sie seit Mitte der Siebziger. Unter anderem stammt der Zyklus |Snow Spider| aus ihrer Feder, sowie „Im Garten der Gespenster“, „Der Ring der Rinaldi“ und „Das Gewächshaus des Schreckens“. Der Zyklus |Die Kinder des roten Königs| hat sie auch in Deutschland bekannt gemacht.
|Gebundene Ausgabe: 352 Seiten
ISBN-13: 978-3473347841
Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 10 Jahre
Originaltitel: |Charlie Bone and the Red Knight|
Deutsch von Christa Broermann|
http://www.jennynimmo.me.uk
http://www.ravensburger.de
Helen ist Licht. So zumindest beschreibt sie sich selbst. Seit 130 Jahren ist sie schon tot, doch sie wandelt immer noch auf der Erde. Der Himmel hat sie abgewiesen, aus der Hölle ist sie geflüchtet und nun klammert sie sich eng an ihren jeweiligen Bewahrer. So nennt sie diejenigen Menschen, an die sie sich gebunden hat, um auf der Erde bleiben zu können. Ihr derzeitiger Bewahrer ist ein gewisser Mr. Brown, ein gütiger, freundlicher Mann, der am College Englisch unterrichtet. Sie begleitet ihn überall hin, unbemerkt und unsichtbar. Bis eines Tages einer von Mr. Browns Schülern, Billy Blake, sie anblickt … und lächelt.
Die Charakterzeichnung in diesem Buch ist eine schwierige Sache. Denn die beiden Hauptfiguren, Helen und James, können sich nur an einige kleine Bruchstücke aus ihrer Vergangenheit erinnern. So bleibt für die Darstellung dieser beiden lediglich das Jetzt, und das ist nicht allzu viel.
Über James erfährt der Leser im Grunde gar nichts. Helen kommt da etwas besser weg, da aus ihrer Sicht erzählt wird. Sie liebt Literatur und hegt eine besondere Zuneigung zu Mr. Brown. Ihre Eifersucht auf seine Frau, ihr Bedauern, als sie sich von ihm löst um bei James zu sein, sind Dinge, die sie etwas lebendiger werden lassen. Und dann ist da natürlich noch die Leidenschaft, die James und Helen füreinander empfinden.
All das reicht immerhin aus um die beiden nicht blutleer und flach erscheinen zu lassen und Sympathien beim Leser zu wecken.
Die übrigen Charaktere sind nur skizziert: Der rauhbeinige Mitch, der auf seine derbe Art versucht, Billy vor weiteren Schwierigkeiten zu bewahren; der sanfte, gütige Mr. Brown, der seine Frau so sehr liebt, dass er darüber fast vergisst, seinen Roman zu Ende zu schreiben; Jennys Mutter Cathy, die so sehr bemüht ist, alles richtig zu machen, nur um schließlich fest zu stellen, dass es längst zu spät ist; und Jennys Vater Dan mit seiner strengen, ja gnadenlosen Religiosität, gegen die er keinerlei Verstöße duldet außer seiner eigenen. Keine dieser Figuren wirkt platt oder steif, doch für echte Tiefe bleibt nicht genügend Raum, da das Hauptaugenmerk so sehr auf den beiden Hauptpersonen liegt.
Die Handlung wiederum erstreckt sich nur über wenige Tage. Aber sie zeichnet sich auch nicht dadurch aus, dass besonders viel passieren würde. Helen und James lernen sich kennen, verlieben sich und wollen zusammen sein, weshalb auch Helen sich einen Körper sucht.
Dahinter erzählt das Buch jedoch weit mehr.
Zum Einen ist es die Geschichte von Billy und Jenny, obwohl die beiden erst am Ende des Buches für wenige Zeilen selbst auftauchen. Doch an Hand dessen, was James und Helen über die beiden erfahren, während sie in ihren Körpern stecken, entsteht langsam und allmählich, Steinchen für Steinchen, ein Mosaik, das erklärt, warum die beiden Teenager ihre Körper verlassen haben. Der drogensüchtige Billy kommt offenbar nach dem, was mit seinen Eltern geschehen ist, nicht mehr mit seinem Leben zurecht, obwohl sein Bruder Mitch sich auf seine ruppige Art alle Mühe mit ihm gibt. Und Jenny ist einfach vor der unbarmherzigen Doktrin und dem kalten, herzlosen Perfektionswahn ihres Elternhauses geflüchtet.
Zum Anderen ist es die Geschichte von James und Helen, und nicht nur die der Gegenwart. Immer deutlicher kristallisiert sich heraus, dass die beiden nicht umsonst auf der Erde zurück geblieben sind und dass es nicht daran liegt, dass der Himmel sie abgewiesen hätte. Beide müssen sich dem Trauma ihrer Vergangenheit stellen, um das irdische Leben endlich ganz loslassen zu können.
Laura Whitcomb erzählt diese Geschichte in einer mal alltäglichen, mal regelrecht verklärenden Sprache und stellt so die Härten der Realität und die Träume und Sehnsüchte ihrer Protagonisten einander gegenüber. Das ermutigende Fazit der Geschichte lautet letztlich, dass der Mensch in der Lage ist, sich seine persönliche Hölle selbst und ganz allein zu schaffen, nur dadurch, dass er sich davor fürchtet, sich dem Leben und der Wahrheit zu stellen, woraus letztlich folgt, dass der Mensch auch in der Lage ist, eben diese Hölle zu überwinden, wenn er den Mut und die Kraft aufbringt, sich seinen Katastrophen entgegen zu stemmen.
Unterm Strich kann man „Silberlicht“ als poetische Mystery-Romanze bezeichnen. Immerhin aber ist es der Autorin gelungen, ihre Geschichte frei von Kitsch zu erzählen und ihre Helden trotz der dünnen Basis, auf der sie sie entworfen hat, menschlich, sympatisch und nachvollziehbar zu gestalten. Die sprachlich poetisch gestalteten Passagen verleihen der Gesamtheit des Buches Zauber und einen gewissen Charme, den der Mysterie-Aspekt alleine nicht erzeugt hätte. Das macht „Silberlicht“ mit seinen rund dreihundert Seiten zu einer netten, kleinen Zwischendurchlektüre für Romantiker und solche, die es werden wollen.
Laura Whitcomb stammt aus Californien und war Englischlehrerin, ehe sie mit dem Schreiben begann. Außer „Silberlicht“, für das sie mehrere Preise erhielt, hat sie einen weiteren Roman sowie zwei Sachbücher geschrieben, die bisher nicht auf Deutsch erschienen sind. Sie lebt mit ihrem Sohn in Portland/Oregon.
|Gebundene Ausgabe: 310 Seiten
ISBN-13: 978-3426283288
Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 14 Jahre
Originaltitel: |A Certain Slant of Light|
Deutsch von Sabine Thiele|
http://www.laurawhitcomb.com/index.htm
Azoth ist elf und gehört damit zu den Kleinen in der Gilde des schwarzen Drachen. Und wie alle Kleinen hat er entsetzlich unter dem sadistischen sechzehnjährigen Ratte zu leiden. Kein Wunder, dass der Junge davon träumt, von Durzo Blint als Lehrling angenommen zu werden. Doch Durzo Blint ist eine lebende Legende und hat noch nie einen Lehrling angenommen. Als Durzo Azoth die Bedingung nennt, unter der er eine Ausnahme zu machen bereit wäre, muss Azoth feststellen, dass das, was seinen Traumberuf ausmacht, ihm gar nicht so leicht fällt wie er gedacht hatte …
Eigentlich ist Azoth ein freundlicher, mitfühlender Kerl. Er teilt sein bisschen Essen nicht nur mit seinem Freund Jarl, sondern auch mit der stummen Kleinen, die alle nur Puppenmädchen nennen. Der einzige Mensch, den er wirklich hasst, ist Ratte. Er hat entsetzliche Angst vor dem viel stärkeren Jungen; dass er es trotzdem wagt, sich zu widersetzen, zeigt seinen Mut. Doch als der Konflikt sich immer mehr zuspitzt, zögert Azoth, die Sache konsequent zu Ende zu bringen.
Ratte dagegen ist ein skrupelloses Scheusal. Das Einzige, was ihn davon abhält sich wie ein wildes Tier zu verhalten, ist der Plan, an den er sich halten muss um das Ziel zu erreichen, das er sich gesteckt hat. Denn Ratte hat durchaus nicht vor, sich mit der Anführerschaft einer Kinderdiebesgilde zufrieden zu geben. Ratte will mehr, viel mehr …
Auch Durzo Blint scheint so etwas wie Skrupel nicht zu kennen. Schließlich kann ein gedungener Attentäter es sich generell nicht leisten, seine Aufträge in Frage zu stellen, doch Blint hat auch kein Problem damit, in einem solchen Zusammenhang noch weiteren Menschen das Leben zu nehmen, wenn er es für nötig hält, auch wenn für ihn das Eintreten einer solchen Notwendigkeit ein Zeichen für Pfusch bei der Arbeit ist. Im Laufe der Zeit stellt sich allerdings heraus, dass Durzo Blint nicht ganz so abgebrüht ist, wie er gern möchte, dass die Welt es von ihm glaubt.
Und dann ist da noch Logan Gyre. Der zwölfjährige Junge ist der Sohn eines der mächtigsten und beliebtesten Adligen des Reiches und nur deshalb nicht der Kronprinz, weil sein Vater einst, um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, auf seinen Anspruch auf den Thron verzichtet hat. Und Logan schlägt ganz nach seinem Vater: Er ist ausgesprochen loyal dem Reich und seinen Freunden gegenüber, absolut frei von jeglichem Ehrgeiz, stark wie ein Ochse, aber gutmütig, ehrlich und durchaus nicht dumm.
Brent Weeks hat hier eine respektable Charakterzeichnung abgeliefert. Seine Charaktere haben vielleicht nicht ganz dieselbe Tiefe wie bei Jenny-Mai Nuyen oder Anne Bishop, aber es ist ihm gelungen, sie sehr lebendig und fassbar zu zeichnen und dabei jedes Klischee zu vermeiden, und das bis hinein in die Nebencharaktere. Besonders Durzo Blint ist in seiner Zerrissenheit sehr gut gelungen.
Die Welt, in der seine Geschichte spielt, ist dagegen nur grob skizziert. Cenaria ist ein Land, das bisher kaum auf bemerkenswerte Eigenleistungen zurückgreifen kann. Seine Kultur ist ein Mosaik aus kulturellen Bruchstücken, die es von den Nachbarländern kopiert hat, seine Armee ist kaum vorhanden und so schwach wie ihr unfähiger König. Die wenigen Magier des Landes sind Blutjungen und ihre Magie das Einzige, was sie von anderen käuflichen Mördern unterscheidet. Fast alle stehen sie im Dienste einer Gruppe von Unterweltbossen, genannt der Sa’kagé. Die Macht des Sa’kagé ist größer als die des Königs, doch die Unterwelt kümmert sich nur um ihre eigenen Interessen und da gehört Außenpolitik nicht unbedingt dazu.
Das nördliche Nachbarland Khalidor dagegen wird von einem Gottkönig regiert, der zwar alt ist, aber dennoch die Absicht hat, zu seinen Lebzeiten noch den gesamten Kontinent zu erobern. Außerdem hat er es auf einen Ka’kari abgesehen, das sich in Cenaria befinden soll. Die Ka’kari sind mächtige, magische Artefakte, die sich an ihren Besitzer binden und ihm besondere Fähigkeiten verleihen.
Und im südlichen Nachbarland Modai gibt es scharenweise Magier, von denen drei beschlossen haben, sich in den Lauf der Geschichte einzumischen. Auch sie besitzen ein magisches Artefakt, das Schwert Curoch.
Damit hat sich die Ausarbeitung des Hintergrundes auch schon erschöpft. Zumindest vorerst. Wahrscheinlich hat der Autor sich die Details über das magische Schwert, den Verbleib der übrigen Ka’kari sowie die Vin, die die Magier Khalidors an ihren Armen tragen, für den nächsten Band aufgehoben.
Der Handlung hat das nicht geschadet, sie ist ohnehin voll gepackt bis zum Rand. Brent Weeks erzählt recht zügig. Nachdem Azoth erst geschafft hat, von Durzo als Lehrling angenommen zu werden, dreht der Autor an der Zeitschraube. Azoths Lehre wird großteils lediglich gestreift und fast fragt sich der Leser, warum der Autor manche Szenen überhaupt einflicht, sie scheinen keine wirklichen Auswirkungen auf die spätere Handlung zu haben. Tatsächlich dienen sie der Charakterzeichnung, der Gegenüberstellung von Azoth und Durzo, die zunächst grundverschieden scheinen.
Aber kaum ist Azoths Lehre so gut wie beendet, kommt der bis dahin nur angedeutete Plot in die Gänge und erstaunlich schnell zieht sich die Schlinge zu. Der Spannungsbogen strafft sich kontinuierlich Seite für Seite immer weiter, während der Leser Zeuge wird, wie Cenaria unaufhaltsam in die Katastrophe schlittert. Dabei hat Brent Weeks seine Geschichte so dicht geschrieben, dass sie sich kaum in einzelne Handlungsstränge unterteilen lässt, obwohl sie mal von Azoth, mal von Durzo, mal von den Magiern berichtet. Und genauso wenig lässt sich Azoths innere Entwicklung von den äußeren Ereignissen trennen, in die er hineingezogen wird.
Unterm Strich kommt ein Roman mit einer recht düsteren Grundstimmung heraus, der genauso durch seine gebeutelten, ums Überleben kämpfenden Charaktere getragen wird wie durch die massive Bedrohung von außerhalb; mit einem viel versprechenden Entwurf der Magie und einer ganzen Menge Rätsel, die noch zu lösen sind – wie zum Beispiel das um die Herkunft des Magiers Dorian -; mit einer Menge temporeicher Kampfszenen, aber auch mit einer Menge Brutalität und Blutvergießen. Wer es finster, actionreich und kämpferisch mag, ist hier auf jeden Fall richtig. Freunde weniger blutiger Spannung sollten sich die Lektüre vielleicht noch einmal überlegen.
Brent Weeks wollte schon als Junge Schriftsteller werden und hat sich deshalb nach dem Collage nicht mit dem Erlernen eines anderen Berufes aufgehalten, sondern gleich mit dem Schreiben begonnen. Bis jemand bereit war, ihm etwas dafür zu bezahlen, hielt er sich als Barkeeper über Wasser. „Der Weg in die Schatten“ ist seine erste Veröffentlichung und der Auftakt zur Schatten-Trilogie, deren zweiter Band unter dem Titel „Am Rande der Schatten“ im Juli 2010 in die Buchläden kommt. Der Autor schreibt derweil an seiner nächsten Serie, deren erster Band unter dem Titel „The Black Prism“ im August dieses Jahres auf Englisch erscheint.
Taschenbuch: 704 Seiten
Originaltitel: Night Angel 01. The Way of Shadows
Deutsch von Hans Link
ISBN-13: 978-3442266289
www.brentweeks.com
www.randomhouse.de/blanvalet
Der Autor vergibt: 



Ellies Laune ist absolut unterirdisch. Sie ist gerade von ihren Eltern gegen ihren Willen von Köln in die totale Prärie verpflanzt worden, ein Kuhdorf, in dem absolut nichts los ist und wo die Nachbarschaft fast ausschließlich aus Rentnern besteht. Nicht mal ihr Handy hat Empfang!
Gleich an ihrem ersten Wochenende in der neuen Umgebung muss sie sich von einem unbekannten Reiter aus einem Gewittersturm retten lassen. Allerdings ist der Kerl für einen ritterlichen Helden ganz schön ruppig. Die zweite Begegnung verläuft auch nicht gerade viel versprechend. Und doch fühlt Ellie sich von dem unnahbaren Typen angezogen. Als ihr Vater jedoch heraus findet, mit wem seine Tochter da im Begriff ist anzubandeln, schmeißt er ihn raus und verbietet Ellie jeden Kontakt, jedoch ohne ihr eine Antwort auf ihre Fragen zu geben. Wutentbrannt beschließt Ellie, die Antwort selbst herauszufinden. Und muss feststellen, dass nicht nur ihr Ritter ein Geheimnis hat …
Es dauert eine Weile, bis der Leser merkt, mit wem er es da eigentlich zu tun hat. Und das gilt weniger für den geheimnisvollen Colin, von dem Ellie so fasziniert ist, als vielmehr für Ellie selbst.
Wirkt sie zunächst noch wie eine vollpubertierende Großstadtzicke, die dumm genug ist, einen Waldspaziergang mit Stöckelsandalen zu versuchen und panische Angst vor Insekten, Spinnen und Pferden hat, so relativiert sich dieser Eindruck mit der Zeit immer mehr. Ihr Benehmen an der neuen Schule ist völlig verkrampft und spätestens beim ersten Besuch ihrer alten Freundinnen aus Köln zeigt sich, dass sie sich auch dort auf unnatürlichste Weise verrenkt hat. Je weiter sich die Geschichte entwickelt, desto mehr schält sich aus der hippen Schickimickitussi ein echter Charakter heraus. Und der ist gar nicht so übel.
Colin dagegen ist gerade wegen seines Geheimnisses ziemlich vorhersehbar geraten. Einzige Überraschung ist, dass er – dem Himmel sei Dank – kein Vampir ist! Ansonsten ist er, wie erwartet, sexy, gefährlich und einsam.
Eine weit größere Überraschung wiederum war Ellies Vater, dessen ungewöhnliche Arbeitszeiten zwar auffielen, den Leser aber kaum auf das vorbereiten, womit er letztlich konfrontiert wird, obwohl im Nachhinein betrachtet alles so wunderbar passt.
Den meisten Charakteren kann man nicht allzu viel Tiefgang bescheinigen. Abgesehen davon, dass Ellies Vater durch sein Geheimnis ein wenig aus der Reihe fällt, was sich jedoch hauptsächlich auf die Entwicklung der Handlung auswirkt und weniger auf die Figur als solche, sind Ellies Eltern vor allem besorgte Eltern. Mehr nicht, das dafür aber ziemlich gut. Colin ist zwar eindringlich und gut gezeichnet, verliert aber dadurch, dass er trotz der ausdrücklichen Distanzierung der Autorin von der derzeitigen Mode des Softievampirs doch ein wenig in genau dieses Klischee hinein gerutscht ist. Hervorragend gelungen fand ich dagegen Ellie. Ihre Entwicklung vom ängstlichen, unsicheren Mädchen hin zu einer selbstbewussten jungen Erwachsenen ist ausgesprochen gut gemacht.
Dazu trägt auch die sprachliche Gestaltung bei. Bettina Belitz schreibt durchaus junge Sprache, klingt aber niemals gekünstelt oder erzwungen jugendlich. Durch den trockenen Wortwitz, der immer wieder mal aus dem in Ich-Form erzählten Text heraus blitzt, wirkt die Hauptfigur Ellie, aus deren Sicht erzählt wird, zunehmend intelligent und sympatisch.
Die Stimmung innerhalb des Buches ist jedoch, von den erwähnten kurzen Funken Humors abgesehen, eher ernst, ja düster gehalten. Sie spiegelt Ellies Ängste wider, die sich nicht allein auf ihre Pferde- und Spinnenphobie beschränken oder darauf, dass sie fürchtet, nicht akzeptiert zu werden. Ellie ist überdurchschnittlich sensibel und spürt deutlich, dass sie, ja ihre ganze Familie anders ist. Die Nachbarn meiden die Familie, und sämtliche Jungs, die Ellie je mit nach Hause gebracht hat, schienen sich vor Ellies Vater zu fürchten wie die Maus vor der Schlange. Im Haus ist es niemals wirklich hell und freundlich, da beim ersten Sonnenstrahl sämtliche Vorhänge zugezogen werden, und ihre Ferien hat Ellie bisher stets am Rande des ewigen Eises verbracht statt am Mittelmeer.
Colin bildet den Anstoß zu Ellies Suche nach der Wahrheit, und obwohl diese Wahrheit sie durchaus erschreckt, scheint sie sich zunehmend besser zu fühlen. Gleichzeitig lüftet die Autorin auch Colins Geheimnis, allerdings ist es hier eher andersherum. Je mehr der Leser über Colin erfährt, desto mehr verschiebt sich der Schatten in dessen Richtung. Plötzlich ist Colin nicht mehr allein eine Gefahr, er ist auch selbst gefährdet.
Viel mehr, als dass Ellie einige Geheimnisse lüftet, tut sich letztlich gar nicht. Der größte Teil des Buches spielt sich zwischen den Charakteren ab: Zwischen Ellie und ihren Mitschülern, neuen wie alten; zwischen Ellie und ihrem Vater; und natürlich zwischen Ellie und Colin. Dieser Teil erzählt letzten Endes, wie Ellie ihre alles beherrschenden Ängste überwindet und endlich Selbstvertrauen entwickelt. Insofern ist dieses Buch geradezu ein psychologisches Buch, gekleidet in eine Mysteryromanze, als Zugeständnis an den Zeitgeist.
Ich fand das Buch klasse. Der intelligente Kern der Geschichte hebt es – trotz der klischeegefährdeten Figur des Colin – ein gutes Stück über das Gros der sonstigen seichten Teeniesoaps hinaus, wozu auch das angenehm kitschfreie Ende beiträgt. Dabei war es niemals langweilig, nirgendwo war ein erhobener Zeigefinger zu sehen. Es erzählt einfach nur glaubwürdig und ehrlich von der Emanzipation eines Mädchens von den Erwartungen ihrer Umgebung und seiner Selbstfindung. Die Mysterieverpackung ist dabei nur die Würze in der Suppe. Beides hat die Autorin ausgesprochen gut ausbalanciert und nahtlos miteinander verwoben, sodass trotz der Gegensätze zwischen Grundthema und Ausschmückung, zwischen Realität und Phantastik, das Ganze wie aus einem Guss wirkt.
Ausdrücklich lobend erwähnen möchte ich auch das ausgezeichnete Lektorat des Verlages. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir im Laufe des Buches auch nur ein einziger Fehler begegnet wäre!
Bettina Belitz war nach einem Germanistik- und Geschichtsstudium mehrere Jahre als Journalistin tätig, ehe jemand in ihrem Blog Auszüge aus ihren Büchern entdeckte. Seither arbeitet sie als freie Autorin. Ihre Hobbies Reiten und Gärtnern haben ebenso deutliche Spuren in „Splitterherz“ hinterlassen wie ihr Lebensumfeld Westerwald.
|Gebundene Ausgabe: 630 Seiten
ISBN-13: 978-3839001059
Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 16 Jahren|
http://www.splitterherz.com/
Die Magister-Trilogie:
Band 1: „Die Seelenjägerin“
Band 2: „Wings of Wrath“ (noch ohne dt. Titel)
Vor der Tür des Einsiedlers Aethanus steht ein junges Mädchen namens Kamala. Sie besteht darauf, von ihm zum Magister ausgebildet zu werden. Der Blick aus ihren grünen Augen ist so diamanthart, dass Aethanus sich überreden lässt. Tatsächlich gelingt ihr, was noch keiner Frau je gelungen ist. Doch das heißt noch lange nicht, dass sie sich auch unter all ihren männlichen Kollegen durchsetzen kann. Eine Einsiedelei ist nur eine unvollkommene Vorbereitung auf die Welt, und so verläuft gleich ihr erstes Zusammentreffen mit anderen Vertretern ihrer Zunft katastrophal …
Während am einen Ende des Kontinents die erste Magisterin der Geschichte ihre ersten Schritte tut, erleidet am anderen Ende Prinz Andovan, dritter Sohn des Großkönigs Danton, plötzlich Schwächeanfälle, ohne dass einer der vielen Ärzte eine körperliche Ursache dafür finden könnte. Ramirus, der Magister des Großkönigs dagegen weiß ziemlich genau, worum es sich handelt, und genau das ist sein Problem. Denn es handelt sich dabei um eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Magie überhaupt, was die Angelegenheit zu einer ziemlichen Zwickmühle macht. Doch noch ehe Ramirus eine Lösung für das Dilemma finden kann, nimmt der kranke Prinz die Sache selbst in die Hand, mit ungeahnten Folgen …
Der Titel lässt vermuten, dass das Buch Kamalas Geschichte erzählt. Das stimmt nur bedingt. Bei genauer Betrachtung stellt sich heraus, dass der Originaltitel – falls überhaupt – miserabel übersetzt wurde. Wörtlich übersetzt müsste er „Seelenschmaus“ lauten, was wohl nicht als verkaufsfördernd eingestuft wurde, den Inhalt aber wesentlich besser beschreibt.
Denn hier geht es um eine Art von Magie, die genau das tut: Sie verschlingt Seelen. Magie kann nur mit Hilfe von Athra gewirkt werden. Athra ist ein hübsches Wort für Lebensenergie oder auch für Seele. Die einfachen Hexen und Hexer verbrauchen ihre eigene Lebensenergie, wenn sie zaubern, deshalb altern sie alle vor ihrer Zeit und sterben früh. Die Magister haben sich damit offenbar nicht zufrieden gegeben, sie sind einen Schritt weiter gegangen und haben sich, nachdem sie ihre eigene Lebenskraft vollständig verbraucht haben, die Kraft einer fremden Seele unter den Nagel gerissen. Wobei es das nicht ganz trifft, denn die Magister saugen ihre Opfer nicht auf einmal aus wie ein Vampir. Man könnte sie eher mit Parasiten vergleichen. Wie ein Blutegel hängen sie sich an ihren Konjunkten und bedienen sich an seinem Athra. Dazu muss der Konjunkt nicht einmal in der Nähe sein. Tatsächlich weiß ein Magister in der Regel gar nicht, wer sein Konjunkt ist, und der Konjunkt weiß es erst recht nicht. Die wachsende Schwäche, die ihn mit der Zeit befällt, je nachdem, wie verschwenderisch der Magister Magie einsetzt, wird im Volk als unheilbare Krankheit betrachtet, die Schwundsucht genannt wird. Stirbt der Konjunkt, muss der Magister sich einen neuen suchen.
Das klingt nach Unsterblichkeit und tatsächlich sind einige Magister mehrere Jahrhunderte alt. Doch unverwundbar sind sie nicht, auch nicht außerhalb der Translatio, wie man den Wechsel eines Konjunkten nennt. Ein äußerst angenehmer Umstand, der dafür sorgt, dass die Magister weder allmächtig noch unbesiegbar sind.
Die Magister sind allerdings nicht die einzigen, die von der Seelenkraft ihrer Mitmenschen leben. Ikati, Ungeheuer mit hypnotischen Kräften, die wie überdimensionierte Libellen aussehen, nähren sich ebenfalls davon. Und obwohl man die Magister bezüglich der Ausbeutung ihrer Opfer wahrhaftig nicht als rücksichtsvoll bezeichnen kann, sind sie im Vergleich zu den Ikati geradezu fürsorglich. Ein Mensch, der einem Magister als Konjunkt dient, kann noch Jahre leben. Ein Mensch, der einem Ikata begegnet, ist so gut wie tot.
Gegen diese Ungeheuer hat die Menschheit bereits einen grausamen Krieg hinter sich, der nur durch die Selbstaufopferung zahlloser Hexen und Hexer gewonnen werden konnte. Wobei gewonnen relativ ist, denn die Ikati wurden nie vollständig ausgelöscht, sondern nur vertrieben, in die eisigen Gefilde des äußersten Nordens, wo seither die Protektoren und die Heiligen Hüter darüber wachen, dass keines jemals den Heiligen Zorn überschreitet, eine magische Grenze, die der Legende nach die Götter selbst errichtet haben. Doch dieselbe Legende besagt, dass die Ikati einst zurückkehren werden …
Die meisten Menschen glauben nicht mehr an diese Dinge. Königin Gwynofar jedoch ist in dem Glauben an die Wahrheit der alten Legenden erzogen worden und hat die Macht in den bizarren Felsnadeln, die man den Heiligen Zorn nennt, selbst gespürt. Die starke, aufrechte Frau ist überzeugt davon, dass die Legenden Recht haben, vorerst jedoch scheint alles in Ordnung. Bis ihr Sohn Andovan erkrankt und plötzlich alles aus dem Ruder läuft …
Andovan ist ein freundlicher junger Mann mit einem starken Drang zur Unabhängigkeit, der darauf besteht, sich ohne die Hilfe von Dienern anzuziehen und dem die Jagd wesentlich lieber ist als ein Thron. So froh er ist, dass er letzteren wohl niemals besteigen muss, da er ja noch zwei ältere Brüder hat, so unerträglich ist ihm der Gedanke, langsam dahin zu siechen und irgendwann hilflos im Bett zu verenden. Lieber will er gleich sterben.
Colivar hegt durchaus Sympathien für den jungen Prinzen, was ungewöhnlich ist, denn die meisten Magister blicken recht überheblich auf die Sterblichen herab. Auch im Gebrauch seiner Magie ist er bescheidener als manche anderen, die sie auch dazu benutzen, um möglichst eindrucksvoll zu wirken und ähnliches. Letztlich ist ihm aber nach einer Jahrhunderte umfassenden Lebensspanne genauso langweilig wie allen anderen Magistern. Wirklich reizen kann ihn außer dem rivalisierenden Gerangel mit Seinesgleichen nur noch das bisher nie Dagewesene … wie zum Beispiel ein weiblicher Magister! Und so entspringt seine Unterstützung für das Vorhaben Andovans eher egoistischen Motiven als echter Menschenfreundlichkeit, so wie er auch für Siderea Sympathie empfindet, sie aber im entscheidenden Augenblick im Stich lässt.
Siderea, die Hexenkönigin von Sankara, hat ihre Fähigkeiten kaum genutzt. Die verführerische Frau und gewiefte Politikerin hat panische Angst vor dem Tod, weshalb sie sich alles, was großen, magischen Kraftaufwand erfordert hätte, von Magistern hat abnehmen lassen, im Austausch gegen Informationen, an die sie Dank der strategischen Lage ihrer Stadt als dem Handelszentrum der Welt problemlos und in großem Umfang herankommt. Doch irgendwann geht auch einer Hexe, die ihre Kräfte nicht eingesetzt hat, das Athra aus …
Und dann ist da natürlich noch Kamala. Seit sie mit erlebt hat, wie eine Hexe für die Heilung von Kamalas kleinem Bruder mit dem Leben bezahlt hat, ist sie von dem Gedanken besessen, Magister zu werden und ihre Macht einsetzen zu können, ohne dafür mit dem Leben zu bezahlen. Die grausame Kindheit, die sie erlebt hat, hat sie auf eine Weise gehärtet, die sie tatsächlich zur Magisterin befähigt. Aber sie hat sich nicht durch die Wandlung zum Magister ablegen lassen und beeinflusst noch immer ihre Gefühle, Gedanken und Handlungen.
Bei so vielen zentralen Charakteren kann sich die Handlung natürlich unmöglich auf einen einzigen Strang konzentrieren. Flüchtig betrachtet sind es fünf, für jeden der genannten Charaktere einen. Bei genauerem Hinsehen stellt sich jedoch heraus, dass die Handlung nicht ganz so stark gesplittet ist.
Dass die Stränge von Kamala und Andovan miteinander verbunden sind, ist schon von Anfang an klar. Seltsamerweise allerdings kommt der Verbindung zwischen diesen beiden keine allzu große Bedeutung zu. Im Grunde spielt Kamala Andovan voll an die Wand. Was ihr widerfährt, ist wesentlich ausführlicher dargestellt als Andovans Erlebnisse. Letzten Endes zeigen aber auch sie lediglich, dass Kamala durch ihr Dasein als weiblicher Magister in jeder Hinsicht eine Außenseiterin geworden ist.
Viel bedeutsamer sind die Vorgänge, die durch Andovans Weigerung, sein Schicksal zu akzeptieren, ausgelöst wurden. Diese spielen sich allerdings unabhängig von dem ab, was um Kamala und Andovan herum geschieht. Aus der Sicht von Gwynofar erlebt der Leser mit, wie sich das Verhängnis im Schloss einschleicht, sich einnistet und immer weiter ausbreitet. Gwynofar scheint trotz ihrer inneren Stärke dagegen völlig hilflos.
Die Handlung um Colivar und Siderea ergänzt die Geschehnisse im Schloss durch die in der Außenwelt, die eine ebenso bedrohliche Entwicklung nehmen.
Celia Friedman hat ihren Plot langsam entwickelt. So langsam, dass ich mich anfangs etwas schwer tat, bei der Sache zu bleiben. Erst nach Kamalas erstem Zusammentreffen mit anderen Magistern nimmt die Handlung etwas mehr Fahrt auf. Von da an steigert sich die Spannung kontinuierlich. Die Bedrohung bleibt dabei vorerst noch gänzlich gesichtslos, denn der Antagonist besitzt keinerlei eigene Persönlichkeit und reicht deshalb nicht über seine Funktion als Bösewicht hinaus. Bis zum Ende des Bandes hat der Leser gerade mal erfahren, womit er es überhaupt zu tun hat, ja selbst das nur teilweise. Absichten und Motive des Gegners bleiben im Dunkeln. Das Ende selbst ist dann so dramatisch, dass ich mich an griechische Tragödien erinnert fühlte. Und der kurze Anflug von Triumph angesichts des besiegten Gegners, den der Leser vielleicht dabei empfunden haben mag, wird auf den letzten Seiten komplett zunichte gemacht.
Bleibt zu sagen, dass die Autorin nach einer längeren Anlaufzeit regelrecht zur Hochform aufgelaufen ist. Die Ausarbeitung der Charaktere fand ich sehr gelungen, selbst Nebenfiguren wie Kamalas Mentor und Ramirus waren gut getroffen und frei von Klischees. Die Handlung ist sauber aufgebaut und trotz der häufigen Sprünge nie unübersichtlich oder verwirrend. Der Plot ist vielschichtig und wenig vorhersehbar.
Allein der Entwurf der Magie hat, so interessant die Grundidee ist, einen logischen Haken: Denn wenn das Athra eines Menschen verbraucht ist, stirbt er. Das heißt, ein Magister, der diesen Zustand ja bewusst herbeigeführt hat, braucht das Athra seines Konjunkten nicht nur, um Magie zu wirken, sondern auch für ganz grundlegende Körperfunktionen wie Herzschlag und Atmung. Wenn also das Athra eines Konjunkten nicht mehr nur einen, sondern zwei Körper am Leben erhalten muss, dann ist es nicht möglich, daß Aethanus die Leben seiner Konjunkten durch sein Einsiedlerleben nur um wenige Wochen verkürzt. Eigentlich müsste es sich halbieren. Und auch das nur, wenn er gar nicht zaubert, ansonsten würde es noch kürzer.
Trotzdem bin ich neugierig auf den nächsten Band. Schließlich will ich wissen, wer wirklich hinter dem erneuten Auftauchen der Ikati steckt. Und ich will wissen, wie alt genau Colivar ist, der so erstaunlich viel über eine Vergangenheit weiß, an die selbst er sich eigentlich nicht erinnern können sollte.
Celia Friedman hat lange als Kostümbildnerin gearbeitet, ehe sie sich gänzlich dem Schreiben zu wandte. Zunächst schrieb sie Science Fiction, später auch Fantasy, darunter die Coldfire-Trilogie, die in der deutschen Übersetzung wieder mal zerpflückt und auf sieben Bände aufgeteilt wurde. Derzeit schreibt sie an einem weiteren Band zu diesem Zyklus. Der Magister-Zyklus soll ebenfalls drei Bände umfassen, der zweite erschien im November 2009 auf Englisch unter dem Titel „Wings of Wrath“.
Broschiert: 555 Seiten
ISBN-13: 978-3492701341
Originaltitel: Feast of Souls
Deutsch von Irene Holicki
//www.csfriedman.com
http://www.piper-verlag.de
Der Autor vergibt: 




Der alte Marthelm Hegendahl war bei seiner spießigen Verwandtschaft nicht besonders beliebt, sein Nachlass dagegen schon. Doch der einzige Verwandte, dem der wunderliche Alte etwas vermacht hat, ist ausgerechnet sein Großneffe Marian. Als dieser den dicken Umschlag öffnet, hält er nicht nur irgendein ekliges, muschelähnliches Ding in der Hand, sondern auch noch die Aufforderung, die Welt zu retten! Wovor und wie, das muss Marian erst noch heraus finden … und dafür hat er gerade mal zwei Wochen Zeit!
Marian ist in mancherlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Teenager. Welchem Fünfzehnjährigen ist es schon ehrlich egal, wenn Gleichaltrige ihn auslachen, weil er keine Markenklamotten trägt und nicht das neueste, superschicke Handy sein Eigen nennt. Noch weit ungewöhnlicher jedoch ist sein Interesse an Alchemie, Okkultismus und magischen Praktiken, und das nicht des Gruselfaktors wegen, sondern rein wissenschaftlich. Was bedeutet, dass er an nichts davon glaubt. Zumindest vorerst …
Auch Billa ist alles andere als gewöhnlich. Das junge Mädchen, das Marian am Wohnort seines verblichenen Uronkels kennen lernt, ist nicht einfach nur hübsch und keck. Sie hat etwas Ungezähmtes, Hitziges an sich, das Marian sowohl verwirrt als auch anzieht, außerdem neigt sie offenbar zu heftigen Stimmungsschwankungen.
Und dann wäre da noch Julian, der Lehrling des Apothekers, der bis über beide Ohren in die Tochter seines Lehrherrn verliebt ist. Der Bursche ist zwar mutig bis zum Leichtsinn, aber gleichzeitig auch naiv und gutgläubig, ja fast ein wenig dumm.
Damit hat sich die Charakterzeichnung auch schon erschöpft. Andreas Gößling hat sich bei der Darstellung seiner Figuren auf das für die Handlung absolut Notwendige beschränkt. Marian scheint außer seinem Faible für Übernatürliches keinerlei andere Interessen zu haben, weder Musik noch Sport oder etwas in der Art, seine Wünsche für die Zukunft werden lediglich in einem einzigen Satz kurz erwähnt. Ähnliches gilt für Billa, die nichts anderes als ihren verschwundenen Zwillingsbruder Jakob im Kopf zu haben scheint. Selbst der Antagonist zeichnet sich allein durch eine typische Eigenschaft eines Bösewichts aus, nämlich Machtgier. Das fand ich – vor allem nach Gößlings „Faust, der Magier“ – sehr enttäuschend!
Zum Glück ist die Handlung etwas interessanter ausgefallen. Marian hat nämlich nicht nur das Rätsel um den drohenden Weltuntergang zu lösen, sondern auch das um Billa. Letzteres ist wesentlich einfacher zu lösen, denn schließlich ist er ja, was Magie betrifft – zumindest in der Theorie – , nicht ganz unbedarft, und der Schlüssel zur Lösung des Rätsels sitzt direkt vor ihm.
Das Erstere dagegen ist genau dreihundertdreiunddreißig Jahre und neun Tage alt! Die Hinweise seines Urgroßonkels sind ausgesprochen spärlich, und obwohl Marian die Bibliothek des Verblichenen zur Verfügung steht, findet er dort nichts, das ihm weiter helfen würde, vor allem deshalb, weil das meiste sowohl in alten Sprachen wie Latein oder Hebräisch abgefasst als auch verschlüsselt ist. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als direkt in der Vergangenheit zu suchen.
Das wichtigste Hilfsmittel hierfür ist das muschelähnliche Ding, das der alte Marthelm ihm vermacht hat. Er nannte es ein Talmibro. Durch Zufall findet Marian heraus, dass er damit seinen Geist in genau die Zeit zurück schicken kann, aus der der Fluch stammt, den er aufhalten soll. Dumm nur, dass er dabei so gut wie keine Einflussmöglichkeit besitzt, denn er steckt dort im Körper eines Apothekerlehrlings namens Julian fest …
Abgesehen davon, dass der Autor seine Geschichte auf zwei Zeitebenen verteilt hat, hat er sie auch noch mit allerhand düsterem Beiwerk ausstaffiert.
Da wären zum Einen die Mitglieder einer Freimaurer-Loge, die Marian zwar jederzeit einlassen, ihm aber strickt verbieten, sich frei im Haus zu bewegen. Trotzdem bekommt Marian mit, dass die alten Herren im Keller einiges mauscheln … ausgerechnet im Keller!
Zum Anderen hat Gößling seiner Geschichte ein paar äußerst unangenehme alte Damen angedeihen lassen, die nicht nur Billa ausgesprochen biestig behandeln, sondern so ziemlich jeden, dem sie begegnen. Von ihren seltsamen Praktiken draußen im Moor mal ganz abgesehen.
Dazu kommt noch ein verzauberter Wald, der selbst bei Windstille ächzt und stöhnt und einen so schlechten Ruf hat, dass man ihn komplett eingezäunt hat. Nicht, dass wirklich jemand wüsste, wie es dort drin aussieht, denn es traut sich keiner rein. Wer allerdings aus Versehen dort hinein gerät, kommt in der Regel nur in geistig verwirrtem Zustand wieder raus.
Auch die übrige Umgebung wirkt höchst schauerlich: Drückende Hitze, Moor, abgestorbene Bäume, dichter, gelber Dunst, der nach Schwefel riecht. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass es dort einen Badesee geben sollte, an dem man es tatsächlich aushalten kann.
Im Vergleich zu all dem wirkt Marthelms alter Freund Hanno Bußnitz, der grässliche Schreie auf Tonband sammelt und Baumsärge ausgräbt, um die darin enthaltenen Moorleichen in seinem Backofen zu konservieren, richtig knuffig!
Insgesamt ein sehr gelungenes Szenario, von dessen Intensität ruhig ein gut Teil auf die Charaktere hätte abfärben dürfen.
Aber trotz des gelungenen Hintergrunds und des sauberen Handlungsaufbaus bin ich mit dem Buch nicht recht warm geworden. Vielleicht lag es daran, dass die beiden Zeitebenen sprachlich so unterschiedlich sind. Der Wechsel zwischen moderner Jugendsprache und altmodischer Ausdrucksweise ist zwar eigentlich nur konsequent, ich empfand ihn aber trotzdem als störend. Vielleicht lag es auch daran, dass mir ein Sympathieträger fehlt. Der blasse Marian ist einfach kein ausreichender Ausgleich zu dem gefühlstoten Hexenmeister, den grässlichen alten Weibern und dem unheimlichen Wald.
Auch logische Brüche sind mir aufgefallen. Wie sollten zum Beispiel die alten Weiber an eine Babylocke von Billa gekommen sein, selbst wenn sie tatsächlich ihr Vorhaben so weit im Voraus geplant hätten? Und wieso hat der Bösewicht ausgerechnet Julian geschickt, um die Golems zu holen, wo diese dem Lehrling doch überhaupt nicht gehorchen dürften, weil er nicht an ihrer Erschaffung beteiligt war?
Das Ende gibt der Geschichte schließlich den Rest. Obwohl durchaus überraschend, wird der Plot dadurch auf eine Weise in sich verkehrt, die ihn letzten Endes unwahrscheinlich macht. Denn um einen solchen Plan zu entwickeln, hätte der Planer ein Zeitzeuge sein müssen, sonst hätte er nichts von dem Lehrling Julian wissen können, der für die Durchführung des Planes absolut unverzichtbar ist.
Unterm Stich bleibt also nicht viel mehr übrig als der stimmungsvolle und gelungene Hintergrund für die Geschichte sowie der magische Aspekt. Die Charakterzeichnung bleibt nicht nur weit hinter meinen Erwartungen sondern auch weit hinter der Ausarbeitung des Schauplatzes zurück, und die im Grunde interessante Handlung wird letztlich dadurch verdorben, dass mit Gewalt ein überraschender Schluss erzwungen und der Plot dadurch ad absurdum geführt wird.
Schon allein deshalb finde ich dieses Buch nicht wirklich empfehlenswert, noch gewagter erscheint mir allerdings, dass das Buch als Jugendbuch ab 12 Jahre ausgewiesen ist. Mag ja sein, dass die heutige Jugend bereits ziemlich hart gesotten ist, aber was Marian da auf dem Weg zum Drachenmaul so alles über den Weg läuft, ist schon starker Tobak. Da muss der junge Mensch schon ein echter Horrorfan sein, um damit glücklich zu werden.
Andreas Gößling ist promovierter Literatur- und Kommunikationswissenschaftler und äußerst bewandert in Mythen und Kulturgeschichte. Außer diversen Sachbüchern in diesem Bereich hat er auch einige Romane geschrieben, darunter „Der Alchimist von Krumau“, „Die Mayapriesterin“ und „Der Sohn des Alchemisten“. Sein neuestes Werk „Opus – Das verbotene Buch“ kam Mitte Februar 2010 in die Buchläden.
|Taschenbuch: 512 Seiten
ISBN-13: 978-3570304914
Vom Hersteller empfohlenes Alter: ab 12 Jahre|
http://www.andreas-goessling.de
_Andreas Gößling beim Buchwurm:_
[Faust der Magier 3904
[Die Freimaurer. Weltverschwörer oder Menschenfreunde? 4791
Johannes Cabal hat ein Problem: Für das Wissen über die Kunst der Nekromantie hat er dem Satan seine Seele überlassen. Jetzt will er sie zurück haben und geht dafür sogar bis in die Hölle. Nur leider verläuft sein Handel mit dem Satan überhaupt nicht so, wie Johannes sich das vorgestellt hat, und als er die Hölle wieder verlässt, ist es ausgesprochen zweifelhaft, ob er nun besser dran ist als zuvor. Doch er ist entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen, Realist genug, um zu erkennen, dass er Hilfe braucht, und verzweifelt genug, um ein hohes Risiko einzugehen …
Jonathan Howards Protagonist ist ein komischer Vogel. Einerseits wirkt er steif und strohfad, er hasst Jahrmärkte, Tanz und alles, was sonst so mit Vergnügen zu tun hat. Er bezeichnet sich selbst als Wissenschaftler, ist stolz auf seinen scharfen Verstand und betrachtet alles Gefühlsmäßige, besonders die Liebe, mit einer gewissen hochmütigen Verachtung. Gleichzeitig blitzt immer wieder sowas wie Menschlichkeit in ihm auf, dass man meinen könnte, der Bursche hat zwei Seelen in seiner Brust, obwohl er natürlich zur Zeit überhaupt keine hat, was seine Anflüge von Humanität nur noch seltsamer erscheinen lässt.
Sein Bruder Horst ist das ganze Gegenteil von ihm, ein wenig unstet und er bringt so gut wie nie etwas Angefangenes zu Ende. Aber er ist lebenslustig, charmant und kann hervorragend mit Menschen umgehen. Vor allem aber ist er mitfühlend und freundlich und fungiert in dieser Rolle als Johannes‘ Gewissen, was wiederum etwas verdreht anmutet, denn Horst ist ein Vampir …
Satan dagegen hat – von seinem Äußeren abgesehen – nicht viel Satanisches an sich. Natürlich ist er boshaft, falsch und grausam, aber nur ein ganz klein wenig. Die meiste Zeit wirkt er wie eine Mischung aus Gangsterboss und schlauem Bäuerlein, wobei der Gangster überwiegt. Satan gibt sich jovial und einigermaßen umgänglich, mit einer Prise unterschwelliger Drohung und kaum verhohlener Hinterlist.
Und dann ist da auch noch Frank Barrow, der moralische und prinzipientreue Polizist im Ruhestand, der noch immer eine ausgezeichnete Nase dafür hat, wenn irgendwo etwas nicht stimmt. In seiner Unbeirrbarkeit, die sich selbst durch Horsts Charisma nicht irritieren lässt, hat er etwas von einer Bulldogge, wenn sie sich irgendwo fest gebissen hat.
Mir hat die Charakterzeichnung ausnehmend gut gefallen. Zum Einen, weil sie so menschlich ist, vor allem in Bezug auf Johannes mit seinen vielen Widersprüchen. Zum Anderen, weil der Autor so vieles einfach in sich verkehrt hat, wie bei Horst, dem anständigen und menschenfreundlichen Vampir. Selbst Barrow wirkt trotz seiner moralischen Grundsätze niemals klischeehaft, was vor allem an seinem kläglichen Versuch liegt, seiner Tochter Leonie seine Bedenken im Hinblick auf Cabal begreiflich zu machen.
Auch die Handlung als solche hat mir sehr gefallen. Einhundert Seelen muss Johannes im Austausch für seine eigene sammeln, was schon anstrengend genug ist. Zu allem Übel bekommt er als Hilfsmittel ausgerechnet einen Jahrmarkt aufgedrückt, wo er solcherlei doch als völlige Zeitverschwendung ansieht. Jetzt muss er sich also nicht nur mit etwas herum schlagen, was er verabscheut und wovon er keine Ahnung hat, sondern auch mit Helfern, über deren Dummheit man Haarausfall bekommen könnte! Ob er allerdings mit den schlaueren Helfern besser dran ist? Schließlich stammen die aus der Hölle …
Obwohl sich das Ganze zunächst recht gut anlässt, ist natürlich abzusehen, dass es nicht so bleiben wird. Satan wäre schließlich nicht Satan, wenn er die Spielregeln nicht auf seine eigene Art auslegen würde.
Abgesehen von den diversen Turbulenzen, die Cabals Jahrmarkt ihrem Gegenspieler aus der Hölle zu verdanken hat, glänzt das Buch aber auch noch – gänzlich frei von erhobenen Zeigefingern – durch Einblicke in die menschliche Natur, teils ernsthafte, wie im Zusammenhang Ted und Rachel oder mit Nea Winshaw, teils augenzwinkernde, wie bei Johannes‘ Einladung ins Abnormitätenkabinett.
Und dazu kommt noch eine wahre Flut von Anspielungen und ironischen Seitenhieben in alle möglichen Richtungen. Die Bürokratie bietet sich da natürlich besonders an, was zu der ungemein treffsicher skizzierten und ausgesprochen drolligen Figur von Arthur Trubshaw geführt hat.
Ein weiteres Highlight ist die Abrechnung mit den Managern dieser Welt. Und auch der Cthulhu-Mythos bekommt kräftig sein Fett weg, was angesichts der Tatsache, dass die erste Geschichte über Johannes Cabal in Lovecrafts Magazine of Horror erschienen ist, schon wieder selbstironische Züge trägt.
Heraus gekommen ist bei all dem eine knallbunte Mischung aus einer Studie menschlicher Schwächen und schrägem Humor, gewürzt mit einem kleinen Geheimnis und einer Prise Spannung. Der Autor hat dabei jederzeit gekonnt die Balance gehalten und die Übergänge zwischen abgedrehtem Witz und den ernsthafteren Tönen glatt und fließend gestaltet. Mit seinem etwas widersprüchlichen Protagonisten hat er eine Figur geschaffen, die trotz ihrer spröden, fast menschenfeindlichen Art ein hervorragender Sympathieträger ist. Tatsächlich ist Johannes Cabal, dem der Rest der Welt eigentlich egal ist, der aber dennoch immer wieder Anflüge von Güte zeigt und dessen Zwiespalt mit fortschreitender Handlung immer deutlicher, immer tiefer wird, der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Geschichte, um den herum das schmückende und das entlarvende Beiwerk drapiert ist.
Keine ausgeklügelten Intrigen, keine Kriege, keine detailliert ausgearbeitete, eigene Fantasywelt, und weder eine Vielzahl an Charakteren noch an Handlungssträngen. Und dennoch habe ich dieses Buch regelrecht verschlungen und dabei sowohl nachdenklich genickt, als auch mich köstlich amüsiert. Obwohl Jonathan Howard sich nicht die Mühe gemacht hat, etwas neu zu erfinden, enthält dieses Buch Witz, Esprit und Fantasie satt. Ich habe jede Seite genossen.
Jonathan L. Howard lebt in Bristol ist seit 1990 ein fester Bestandteil in der Branche Computerspiele, außerdem schreibt er Drehbücher. 2005 erschien seine erste Kurzgeschichte „Johannes Cabal and the Blustery Day“, und nach einer weiteren Kurzgeschichte folgte der erste Band einer Romanreihe über seinen ungewöhnlichen Helden. Der zweite Band des Zyklus mit dem Titel „Ein Fall für Johannes Cabal: Totenbeschwörer“ ist für September 2010 angekündigt.
|Taschenbuch: 384 Seiten
ISBN-13: 978-3442469963
Originaltitel: Johannes Cabal the Necromancer – Trilogie Band I
Deutsch von Jean-Paul Ziller|
http://www.johannescabal.com/
Mercy ist verwirrt. Dass sie Geister sehen kann, ist nichts Neues für sie, doch der Geist der jungen Frau unter dem Eis in dem kleinen Teich begegnet ihr zum ersten Mal. Und sie hat beim Aufwachen ein Schneeglöckchen auf ihrem Kopfkissen gefunden! Als sie schließlich in der Familienkapelle auch noch auf einen jungen Mann trifft, der ihr irgendwie bekannt vorkommt, ist klar: Etwas verändert sich. Und Mercy ist sich keineswegs sicher, ob sie sich darüber freuen soll …
Die Geschichte wird lediglich von einer Handvoll Charaktere getragen:
Zunächst ist da natürlich Mercy. Ein brummiges Mädchen mit überbordender Fantasie, das gerne liest, nicht besonders gut zeichnen kann und das seine Gouvernante nicht besonders mag. Und ein Mädchen mit Mut und Durchsetzungsvermögen, das, nachdem es erst einmal Wind von etwas bekommen hat, keine Ruhe gibt, bis es der Sache auf den Grund gegangen ist.
Charity ist impulsiv und redselig, nicht so neugierig wie ihre große Schwester, doch sie besitzt ebenfalls eine gehörige Portion Mut und einen kindlichen Charme, mit dem sie ihre Gouvernante regelmäßig um den Finger wickelt.
Die Gouvernante Galatea ist eine Verwandte der beiden Mädchen, groß und hager und selbst zu Zeiten, in denen Mercy noch gehorsam und still ist, wirkt sie etwas biestig. Als Mercy beginnt aufzubegehren, wird sie regelrecht zur Furie. Gleichzeitig ist sie dem Herrn des Hauses unendlich treu ergeben und stellt keine einzige seiner Anweisungen jemals in Frage.
Der Herr des Hauses ist Mercys Vater, ein im Grunde freundlicher, aber gebrochener Mann, der sich irgendwo im Haus vergräbt und sich so gut wie nie bei seinen Töchtern blicken lässt. Auch das ändert sich, als Mercy ihren Gehorsam aufkündigt. Plötzlich isst der Vater zusammen mit den Kindern, er beordert Mercy immer wieder zu sich, um ihr ins Gewissen zu reden, doch da er ihr seine Gründe nicht erklären will, sind seine Versuche von wenig Erfolg gekrönt.
Und dann ist da noch Claudius, der junge Mann aus der Kapelle, der Mercy dazu ermutigt, Fragen zu stellen und nach der Wahrheit zu suchen. Von ihm erhält Mercy wesentlich mehr Antworten als von ihrem Vater, aber … meint Claudius es wirklich ehrlich?
Die Charakterzeichnung ist einerseits sehr gut gelungen. Mit Ausnahme von Galatea, die stellenweise ein wenig ins Klischee der Fräulein Rottenmeier abzudriften droht, sind die Figuren erfreulich eigenständig. Leider mangelt es ihnen ein wenig an Tiefe. Außer Mercys wachsendem Freiheitsdrang und Lebenswillen gibt es nichts, was das Mädchen besonders auszeichnen, sie zu einer eigenständigen und unverwechselbaren Persönlichkeit machen würde, sie bleibt austauschbar. Das gilt noch mehr für Charity. Und auch der Vater und Claudius kommen nicht über Nachvollziehbarkeit hinaus, es fehlt ihnen an Intensität.
Das ist sehr schade, denn das Buch lebt von den Charakteren und ihren Beziehungen untereinander. Die Langlebigkeit und die magischen Fähigkeiten von Claudius, Mercy und ihrem Vater sind die einzigen Aspekte, die die Geschichte in den Bereich der Fantasy rücken, ansonsten handelt es sich hier eher um ein Familiendrama. Mercy, angestupst von Claudius, versucht herauszufinden, warum es auf dem Familiensitz Century niemals Frühling wird, warum das Leben der Familie sich nachts abspielt und nicht tagsüber, und was wirklich mit ihrer Mutter geschehen ist. Ihre wachsende Neugier verdrängt bald ihre anfängliche Angst und das Misstrauen gegen Claudius. Dieses Stöbern in der Vergangenheit ist hervorragend gemacht, Schicht für Schicht dringt Mercy immer weiter vor und eine Schlüsselszene nach der anderen enthüllt wie eine sich öffnende Blüte, wie und warum es zu der seltsamen Lebenssituation kam, in der sich Mercy und ihre Familie befinden.
Leider fehlt es der Geschichte trotz der faszinierenden Idee und des sorgfältigen Aufbaus an Flair. Nicht, dass ich das Buch langweilig gefunden hätte, im Gegenteil. Ich war ausgesprochen neugierig darauf, was Mercy auf ihrer Suche wohl herausfinden wird. Nur hat die Autorin ihren ausgesprochen interessanten Inhalt in etwas blasses Papier verpackt. Der Hintergrund der Geschichte, die Familie Verga und ihr Anderssein, sind lediglich grob angerissen, die Geschichte selbst ist recht zügig und straff erzählt und lässt ebenso wenig Raum für Stimmung wie für die Entfaltung und Vertiefung ihrer Charaktere. Hier hätte ich mir anstelle der raschen Entwicklung etwas mehr Verweilen und ein paar zusätzliche Details gewünscht. Das gilt zum Beispiel für Mercys Flucht aus der Dienstbotenkammer, die auf dem Dachboden endet. Leider geht die Autorin auf diesen spannenden Ort weniger genau ein als auf den nicht allzu fesselnden Kaminschlot. Das Augenmerk liegt eindeutig auf dem Fortschreiten der Handlung, nicht auf der Ausstattung. Schade, denn damit hat die Autorin eine Menge Potential verschenkt, obwohl bei nur knapp dreihundert Seiten noch genug Platz gewesen wäre.
Alles in allem empfand ich Sarah Singletons Jugendbuch-Debut als ausgefallene, intelligente Geschichte, die fesselt, aber nicht verzaubert. Dennoch finde ich das Buch empfehlenswert. Es bietet keinen besonderen sprachlichen Schliff, aber ein sorgfältig verborgenes Geheimnis, das angenehm aus den Massen an Fantasy-Einerlei herausfällt und in seiner Entwicklung nicht so vorhersehbar ist. Auch dürfte die Thematik, der Umgang mit Schmerz und Verlust und die Flucht vor sich selbst, gerade für Jugendliche interessant sein, wobei die Umsetzung wohl hauptsächlich Mädchen ansprechen dürfte.
Sarah Singleton hat einen Universitätsabschluss in Literaturwissenschaften und ist nach diversen Reisen durch Europa und Asien sowie diversen Tätigkeiten, unter anderem als Zimmermädchen, beim Journalismus hängen geblieben. Außer ihrem Jugendroman „Das Haus der kalten Herzen“, für das sie mit dem Booktrust Teenage Prize ausgezeichnet wurde, hat sie diverse Kurzgeschichten geschrieben. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Töchtern in Wiltshire.
|Taschenbuch: 288 Seiten
ISBN-13: 978-3570306475
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 12 – 13 Jahre
Originaltitel: Century
Deutsch von Catrin Fischer|
http://www.crowmaiden.plus.com/
Die Chronik der Weitseher
Band 1: „Der Weitseher“
Band 2: „Der Schattenbote“
Band 3: „Der Nachtmagier“
Fitz hat überlebt, aber nur Dank der alten Macht und der Hilfe von Burrich und Chade. Und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Nur langsam findet er zu sich selbst zurück, und eines der ersten Dinge, die er tut, nachdem er seine Erinnerungen wiedergefunden hat, ist, sich von Burrich und Chade zu lösen. Statt weiterhin ganz und gar im Dienst für seinen König aufzugehen, will er sein eigenes Leben leben, selbst wenn es nur ein kurzes sein sollte. Denn der einzige, brennende Wunsch, der ihn jetzt noch beseelt, ist, Edel zu töten, koste es, was es wolle!
Von den neuen Charakteren, die in diesem Band noch auftauchen, sind zwei von größerer Bedeutung:
Zum Einen ist da Merle, eine fahrende Sängerin. Sie betreibt ihre eigene Art von Altersvorsorge, indem sie sich auf die Suche nach einem großen Lied begeben hat. Nur der Ruhm, Zeuge großer Ereignisse gewesen und als erste ein Lied darüber gedichtet zu haben, wird ihr im Alter irgendwo einen Platz als Hofsängerin sichern. Sie wittert ihre Chance, als sie Fitz‘ Tarnung durchschaut, und so verrät sie ihn nicht, sondern heftet sich an seine Fersen. Was nicht heißen soll, dass sie Fitz nicht mag …
Außerdem trifft Fitz im Laufe seiner Reise auch noch auf Krähe, eine alte Frau, die ebenfalls aus dem Herzogtum Bock stammt. Doch Krähe ist ausgesprochen zugeknöpft, außerdem schroff und ruppig, aber auch erstaunlich zäh für ihr Alter. Und sie scheint erstaunlich viel über die Gabe zu wissen, zumindest mischt sie sich überall ein und gibt gute Ratschläge oder verteilt Rüffel. Fragen weicht sie jedoch regelmäßig aus, was Fitz mit der Zeit zur Weißglut bringt.
Man kann nicht behaupten, dass diese beiden neuen Figuren besonders tiefgründig geraten wären, aber immerhin haben sie eine Vergangenheit und auch Hoffnungen und Träume, und sie sind frei von Klischees. Das lässt sie lebendiger wirken, als es manche Hauptperson von sich sagen kann.
Die Handlung erschien mir diesmal fast ein wenig langatmig. In aller Ausführlichkeit schildert Robin Hobb, wie Fitz sich auf seine Reise nach Farrow vorbereitet, dann den Aufbruch immer wieder verschiebt und sich letztlich doch auf den Weg macht. Ebenso ausführlich erzählt sie von der Reise selbst und wie die Reise plötzlich zur Flucht wird. Manche Abschnitte sind gut gemacht, so zum Beispiel Fitz‘ Zerissenheit in Bezug auf Molly, von der er immer wieder Gabenträume hat, gegen die er sich einerseits wehrt, weil sie Edels Zirkel zu ihr führen könnten, die er andererseits aber auch nicht missen möchte, weil er sich immer noch nach Molly sehnt. Auch die Szene im Palast von Fierant fand ich sehr gelungen. Manche Details auf der Reise dagegen hätten wie gesagt ein wenig Straffung vertragen.
Dem eigentlichen Kern der Geschichte nähert sich die Autorin erst wieder, als Fitz ins Bergreich gelangt und sich endlich auf die konkrete Suche nach Veritas macht. Auch diesen Teil fand ich wieder etwas durchwachsen. Die vielen Gespräche mit dem Narren und auch die Andeutungen Krähes bringen die Lösung kein Deut näher, ihr einziger Effekt ist, dass ich Fitz‘ Gereiztheit irgendwann verstehen konnte. Der Showdown legt dann wieder etwas an Tempo zu, die endgültige Konfrontation mit Edel dagegen empfand ich fast als ein wenig schwach und unspektakulär, sodass ich mich am Ende fragte, warum das nicht schon viel früher jemand versucht hat!
Dazu kommt, dass die Erklärung für das Verhalten der roten Korsaren einen logischen Bruch enthält. Denn die roten Korsaren verwenden dasselbe Material, aus dem die Drachen erschaffen werden, um Menschen zu entfremden. Das dürfte meiner Ansicht nach aber gar nicht funktionieren, denn die Städte der Uralten waren ebenfalls aus diesem Material erbaut, was bedeuten würde, dass sämtliche Einwohner dieser Städte nach und nach hätten entfremdet werden müssen. Das war aber offensichtlich nicht der Fall. Auch fragte ich mich, warum man zum Erwecken eines alten Drachen die Alte Macht benötigt, wenn die Drachen doch eigentlich mit der Gabe geschaffen wurden.
So ist dieser letzte Band doch ein klein wenig hinter seinen beiden Vorgängern zurück geblieben. Die Handlung selbst ist nicht schlecht und bietet auch einige Höhepunkte, wäre aber mit neunhundert statt tausendzweihundert Seiten besser ausgefallen. Die Idee der Drachen und ihrer Belebung ist durchaus interessant, aber nicht ganz konsequent durchdacht.
Der Zyklus insgesamt gehört jedoch definitiv zu den besten im Genre der Fantasy. Robin Hobb erzählt flüssig und bildreich und ihre Figuren bleiben jederzeit menschlich, anstatt zu Überhelden zu werden.
Das Lektorat, das in den ersten beiden Bänden noch einige Schnitzer übersehen hat, war im letzten und längsten der drei Bände dann erstaunlich fehlerfrei. Die Karte im Umschlag ist nicht allzu ergiebig, hätte sie gefehlt, ich hätte sie nicht vermisst.
Robin Hobb war bereits unter dem Namen Megan Lindholm eine erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, ehe sie mit der Weitseher-Trilogie erfolgreich ins Genre der Fantasy einstieg. Neben dem bereits erwähnten Zyklus der Zauberschiffe stammen aus ihrer Feder Die zweiten Chroniken von Fitz, dem Weitseher und die Nevare-Trilogie, sowie unter dem Namen Megan Lindholm der Windsänger– und der Schamanen-Zyklus. Derzeit schreibt sie an ihrem neuen Zyklus The Rain Wild Chronicles, dessen erster Band unter dem Titel „Dragon Keeper“ im Juni 2009 auf Englisch erschienen ist. Sie lebt mit ihrem Mann in Tacoma/Washington.
Taschenbuch: 1181 Seiten
Originaltitel: The Assassin’s Quest
Deutsch von Eva Bauche-Eppers
ISBN-13: 978-3453525214
http://www.robinhobb.com/index.html
http://www.randomhouse.de/penhaligon/index.jsp
Der Autor vergibt: 




Rika kommt von der Schule nach Hause und findet an Stelle ihres Zuhauses nur rauchende Trümmer vor. Jixur haben die Pferdefarm überfallen, ihren Vater und seine Knechte getötet und sämtliche Pferde weg getrieben. Verzweifelt reitet das junge Mädchen in den nächstgelegenen Ort, um den Bürgermeister aufzusuchen, von dem sie erfährt, dass der Überfall auf den Hof ihres Vaters nicht der erste dieser Art war. Und prompt findet sich das überraschte Mädchen am nächsten Tag auf dem Weg in die Provinzhauptstadt wieder, wo sie um Verstärkung bitten soll. Der Beginn einer Odyssee …
Rika ist ein recht burschikoses junges Mädchen, das eine Menge seiner Zeit damit verbringt, sich aufregende Abenteuer auszudenken, in denen sie die Hauptrolle spielt. Die Realität ernüchtert sie schnell und ihre Abenteuerlust wird von Rachedurst verdrängt. Doch Rika hat auch immer wieder Alpträume, und das nicht nur Nachts, und diese Alpträume entwickeln mit der Zeit recht bedrohliche Nebenwirkungen. Irgendetwas scheint mit dem Mädchen nicht so ganz zu stimmen.
Micael, der junge Bursche, der es sich in den Kopf gesetzt hat, Rika zu begleiten in der glühenden Hoffnung, vom Herzog in die Armee aufgenommen zu werden, hat eine ziemlich große Klappe und glaubt, alles zu wissen. Ein Großteil davon sind allerdings Vorurteile, und davon, dass ein Soldat den Befehlen eines Vorgesetzten zu gehorchen hat, scheint er auch noch nie gehört zu haben. Zwar ist er mutig und nicht ungeschickt, doch es fehlt ihm an Selbstkontrolle. In seiner Naivität scheint er das Soldatenleben als eine ununterbrochene Abfolge erfolgreich bestandener Abenteuer zu betrachten, und als die Realität ihn einholt, kommt er kaum klar damit.
Shoran dagegen ist ein ausgebildeter Kämpfer und hat eine Kindheit hinter sich, die ihm einiges mehr an Lebenserfahrung beschert hat als dem behütet aufgewachsenen Micael. So kommt es, dass Shoran ständig mit dem unreifen Jungen und seinen beleidigenden Vorurteilen in Klintsch liegt. Aber auch Rika scheint der Krieger gerne zu necken, er ist eigentlich fast niemals wirklich ernst, es sei denn, es droht Gefahr. Und er hütet ein Geheimnis …
Der Anführer der Jixur, Sarrias, wiederum fühlt sich gar nicht wohl in seiner Haut. Die „Halbe“, wie die Jixur die Menschen nennen, hat er zwar selber aufgezogen, doch dass sie ständig mit dem Oberhaupt seiner Herde Pläne ausheckt, ohne ihn einzubeziehen, und dass sie ihm teilweise in seine Befehlsgewalt über die Krieger drein redet, stört ihn gewaltig, und das nicht nur, weil es seine Autorität untergräbt, sondern auch, weil es allen althergebrachten Verhaltensweisen seiner Art widerspricht. Sein Instinkt sagt ihm, dass mehr dahinter steckt, als die Halbe offenbart …
Die Charakterzeichnung hat mich nicht überzeugt. Am gelungensten fand ich eigentlich den greisen König von Craiglin mit seinem an Verfolgungswahn grenzenden Misstrauen gegen das Nachbarland der Thäler, seiner mürrischen Laune und seinem Altersstarrsinn. Dabei ist dieser Mann kaum eine eigene Persönlichkeit, sondern eher ein für den Plot unentbehrliches Objekt. Die Hauptperson Rika dagegen empfand ich als ausgesprochen blutleer. Zwar wird kurz erwähnt, dass sie als einzige den weicheren Kern ihres mürrischen, verbitterten Vaters kennt, bei dem es kein Knecht lange aushält, eine wirklich enge Verbindung zwischen den beiden, die Rikas Rachsucht erklären würde, zeigt sich jedoch nirgends. Andererseits kommt Rikas Rachsucht ebenso fad daher wie der Rest des Mädchens, allein Micaels Schicksal scheint sie zumindest kurzzeitig zu kümmern. Gleiches gilt für die „Halbe“ namens Millayn, deren Motive ich zwar mit dem Kopf nachvollziehen, aber nicht nachfühlen konnte.
Ähnliches gilt für den Hintergrund.
Die Autorin liefert zu Beginn des Buches einen kurzen Schöpfungsmythos. Doch der beschreibt nicht wirklich die Eigenschaften der verschiedenen Götter und erklärt auch nicht, warum Elane, die Königin der Thäler, alle Kulte außer dem der Erd- und Fruchtbarkeitsgöttin Cyn verboten hat. Gut, die vom Gott der Stürme Gesegneten haben offenbar mit ihren magischen Kräften ziemlich üble Kriegsmaschinen gegen sie ins Feld geschickt, aber was haben die anderen angestellt?
Verwirrend fand ich auch die Darstellung der Jixur. Sie haben ein Fell, Krallen, Gesichter wie Katzen und Schwänze wie Löwen. Aber einer von ihnen mit geflecktem Fell wird als Schecke bezeichnet, und ihre Jungen nennen sie Fohlen. Ich wusste nie so richtig, wie ich mir diese Geschöpfe vorstellen sollte, zumal sie nicht nur vier Beine, sondern auch noch vier Arme haben. Letztlich kam ich zu dem Schluss, dass sie wohl so eine Art Katzencentauren sein müssen. Dazu kommt noch, dass die Jixur nicht die einzigen mit mehreren Gliedmaßen sind. Die Hiranyer haben ebenfalls vier Arme, allerdings nur zwei Beine. Und die Verjig – wo wir schon mal dabei sind – haben ebenfalls vier Arme und zwei Beine, sie sind aber offenbar größer und dunkelhäutiger als die Hiranyer. Man könnte sich fast fragen, ob diese massive Häufung von Gliedmaßen vielleicht aus einer lang zurückliegenden Mischung der Rassen resultiert, aber darüber erfährt der Leser nichts.
Auch mit Informationen über die Historie ihrer Welt war die Autorin ausgesprochen sparsam. Ein Sturmwerkerkrieg wird erwähnt, in dem das Reich der Thäler gegen Gavenne gekämpft und gesiegt hat, trotz derer magischer Kriegsmaschinen. Über die Völker selber, ihre Kultur und Religion erfährt der Leser jedoch so gut wie nichts, nicht einmal über die für die Geschichte ziemlich wichtigen Jixur. Hiranya ist nicht einmal auf der Karte verzeichnet.
Bleibt die Handlung.
Nach den üblichen Einführungen von Personen, Situationen und dem Aspekt des Magischen lässt sich der Plot zunächst recht vielversprechend an. Leider wusste ich schon nach der Ankunft der Jixur bei ihrer Herde, dass Millayn im Auftrag von Jemandem handelte, und spätestens nach dem Gespräch zwischen dem Herzog von Hochthal und der Königin der Thäler wusste ich auch, für wen sie arbeitet. Das nahm der Geschichte zwar einiges von ihrer Spannung, aber das war es nicht allein.
Als extrem störend weil unwahrscheinlich empfand ich das Verhalten der Erwachsenen Rika gegenüber. Ein Kommandant, dessen Stadt belagert wird, wird sich von einer sechzehnjährigen Zivilistin vielleicht Bericht erstatten lassen, aber er wird sie sicherlich nicht zu Beratungen seines Stabes hinzu ziehen oder gar auf sie hören. Und kein Soldat wird dulden, dass ein Rangniedrigerer seinen Befehlen widerspricht. Die sanfte Ermahnung des Soldaten Killarne im Hinblick auf militärische Disziplin fand ich total unpassend. Und dass ein Offizier, der einem politischen Komplott auf die Spur kommt, ohne Rücksprache mit seinem Herrscher einfach in einen Krieg zieht, ist vollkommen abwegig, selbst wenn er eine Generalvollmacht besitzt.
Die größte Enttäuschung jedoch war letztlich der Drahtzieher des Komplotts. Seine Motive und Ziele waren dermaßen kindisch und einfach nur unmöglich, dass ich nur den Kopf schütteln konnte und mich fragte, wie eine solche politische Niete jemals so hoch aufsteigen konnte! Und seine Aufforderung an Rika, ihn einfach entkommen zu lassen, war so ausgesprochen lächerlich, dass ich am Ende nicht mehr in der Lage war, die Autorin noch ernst zu nehmen.
Um das Maß voll zu machen, stolperte ich so manches Mal über Formulierungen wie „zum Vorschein treten“ oder „das Pony durchritt die Kurve“. Ich dachte eigentlich immer, Pferde werden geritten, und in diesem Fall handelt es sich nicht um eine Übersetzung aus dem Englischen, das heißt, hier hat nicht der Übersetzer gepfuscht und auch nicht allein das Lektorat.
Bleibt zu sagen, dass von meiner Freude darüber, endlich mal wieder auf ein Fantasybuch ohne Orks, Elfen, Drachen oder Vampire gestoßen zu sein, nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist. Die meisten Ideen der Autorin, die eigentlich durchaus neu und vielversprechend klangen, sind fast völlig auf der Strecke geblieben, weil ihre Ausarbeitung zu schwach war, um wirklich Farbe in die Geschichte zu bringen. Das gilt auch für den Plot, der durch die Erklärung am Ende des Buches dermaßen ins Lächerliche abglitt, dass nicht mal mehr sein ordentlicher Aufbau den Schaden ausgleichen konnte. Und obwohl die Gruppe um Rika dankenswerterweise nicht aus einem Zauberer, einer Heilerin, einem Elfen und einem Krieger bestand, wirkten die Charaktere aufgrund ihrer fehlenden Tiefe dennoch wie eine Gruppe von Rollenspielfiguren, die auf Abenteuer ausgezogen sind. Sogar die Szenen im Palast von Glaesmon erinnerten mich an |Dungeons and Dragons|. Nur die Ungeheuer fehlten. Vielleicht treten die ja im nächsten Band auf. Ich glaube allerdings nicht, dass ich den wirklich lesen will.
Nicole Schuhmacher ist von Beruf Diplomsoziologin und hatte schon als Kind eine Vorliebe für Märchen und Fantastisches. Zum Schreiben kam sie durch ihre Bekanntschaft mit Markus Heitz. „Sturmträume“ ist ihr erster Roman. Der zweite Band erscheint voraussichtlich im Juli diesen Jahres unter dem Titel „Sturmpfade“.
|Taschenbuch: 496 Seiten
ISBN-13: 978-3453525726|
Königin Shezira macht sich auf den Weg nach Osten, um ihre jüngste Tochter Lystra an den Prinzen Jehal zu verheiraten. Im Gepäck das Brautgeschenk: Ein makellos weißer Drache samt Knappe. Doch während Shezira im Adamantpalast Halt macht, wird die Eskorte des Weißen angegriffen. Am Ende ist der kostbare Drache verschwunden.
Aber das Fehlen des Brautgeschenkes ist nur eine Sorge. Der Sprecher, oberste Autorität in einem Gebilde, das aus neun Königreichen mit je einem eigenen Souverän besteht, wird alle zehn Jahre neu gewählt, und diese Wahl steht kurz bevor. Doch die Nachfolge ist längst nicht so sicher, wie ursprünglich von allen erwartet. Und was hat es mit dem seltsamen Fläschchen auf sich, das auf einer einsamen Lichtung den Besitzer wechseln soll?
Shezira ist eine ehrgeizige und starke Persönlichkeit, allerdings kühl, distanziert und sachlich. Nicht, dass sie ihre drei Töchter nicht mag, doch das hindert sie nicht daran, zwei davon mit politischem Kalkül zu verheiraten. Immerhin aber ist Shezira ehrlich und steht zu ihrem Wort, was man von anderen nicht unbedingt behaupten kann.
Der noch amtierende Sprecher Hyram hat sich in einer alten Abmachung dazu verpflichtet, Shezira als seine Nachfolgerin vorzuschlagen. Doch Hyram ist ein schwacher Mann, der Jahre alte seelische Wunden noch immer nicht verkraftet hat. Das und die Tatsache, dass er seit einem Jahr zunehmend die Kontrolle über seinen Körper verliert, machen ihn angreifbar für Intrigen.
Auch Zafir hat eine Schwäche, und die heißt Jehal. Nicht, dass Zafir nicht ehrgeizig wäre, sie hat durchaus nichts dagegen, den Platz ihrer Mutter als Königin einzunehmen und ist auch beileibe nicht zimperlich, was die Methoden zur Erreichung dieses Zieles angeht. Doch aus eigenem Antrieb hätte sie sich die Mühe nicht gemacht. Dafür ist sie durchaus bereit, sich persönlich die Mühe zu machen und Jehals junge Braut aus dem Weg zu räumen, denn auf die ist sie unendlich eifersüchtig.
Jehal scheint derjenige zu sein, um den sich alles dreht. Er ist noch ehrgeiziger als Shezira und im Gegensatz zu ihr nicht im geringsten wählerisch in seinen Mitteln. Der gut aussehende und charmante Prinz ist sehr geschickt darin, andere um den Finger zu wickeln, vor allem Frauen, die er dann, wenn er sie nicht mehr braucht, einfach fallen lässt. Auch an Absprachen und Verträge hält er sich lediglich, so lange sie seinen Zielen dienen. Jehal will Sprecher werden, um jeden Preis und mit allen, wirklich allen Mitteln.
Wirklich sympatisch ist eigentlich nur Sheziras sture und ungebärdige Tochter Jaslyn mit ihrer Leidenschaft für Drachen. Jaslyn ist genauso unverblümt und ehrlich wie ihre Mutter, allerdings nicht so kaltherzig.
Im Grunde war die Charakterzeichnung ganz in Ordnung. Vor allem der schwächliche Hyram mit seiner Obsession für eine unerreichbare Frau und der skrupellose Jehal waren gut getroffen. So richtig mitfiebern kann der Leser allerdings mit niemandem, denn Jaslyn, die einzige, die sich als Sympathieträger anbietet, rückt erst gegen Ende des Buches etwas mehr in den Vordergrund und könnte noch einiges an zusätzlicher Intensität vertragen. Andere, wie der Knappe Kailin oder der Söldner Sollos, leben einfach nicht lang genug, um ein echtes eigenes Profil zu entwickeln.
Der Ort der Handlung ist nicht unbedingt spektakulär. Die Geographie besteht aus der üblichen Mischung Wüste-Gebirge-Meer, und das einzige, was den Handlungshintergrund von der Realität unterscheidet, ist die Existenz von Drachen und Magie. Die Magie stellt bisher lediglich eine winzige Randerscheinung dar. Nur zweimal tauchen kurz echte Magier auf, und nur in einem dieser beiden Fälle erfährt der Leser überhaupt, was der Magier tut. Wobei ich in diesem speziellen Fall die Alchemisten nicht zu den Magiern gezählt habe.
Bisher ist nicht ganz sicher, ob die Alchemisten bei ihrem Tun auch Magie einsetzen. Fest steht nur, dass sie die gezähmten Drachen mittels ihrer Tränke unter Kontrolle halten. Die Tiere sind sozusagen ununterbrochen zugedröhnt. Nur so ist es möglich, sie abzurichten und zu reiten. Diese Praxis ist schon ziemlich alt, und da nur aus etwa einem Drittel aller Dracheneier auch ein Drache ausschlüpft, sind Drachen ziemlich wertvoll. Sie werden sorgfältig gezüchtet und dementsprechend auch mit Stammbäumen versehen. Kein Wunder, dass Königin Shezira ihre Weiße unbedingt wiederhaben will. Und kein Wunder, dass der Alchemist, der den Suchtrupp begleitet, es so schrecklich eilig hat. Denn was wird wohl geschehen, wenn die Wirkung der Drachendrogen nach lässt?
Darauf erhält der Leser tatsächlich eine Antwort. Was allerdings vom Verlag angepriesen wurde als die „geheimnisvollsten, mächtigsten und gefährlichsten Geschöpfe der Fantasy“, wirkt vorerst noch ein wenig dünn. Denn alles, was von den Drachen selbst bisher zu hören ist, ist Rachsucht. Nur einige wenige Sätze lassen ein paar echte Informationen über die Drachen erahnen, doch die sind so spärlich und vage, dass sie nicht ausreichen, um ein deutliches Bild dieser Geschöpfe zu zeichnen. So bestehen die Drachen – zumindest im Augenblick – hauptsächlich aus Mordgier.
Das hat Konsequenzen.
Dass die Drachen vor allem damit beschäftigt sind, nach den Alchemisten zu suchen und dabei eine Menge Leichen zurücklassen – zu denen man noch diejenigen dazu zählen muss, die sie fressen! – lässt sie, zumindest was mein Interesse anging, ein gutes Stück in den Hintergrund treten. Die Intrigen und Ränkespiele im Zusammenhang mit der Sprecherwahl geben da wesentlich mehr her. Zafir ist auch ohne Jehal schon ein Miststück, und Jehal übertrifft sie darin noch. Beide zusammen sind schlicht gemeingefährlich. Was Jehal vor allem so erfolgreich macht, ist seine Indirektheit, er erreicht seine Ziele stets auf Umwegen und hat die unendliche Geduld einer lauernden Spinne. Zusätzlich interessant wird Jehals Intrigenspiel dadurch, dass er in seiner eitlen Selbstzufriedenheit nicht merkt, dass er ebenfalls benutzt wird.
Das ist der Punkt, der beide Handlungsstränge miteinander verbindet.
Nirgendwo wird erwähnt, wer die Eskorte des weißen Drachen überfallen hat und warum. Hätte der Angreifer den Drachen stehlen wollen, hätte er ihn wohl kaum entkommen lassen. Und wie hätte er ein solch ausgefallenes Tier auch verstecken sollen?
Und die Taiytakey von jenseits des Meeres, die Jehal ein so ausgefallenes Geschenk zur Hochzeit überreichen ließen? Jehal sagt selbst, dass die Taiytakey keine Geschenke machen, und diese bestreiten das nicht einmal. Was also wollen sie dafür? Jehal scheint es nicht zu interessieren, und das dürfte ein Fehler gewesen sein!
Und dann ist da auch noch das Fläschchen mit dem seltsamen Inhalt.
Der aufmerksame Leser merkt nur zu bald, dass die eigentliche Bedrohung von außerhalb kommt, auch wenn sie lediglich ganz am Rande auftaucht, und da sie alle so sehr mit ihren eigenen kleinlichen Machtkämpfen beschäftigt sind, fällt es natürlich keinem der Beteiligten auf.
Unterm Strich kann ich sagen, dass Stephen Deas mit „Der Drachenthron“ einen interessanten und verwickelten Roman abgeliefert hat. Die Charakterzeichnung ist nicht überragend intensiv, aber durchaus lebendig und glaubwürdig. Der Handlungsverlauf wirkt zwar durch die häufigen Szenen- und damit verbundenen Ortswechsel etwas sprunghaft, ich hatte aber keine allzu großen Probleme damit, das Ganze ist sauber aufgebaut und frei von Logikfehlern. Und auch wenn der Spannungsbogen nicht allzu straff gespannt ist, wird es nie wirklich langweilig. Allein die Tatsache, dass das Wesen der Drachen so eingleisig dargestellt ist, find ich schade. Hier hätte ich mir anstelle des vielen Bratens und Fressens etwas mehr Bandbreite und mehr Detailreichtum gewünscht, da darf sich noch einiges tun.
Stephen Deas ist Engländer und arbeitete nach einem abgeschlossenen Physikstudium in der Raumfahrttechnik, ehe er mit „Der Drachenthron“ seinen ersten Roman veröffentlichte. Seither ist er fleißig mit Schreiben beschäftigt. Im April erscheint in England der zweite Band der Trilogie Drachenreiche, außerdem im Herbst der erste Band einer weiteren Trilogie.
Broschiert: 591 Seiten
ISBN-13: 978-3453525306
Originaltitel: The Adamantine Palace
Übersetzt von Beate Brammertz
Stephen Deas.com
http://www.heyne.de
Der Autor vergibt: 




_Der Geisterthron_
Band 1: [Die Assassine 6031
Zum ersten Mal in der Geschichte Amenkors gibt es eine ehemalige Regentin. Obwohl Varis Eryn nicht ganz vertraut, ist ihre Vorgängerin dennoch ein wertvoller Informationsquell, außerdem ist sie die einzige, von der Varis lernen kann, den Fluss besser zu beherrschen. Und das ist bitter nötig. Denn nicht nur die verheerende Versorgungslage der Stadt macht Varis zu schaffen. Eine Vision von der Zerstörung der Stadt hat sie heimgesucht, doch die Richtung, aus der die Gefahr droht, blieb verborgen. Dann werden Teile eines Schiffswracks an die Küste gespült, und darauf finden sich einige seltsame Spuren …
Varis wächst erstaunlich schnell in ihre neue Rolle hinein und entwickelt ein ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen sowie eine wachsende Zielstrebigkeit. Ihre Gefühle bleiben dabei jedoch eher vage. Gelegentlich empfindet sie Unsicherheit, manchmal auch Angst, jedoch überwiegen Zorn und einen überaus starken Beschützerinstinkt. Dabei steht fast immer die Stadt als Ganzes im Zentrum, persönlichere Beziehungen wie die zu Erick oder gar zu William machen lediglich einen Hauch ihrer Persönlichkeit aus.
Die übrigen Figuren bleiben nach wie vor blass. Allein von Eryn erfährt man ein paar persönliche Details; der Oberhofmarschall Avrell, die junge Marielle sowie die Hauptleute Baill, Catrell und Westen bleiben lediglich grobe Skizzen. Selbst die Person Ericks, der Varis von allen Hofleuten am nächsten steht, wurde nicht weiter vertieft.
Die Handlung dagegen ist tatsächlich vielschichtiger geworden. Auch diesmal lässt der Autor es zunächst etwas langsamer angehen, lässt Varis sich erst einmal an ihre neue Rolle gewöhnen, während er den Leser mit den neuen Charakteren bekannt macht, die in diesem Band eine Rolle spielen. Doch da Varis sich wie gesagt recht schnell anpasst, nimmt die Handlung schon bald Fahrt auf.
Dabei baut Joshua Palmatier seine Probleme stufenartig auf. Zwar kommt die Vision von der Zerstörung der Stadt schon recht früh, dennoch widmet sich der Verlauf der Geschichte zunächst dem Problem der Nahrungsversorgung. Kaum ist dies nach einigen Aufwand gelöst, stellt sich heraus, dass immer wieder Kisten und Fässer spurlos verschwinden, dazu kommt das Auftauchen der Wrackteile. Beide Stränge wachsen trotz aller Bemühungen immer weiter an, bis Varis irgendwann vor einem einzigen riesigen Problemberg steht.
Das hat durchaus auch steigende Spannung zur Folge. Obwohl ich schon früh ahnte, wer hinter den verschwundenen Lebensmitteln stecken muss, war ich doch überrascht, welchen Weg die Waren letztlich genommen haben. Das warf allerdings die Frage auf, welche Motive der Dieb für seine Tat gehabt haben mochte. Die magere Ausarbeitung der Nebencharaktere gibt darauf leider keine Antwort.
Auch die Bedrohung von außen, die bereits im ersten Band – in der Entstehungsgeschichte des Thrones – gestreift wurde, hat jetzt ein Gesicht bekommen. Es ist ein interessantes, aber auch recht gnadenloses Gesicht. Immerhin wird hier die Motivation hinter den Angriffen auf Amenkor deutlich, was den Gegner allerdings nicht unbedingt viel menschlicher wirken lässt. Der Showdown ist dann ein überraschend kurzes, aber auch überraschendes Spektakel mit einem Ende, das ich so überhaupt nicht erwartet hätte.
Insgesamt hat mir der zweite Band wesentlich besser gefallen als der erste. Zwar geht es auch diesmal ziemlich blutig zu, immerhin wird Amenkor angegriffen. Diese Szenen beschränkten sich jedoch auf ein relativ kurzes Seegefecht und die Schlacht um die Stadt, sodass sich nicht wie im ersten Band eine Blutspur durch das gesamte Buch zieht. Statt dessen hat der Autor den Blickwinkel mehr auf Intrigen und Verrat gerichtet und dabei tatsächlich einige Haken geschlagen, um den Leser zunächst auf eine falsche Spur zu locken, was die Handlung weniger linear und weniger vorhersehbar gestaltet. Einziger Schönheitsfehler im Handlungsverlauf ist ein logischer Knacks im Zusammenhang mit der Entdeckung, wohin die gestohlenen Lebensmittel verschwunden sind.
Schade nur, dass die Charakterzeichnung so wenig plastisch ausfällt. Nicht nur die Motive des Diebes, auch die des feindlichen Priesters sind schlicht nicht vorhanden. Die Szenen im Zusammenhang mit der gegnerischen Kultur sind nur kurze Rückblenden, und der Zeitpunkt dieser Erinnerung nicht geeignet, um mehr als einen Grund für die Invasion der Fremden zu bieten. Alles andere bleibt lediglich eine vage Andeutung. Ich gehe mal davon aus, dass der Autor sich die Details über die Fremden, ihre inneren Machtkämpfe und ihren kulturellen Hintergrund für den dritten Band aufgehoben hat.
Zumindest hoffe ich das. Denn die bisherigen Informationen sind noch zu spärlich, um eine eigene Wirkung zu erzielen, sie erscheinen vorerst noch ein wenig wie ein Abklatsch Polynesiens. Auch die Charakterzeichnung dürfte für meinen Geschmack noch etwas eindringlicher und lebendiger werden, allerdings hege ich in dieser Richtung eher wenig Hoffnung, immerhin hat sich diesbezüglich im Vergleich zum ersten Band nicht viel getan.
Nun, immerhin sind meine Hoffnungen, die ich nach dem Lesen des ersten Bandes für den zweiten hegte, alle erfüllt worden. Vielleicht klappt das ja auch für den dritten Band.
Joshua Palmatier ist eigentlich Dozent für Mathematik an der Universität von Oneonta im Staat New York, schreibt aber schon, seit er in der Schule eine fantastische Kurzgeschichte auf bekam. „Die Assassine“ ist sein erster Roman und der Auftakt zur |Geisterthron|-Trilogie, die auf englisch bereits komplett erschienen ist. Auf Deutsch erscheint der dritte Band im Juni diesen Jahres unter dem Titel „Die Kämpferin“. Der Autor schreibt derweil am ersten Band seines nächsten Zyklus.
|Broschiert: 512 Seiten
ISBN-13: 978-3785760185
Originaltitel: |The Cracked Throne
http://www.luebbe.de
Tamír Triad
Band 1: Der verwunschene Zwilling
Band 2: Die verborgene Kriegerin
Band 3: Die prophezeite Königin
Tobin hat endlich die Haut seines toten Bruders abgestreift und mit ihr ihren alten Namen. Jetzt nennt sie sich Tamír und hat vorerst alle Hände voll damit zu tun, die Menschen der zerstörten Stadt Ero zu versorgen. Zurück in Atyion lässt sie sich dazu überreden, zögerlichen Adligen ein Ultimatum zu stellen, doch noch immer will sie sich nicht gegen Korin wenden. Statt dessen sucht sie wie ihre Vorgängerinnen das Orakel von Afra auf. Und ist von der Vision, die sie erhält, entsetzt …!
Lynn Flewelling – Die prophezeite Königin (Tamír Triad 3) weiterlesen
_Tamír Triad_
Band 1: [Der verwunschene Zwilling 6101
Band 2: _Die verborgene Kriegerin_
Seit Tobin weiß, dass er eigentlich ein Mädchen ist, fühlt er sich überhaupt nicht mehr wohl in seiner Haut. Seit der Rückkehr des Königs muss er zwar nicht mehr fürchten, von Ki getrennt zu werden und er steht offensichtlich in des Königs Gunst. Doch er mag seinen Vetter Korin sehr und fürchtet, eines Tages mit ihm um den Thron Skalas kämpfen zu müssen. Außerdem sorgt des Königs Anwesenheit dafür, dass Tobin öfters mit Niryn zusammentrifft.
Niryn wiederum hat seine ganz eigenen Pläne mit Skala. Und in denen ist weder für Tobin noch für Erius oder Korin Platz. Iya und Arkoniel versuchen derweil, die bereits behutsam ausgelotete Unterstützung für Tobin heimlich zusammen zu trommeln …
Da Tobin erst zu einem recht späten Zeitpunkt des ersten Bandes nach Ero kam, blieb nicht genug Raum, um alle dortigen Charaktere gleichermaßen stark zu gewichten. Das galt vor allem für Niryn und den König, was die Autorin nun nachholt.
Niryn ist einfach zu charakterisieren, er ist machtgierig, skrupellos und grausam. Den König hat er manipuliert, und da er fürchtet, dass ihm das mit dem Kronprinzen nicht gelingen wird, versucht er, ihn loszuwerden. Das klingt ziemlich nach dem Bild des bösen, bösen Großwesirs, zumal es kein Motiv für Niryns Tun zu geben scheint außer eben seiner Machtgier.
Beim König ist es nicht ganz so einfach. Erius scheint ernstlich um sein Reich besorgt und aufrichtig bemüht, es vor den Plenimarern zu schützen. Gleichzeitig verschließt er standhaft die Augen davor, was sein Verstoß gegen den Willen Illiors seinem Volk antut. Warum er allerdings so erpicht darauf ist, nicht nur eine männliche Königsdynastie zu gründen, sondern auch sämtliche Frauen vom Dienst an der Waffe auszuschließen, muss der Leser sich selbst zusammen reimen.
Korins Charakterzeichnung, die bereits recht lebendig geraten war, wird weiter vertieft. Seine Saufgelage und seine Herumhurerei, die bisher noch wie der Übermut und die Langeweile eines Heranwachsenden wirkten, der sich unbedingt im Kampf beweisen will, aber nicht darf, erscheinen nach der ersten öffentlichen Hinrichtung, der die Gefährten beiwohnen, und nach dem Kampf mit den Banditen in einem völlig anderen Licht. Korin mag seinen Freunden gegenüber charmant, lustig und gutmütig sein, im Grunde jedoch ist er ein arroganter Egozentriker, der sich nur für sich selbst interessiert, und außerdem als militärischer Anführer ein Versager.
Und die Figur ihrer Hauptprotagonistin hat die Autorin ein gutes Stück weiterentwickelt. Tobin wird allmählich erwachsen, mit allen Problemen, die sich daraus für ein Mädchen im Körper eines Jungen ergeben. Nicht nur, dass die junge Adlige Una offenbar tiefere Gefühle für den Neffen des Königs entwickelt, obwohl Tobin zunehmend mit ihren eigenen Gefühlen für Ki zu kämpfen hat. Wie einst mit den Puppen ihrer Mutter geht es Tobin nun mit deren Kleidern, die sie in einem Schrank in Atyion entdeckt: Sie fühlt sich davon angezogen, gleichzeitig jedoch empfindet sie den Gedanken, Frauenkleider zu tragen, als peinlich und unangenehm. Sie will eigentlich auch gar keine Königin sein, andererseits genießt sie die Huldigungen, die ihr von den Soldaten und der Bevölkerung Atyions entgegengebracht werden. Und dann ist da auch noch der Bruder, von dem sie inzwischen weiß, dass er leidet, und der sie hasst und dennoch beschützt. So gern Tobin die Bindung zwischen ihnen lösen würde, um ihrer beider Freiheit willen, fürchtet sie sich doch davor, die geborgte Hülle zu verlieren, die ihr so viel vertrauter ist als ihr eigener Körper. Ganz gleich, worum es geht, Tobin fühlt sich fast ständig hin und her gerissen.
Lynn Flewelling hat das hohe Niveau ihrer Charakterzeichnung weitgehend gehalten. Die Figuren, die sie weiter ausgebaut hat, sind so lebendig und glaubwürdig wie alle anderen, allein dass Niryn ein wenig ins Klischee abgerutscht ist, obwohl er zunächst einen recht viel versprechenden Eindruck machte, fand ich schade. Dafür ist Tobins Entwicklung umso besser gelungen, und da es im Grunde ihre Geschichte ist, kann ich auch damit leben, dass über König Erius Motive kein Wort verloren wird.
Die Handlung weist diesmal wesentlich mehr Bewegung auf als im ersten Band, nicht nur im Zusammenhang mit Tobin, sondern auch mit Arkoniel, der noch immer auf der Feste lebt, seine magischen Studien betreibt und von Lhel lernt, und Iya, die in Ero auf ein Widerstandsnest von freien Zauberern trifft. Die Zuspitzung der Situation streift diese beiden Stränge jedoch lediglich, zeigt eher die Auswirkungen der Zuspitzung, als dass Arkoniel oder Iya aktiv daran beteiligt wären. Erst gegen Ende kommt ihnen eine größere Rolle bei der Entwicklung der Ereignisse zu. Es ist, als hätten diese beiden bisher hauptsächlich Vorbereitungen für den dritten Band getroffen.
Für die Zuspitzung ist natürlich Niryn verantwortlich. Seine Schergen sind es, die die freien Zauberer verfolgen und in den Untergrund treiben. Außerdem intrigiert er kräftig gegen seinen größten Widersacher Orun und sorgt rücksichtslos dafür, dass Korin keinerlei Erben in die Welt setzt. Dabei macht er nicht einmal vor Korins junger Gemahlin Halt. Im Vergleich dazu erschien mir seine Passivität Tobin gegenüber ziemlich seltsam. Zweimal hat er die Auswirkungen der Magie gespürt, als Tobin Bruder gerufen hat. Tobin hat Bruder aber wesentlich öfter gerufen. Ich frage mich, warum Niryn die übrigen Male nichts gespürt hat.
Und weil wir schon dabei sind: Wie hat Niryn Nalia verborgen gehalten, als Korin mit seiner Braut und seinen Gefährten während seiner Hochzeitsreise Gast in Cirna war? Ist Nalia freiwillig die ganze Zeit in ihrem Zimmer geblieben, selbst für die Mahlzeiten? Sie muss doch zumindest Frage gestellt haben. Aber dieser Aspekt wurde von der Autorin komplett übergangen.
Trotz dieser kleinen Knicke hat mir der zweite Band ebenso gut gefallen wie der erste, obwohl ich auch ihn nicht wirklich spannend fand, nicht einmal während der Schlacht am Ende des Buches. Immerhin kam der Umsturz aus einer gänzlich unerwarteten Richtung, was für eine echte Überraschung sorgte. Die gelungenen Charaktere tragen die Handlung problemlos selbst während einiger Passagen, die vielleicht nicht ganz so entscheidend für die Entwicklung der Ereignisse sind, so dass niemals Langeweile aufkommt.
Selbst Niryn, der als Person so relativ wenig hergibt, weiß durch seine Funktion innerhalb des Plots zu fesseln: Ist das Amulett, das er Korin gab, Totenbeschwörermagie oder nicht? Und wenn ja, ist Niryn dann tatsächlich Plenimarer? Wenn ja, wieso ist er dann mit dem Prinzen aus Ero geflüchtet? Und wenn nein, wie konnte er dann Totenbeschwörermagie einsetzen? Und wenn es keine Totenbeschwörermagie war, mit welcher Art von Magie hat er dann dieses abscheuliche Ergebnis erziehlt? Und dann ist da natürlich auch noch die seltsame Schale, über die der Leser im Laufe des Buches zwar ein wenig mehr erfährt, die aber bisher noch keine richtige Rolle in der Geschichte gespielt hat, so dass der Leser sich fragt, warum das Ding eigentlich immer wieder erwähnt wird. Die Autorin weiß das Interesse ihrer Leser jederzeit wach zu halten, auch über das Ende eines Bandes hinaus.
_Lynn Flewelling_ studierte Englisch, Geschichte und noch einiges andere und war in diversen Berufen tätig, ehe sie ihren ersten Roman veröffentlichte. „Der verwunschene Zwilling“ ist der erste Band ihrer Trilogie |Tamír Triad|. Außerdem stammt der Zyklus |Die Schattengilde| aus ihrer Feder, der inzwischen bis Band 5 gediehen, auf Deutsch derzeit aber nur bis Band 3 und nur gebraucht erhältlich ist.
|Broschiert: 608 Seiten
ISBN-13: 978-3902607096
Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 16 Jahren
Originaltitel: |Hidden Warrior|
Übersetzt von Michael Krug|
http://www.otherworldverlag.com
http://www.sff.net/people/Lynn.Flewelling/
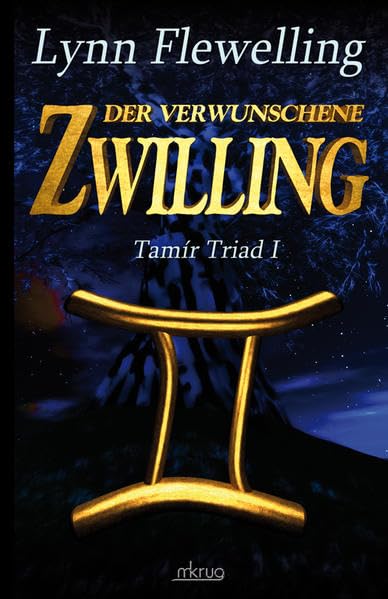
Doch dann verliert Tobin seinen Vater. Der König lässt Tobin an den Hof holen, und schon bald wünscht sich der Junge, es wäre alles wieder wie früher. Dabei sind die boshaften Intrigen unter den Gefährten des Kronprinzen noch sein geringstes Problem, wovon Tobin allerdings noch gar nichts weiß.
Lynn Flewelling – Der verwunschene Zwilling (Tamír Triad 1) weiterlesen
Die Nauraka gehören zu den ältesten Völkern der Welt und ihre Macht und Weisheit sind legendär. Tatsächlich jedoch besitzt das Volk der Nauraka seit Langem nur noch einen Schatten seiner einstigen Größe, und wenn man dem alten Turéor glauben kann, dann liegt es daran, dass die Nauraka „das Letzte, was bleibt“ verloren haben. Nur nimmt den Alten niemand ernst.
Erenwin, Turéors Neffe und Prinz der Nauraka, träumt davon, die Welt zu entdecken, nicht nur seine eigene, sondern auch die jenseits der Weiten der See. Am liebsten wäre es ihm, wenn seine geliebte Schwester ihn auf dieser Reise beleiten würde, doch Lurdèa hat andere Pläne. Und so kommt es, dass Erenwins Reise, als sie endlich losgeht, ganz anders verläuft als erhofft, und daran ist nicht nur die seltsame Perle schuld, die er vor Kurzem am Meeresgrund gefunden hat …
Tatsächlich ist Erenwin ein naiver Träumer, der sich die Welt jenseits der Mauern seines heimatlichen Palastes wie einen einzigen großen Abenteuerspielplatz vorzustellen scheint. Vielleicht liegt das aber auch nur daran, dass er sich an dem Ort, an dem er lebt, nicht wirklich zu Hause fühlt. Seine Mutter ist eine Hüterin der Gefilde, große Nähe zu ihr war ihren Kinder nie möglich. Und Erenwins Vater ist das ganze Gegenteil seines wissbegierigen und mitfühlenden Sohnes …
Fürst Ragdur ist ein überaus strenger Herrscher. Sein Ziel ist es, die Nauraka zu alter Größe zurück zu führen, und er sucht dieses Ziel auf politischem Wege zu erreichen. Ein Sohn wie Erenwin ist dafür in keiner Weise geeignet, dementsprechend geringschätzig behandelt er Erenwin. Gleichzeitig beschwert er sich über den zu großen Einfluss, den Turéor auf den Jungen hat, und über die Flausen, die der Alte seinem Sohn in den Kopf setzt.
Dabei ist Turéor ein überaus weiser Mann. Leider klingt er des Öfteren etwas wirr und zusammenhanglos. Das liegt aber nicht daran, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte, wie alle glauben, sondern daran, dass er sich an Dinge erinnert, an die sich sonst niemand mehr erinnern kann. Seine Worte sind eine ständige Mahnung, ein Versuch, die Erinnerung wach zu halten. Doch außer Erenwin hört ihm niemand zu.
Die Einzige, die Erenwin wirklich nahe steht, ist seine Schwester Lurdèa. Doch das junge Mädchen ist bei Weitem nicht so neugierig auf die Welt wie ihr Bruder. Vor allem will sie ihren hohen Status nicht aufgeben, statt dessen hofft sie auf eine vorteilhafte Verbindung mit einem gut aussehenden und zuvorkommenden Adligen. Das magische Wort in Lurdèas Träumen heißt Romantik. Obwohl wesentlich pragmatischer veranlagt als Erenwin, ist sie dennoch auf ihre Weise ebenso naiv wie er. Erst die Unbill, die ihr im Laufe der Ereignisse widerfährt, bringt ihre innere Stärke zum Vorschein.
Der Gegenspieler schließlich wird überall nur Der Alte Feind genannt und bleibt fast das gesamte Buch über nur eine gesichtslose, schemenhafte Wesenheit, die nahezu ausschließlich in Turéors Erzählungen auftaucht. Erst kurz vor dem Showdown erhält sie durch eine Rückblende ein eigenes Gesicht.
Insgesamt fand ich die Charakterzeichnung ganz in Ordnung. Ragdur ist durch seine Unbarmherzigkeit und die rücksichtslose Art, mit der er seine politischen Ziele über alles andere stellt, beileibe kein Gutmensch, aber auch kein echter Bösewicht. Lurdèa gleitet leider zum Ende hin ein wenig ins Klischee der starken, nicht zu brechenden Heldin ab, und auch ihr Ehemann Janwe kann sich dem Klischee nicht ganz entziehen, dennoch bleiben beide glaubwürdig. Der Alte Feind besticht vor allem durch seine kunstvolle Tarnung, der Charakter selbst dagegen erschien mir dann fast etwas blutleer, was ich schade finde. Am besten gefiel mir die Darstellung Turéors, der einerseits so weltfremd erscheint und andererseits so scharfsichtig und klardenkend ist wie sonst kaum einer in diesem Buch.
Die Handlung basiert zunächst auf zwei Schwerpunkten:
Zum Einen ist da der fremde Nauraka Janwe, der um Lurdèa wirbt. Erenwin traut ihm nicht, doch er kann nicht sagen, woran das liegt. Lurdèa will seine Warnung nicht wirklich hören, und letztlich hat sie ohnehin keine Wahl. In seiner Sorge um die Schwester schwört Erenwin, ihr in ihr neues Heim zu folgen, um sie zu beschützen.
Zum Anderen befindet Erenwin sich selbst in einer prekären Situation, er weiß es nur noch nicht. Sein Fundstück, die schwarze Perle vom Meeresgrund, fasziniert ihn über die Maßen, so sehr, dass er sie vor allen anderen geheim hält, selbst seiner geliebten Schwester, und selbst Turéor, der ihm besorgte Fragen stellt. Und Turéor sorgt sich nicht zu unrecht …
Im Laufe der Geschichte zeigt sich dann, dass beides miteinander zusammenhängt: die Perle und Lurdèas Hochzeit.
Der Perle kommt dabei letztlich das größere Gewicht zu. Sie verändert Erenwin, sowohl sein Äußeres als auch sein Denken und Fühlen. Außerdem scheint sie Besitz von ihm zu ergreifen, denn obwohl Erenwin die alarmierenden Veränderungen nicht entgehen, weigert er sich, Turéors Fragen zu beantworten. Bis es zu spät ist.
Auch sonst ist die Perle ein merkwürdiges Artefakt. Erenwin behauptet, sie lenke ihn. Das klingt nach einem bestimmten Ziel, das die Perle verfolgt. Doch welches? Immerhin vergehen fast zwanzig Jahre, bis Erenwin an den entscheidenden Ort gelangt, und es ist ja nicht so, als hätte die Perle ihn nicht gleich zu Anfang schon dorthin lotsen können. Und wieso verwandelt sie Erenwin allmählich in ein Ungeheuer? Diese Frage wird von der Autorin mit der Herkunft der Perle beantwortet. Ich finde diese Antwort allerdings nicht wirklich zufriedenstellend, denn am Ende taucht auch ein „Verwandter“ der Perle auf, und der wirkt überhaupt nicht wie ein Ungeheuer.
Das alles verwirrte mich ein wenig, und dieser Eindruck wurde noch verstärkt von den vagen Andeutungen Turéors. Schon bald ist klar, dass alle geschilderten Vorkommnisse irgendwie mit der Vergangenheit zu tun haben, teilweise wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Und doch bleibt diese Vergangenheit nebulös und unklar, erst beim Rückblick des Alten Feindes wird die Sache etwas klarer.
Der Handlungsverlauf selbst ist ausgesprochen abwechslungsreich gestaltet. Hier hat sich die Autorin eine Menge einfallen lassen, ohne in Weitschweifigkeit zu verfallen. Alles fängt ganz harmlos an, doch eines ergibt das andere, und das völlig natürlich und ungezwungen. Allein die beiden Begegnungen auf dem Markt – zum Einen mit der Nices, zum Anderen mit dem gebranntmarkten Jungen – wirken etwas gekünstelt. Hier hat die Autorin ihrem Protagonisten zwei wichtige, aber voneinander völlig unabhängige Informationen nahezu gleichzeitig zugespielt, das ist dann doch ein wenig zu viel des Guten.
Die ruhigeren Passagen werden immer wieder aufgelockert von turbulenteren Szenen wie der Jagd auf den Schlängelaal oder dem Piratenüberfall. Und im Großen und Ganzen ist die Geschichte frei von logischen Brüchen, obwohl ich mich doch fragte, wie der Alte Feind es riskieren konnte, die für ihn doch offensichtlich so wichtige Lurdèa einfach in Nuramar allein zu lassen. Nur durch puren Zufall ist sie ihm dort nicht abhanden gekommen.
Einen nicht zu verachtenden Anteil an der interessanten Gestaltung der Geschichte kommt dem Hintergrund zu. Das meiste spielt sich unter Wasser ab, und diese Unterwasserwelt hat Uschi Zietsch ebenfalls ohne Detailverliebtheit, aber doch malerisch in Szene gesetzt.
Und doch konnte mich das Buch trotz all dieser positiven Aspekte nicht wirklich fesseln. Es ist nett und interessant zu lesen, sicher, aber mitgerissen hat es mich nicht. Die Jagd-, Flucht- und Kampfszenen brachten zwar etwas Leben in die Handlung, aber keine wirkliche Spannung. Der Showdown war sogar regelrecht unspektakulär, wenn auch nicht ganz ohne Überraschung. Die interessanteste Figur, Turéor, ist nicht bis zum Ende mit von der Partie, und der Alte Feind, der sich so geschickt verborgen hatte, enttäuschte letztlich durch seinen Mangel an Intensität. Jemandem, der aus Rache ein ganzes Volk ausrotten will, sollte man diesen Rachedurst auch anmerken. Und auch die Sache mit der Perle ergibt keinen zusammenhängenden Faden innerhalb der Geschichte, zu undurchsichtig und unzusammenhängend erscheint ihre Einflussnahme auf Erenwin bis hin zum endgültigen Schluss.
Dass ich die |Waldsee|-Chroniken, in deren Welt „Nauraka“ ebenfalls spielt, nicht gelesen habe, erwies sich dagegen nicht als gravierendes Manko, auch wenn eventuell darin enthaltenen Details über den ersten Krieg mit dem Alten Feind hilfreich gewesen wären.
Uschi Zietsch wollte schon Schriftstellerin werden, als sie noch gar nicht schreiben konnte. Ihr Debutroman „Sternwolke und Eiszauber“ erschien 1986 bei Heyne. Sie wirkte jahrelang an der |Perry-Rhodan|-Reihe mit, schrieb eine Kinderbuchserie über Tierkinder und ihr Erwachsenwerden, sowie drei |Spellforce|-Bände und natürlich die [|Chroniken von Waldsee| 5402 . Außerdem ist sie am Zyklus |Elfenzeit| beteiligt, sie schreibt Kurzgeschichten und TV-Romane für Fernsehserien und arbeitet als Herausgeberin, Lektorin und Verlegerin.
|Broschiert: 512 Seiten
ISBN-13: 978-3404285341|
http://www.uschizietsch.de/index.htm
Varis ist ein Straßenkind und eine Überlebenskünstlerin. Ihr Zuhause ist ein Loch in einer verfallenen Ruine irgendwo in den riesigen Slums diesseits des Flusses, sie lebt vom Diebstahl und von der Mildtätigkeit eines Bäckers. Bis sie eines Tages einem Assassinen der Regentin begegnet, der ihr anbietet, für ihn zu arbeiten. Varis zögert, doch dann sagt sie zu. Und schon bald verändert sich ihr Leben dramatisch …
Joshua Palmatier erzählt seine Geschichte in der Ich-Form, aus der Sicht von Varis.
Varis ist ein typischer Streuner, flink, scheu, misstrauisch und halb verhungert. Dennoch unterscheidet etwas sie ganz entscheidend von ihrem größten Konkurrenten, den sie auf Grund eines dunklen Flecks im Gesicht Blutmal nennt: Zwar hat auch sie mehr als nur ein Menschenleben ausgelöscht, allerdings macht ihr das Töten durchaus keinen Spaß.
Damit hat sich die Charakterzeichnung auch schon erschöpft. Zwar ist Varis sehr gut und eindringlich gezeichnet, alle anderen Figuren reichen jedoch kaum über Nachvollziehbarkeit hinaus. Varis kann keine Gedanken lesen und keiner der anderen Charaktere fasst seine Gedanken oder Gefühle jemals in Worte. Deshalb hat auch keiner von ihnen eine echte eigene Persönlichkeit, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Motive oder Ambitionen werden – wenn überhaupt – lediglich in kurzen, belauschten Gesprächsfetzen vage angedeutet.
Ähnlich eingleisig wirkt zunächst auch die Handlung. Der Prolog erzählt von der ersten Phase der Ausführung eines Auftragsmordes. Und auch die Geschichte selbst fängt gleich als erstes mit einem Mord an. Da Varis‘ Auftraggeber ein Assassine ist, mangelt es auch im weiteren Verlauf nicht an Leichen. Aber das ist es nicht allein: So zurückhaltend der Autor in der Darstellung seiner Nebencharaktere war, so unverblümt ist er in der Darstellung des Tötens. Nicht, dass er es unnötig ausgedehnt hätte, aber er ist durchaus drastisch. Nach Palmatiers Beschreibung ist Töten ein schmutziges Geschäft, und so entspricht Palmatiers Assassine auch nicht dem derzeit modernen Bild dieses Berufszweigs: Keine übertriebenen Fähigkeiten, keine gefährliche, geheimnisvolle Ausstrahlung, keine magische Anziehungskraft. Nur eine blutige Spur, die sich durch die gesamte Geschichte zieht. Die Entdeckung eines Komplotts im zweiten Teil des Buches verleiht der Handlung schließlich ein wenig mehr Vielschichtigkeit, aber auch in diesem Zusammenhang kommt es zu Mord und Totschlag. Fast sieht es so aus, als bestünde das Buch lediglich aus einem einzigen großen Schlachtfest … wären da nicht Varis‘ besondere Fähigkeiten.
Die erste dieser Fähigkeiten ist gar nicht so besonders. Varis kann geistig auf eine andere Ebene abtauchen, in der sie die Welt auf ungewöhnliche Art wahrnimmt. Sie nennt diese Ebene den Fluss. Dort kann Varis an den Farben erkennen, welche Menschen harmlos sind und wer eine Gefahr für sie darstellt. Außerdem befähigt der Fluss sie, Leute extrem deutlich und scharf wahrzunehmen, wenn sie sich auf sie konzentriert. Und offenbar kann sie die Kraft des Flusses auch gegen andere lenken und damit auf sie einwirken. Aber da ist sie nicht die Einzige.
Was dagegen tatsächlich einzigartig zu sein scheint, ist das weiße Feuer, das in Varis schlummert und bei Gefahr erwacht. Was es damit genau auf sich hat, bleibt vorerst unklar.
Dieses weiße Feuer ist es, das letztlich die Geschichte ein Stück aus den Strömen von Blut heraushebt, durch die Varis watet. Das Rätsel darum, wo es herkommt, was es bewirkt und warum es überhaupt immer wieder kommt, lässt erahnen, dass es letztlich doch um mehr geht als nur Würgen und Stechen. Leider bleibt jener Aspekt zunächst so weit im Hintergrund, dass der Leser ihn glatt vergessen könnte, wäre ein Rest der rätselhaften Flammen nicht in Varis hängen geblieben. Erst beim Showdown wird das weiße Feuer plötzlich wieder wichtig.
Der Showdown rückt auch Varis‘ Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Fluss in ein neues Licht. Unübersehbar hat es damit weit mehr auf sich, als es bisher schien. Zusammen mit der Tatsache, dass der Hintermann des Komplotts bisher nicht bekannt ist, ergibt sich daraus ein faszinierender Ausblick auf den nächsten Band.
Mit anderen Worten: Es dauert eine ganze Weile, bis der Autor zur Sache kommt. Allerdings verhindern die sehr lebendige sprachliche Gestaltung und der Ortswechsel zwischen den beiden Teilen des Buches, dass der Leser das Interesse verliert, ehe er den Kern der Geschichte erreicht, obwohl es trotz der vielen Kämpfe erst zum Showdown hin wirklich spannend wird. Wer Action mag, sich nicht daran stört, dass ständig Blut fließt, und ein wenig Geduld aufbringt, dem könnte dieses Buch durchaus gefallen.
Es steckt aber durchaus noch Entwicklungspotential drin. Immerhin hat die überraschende Entwicklung am Ende des Buches eine viel versprechende Ausgangssituation für die Fortführung der Geschichte geschaffen. Da Varis nun keine Assassine mehr ist, hege ich die Hoffnung, dass das Blutvergießen in der Fortsetzung zu Gunsten einiger Intrigen und der Geheimnisse im Hinblick auf die Magie stark in den Hintergrund rücken wird. In dem Fall dürfte der zweite Band wesentlich vielschichtiger und auch interessanter ausfallen als der erste.
Joshua Palmatier ist eigentlich Dozent für Mathematik an der Universität von Oneonta im Staat New York, schreibt aber schon, seit er in der Schule eine fantastische Kurzgeschichte verfassen musste. „Die Assassine“ ist sein erster Roman und der Auftakt zur |Geisterthron|-Trilogie, die auf Englisch bereits komplett erschienen ist. Auf Deutsch erscheint der zweite Band im Januar 2010 unter dem Titel „Die Regentin“. Der Autor schreibt derweil am ersten Band seines nächsten Zyklus.
|Broschiert: 384 Seiten
ISBN-13: 978-3785760130
Originaltitel: |The Skewed Throne
Rokshan ist Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns in Marakanda. Er führt ein recht beschauliches Leben und hofft, nach Abschluss der Schule Sonderbotschafter zu werden. Doch dieser Traum wird jäh gestört, als der alte Geschichtenerzähler Shou Lao ihm eröffnet, er sei vom Schicksal dazu ausersehen, eine Reise zum Dhavan-Pass anzutreten, da das schlafende Böse erwache. Nicht, dass Rokshan mit dieser Erklärung etwas anfangen könnte, obwohl er in den alten Legenden wohl bewandert ist. Doch dann wird plötzlich sein Vater verhaftet, und so findet sich Rokshan schon bald tatsächlich in einer Karawane auf dem Weg zum Pamirgebirge wieder …
_Rokshan ist ein_ sehr gutherziger Kerl, der von all den seltsamen Ereignissen, die sich plötzlich so häufen, ziemlich verwirrt ist. Was ihn nicht daran hindert, genau das zu tun, was man von ihm erwartet. Mit anderen Worten, ein echter Klischeeheld. Naiv und gutgläubig lässt er sich von allen benutzen und wie ein Schaf zur Schlachtbank führen, wo er sich heldenmütig opfert. Ehrlich, die rebellischen Helden, die aus purem Trotz immer das Gegenteil von dem tun, was sie sollen, gingen mir in letzter Zeit ziemlich auf die Nerven. Aber seit ich Rokshan kenne, weiß ich, warum die Trotzköpfe erfunden wurden.
Sein Bruder An Lushan ist keinen Deut besser. Zwar ist er nicht so reinen Herzens wie Rokshan, aber dasselbe Schaf. Blind vor Naivität tappt er in die Falle und lässt sich verführen, wird zum Verräter an seiner Familie und an der gesamten Menschheit, nur um letzten Endes doch noch auf seine eigene Art und Weise heldenhaft über das Böse zu triumphieren, auch wenn es da längst zu spät ist, zumindest für den Rest der Welt.
Und dann wäre da noch Lianxang. Die Enkelin einer Schamanin aus den Nomadenstämmen im Nordwesten ist natürlich selbst auch eine zukünftige Schamanin und mit Abstand die sympatischste Figur in diesem Buch. Zwar ist sie teilweise ebenso naiv und edelmütig wie Rokshan, aber sie entwickelt zumindest ein gewisses Maß an Eigeninitiative und lässt sich nicht nur herum schubsen, ohne von irgendetwas Ahnung zu haben.
Nach dieser Darlegung muss ich wohl kaum explizit feststellen, dass die Charakterzeichnung in diesem Buch absolut enttäuschend war.
Dasselbe gilt auch für die Handlung. Eine gewisse Grundstruktur lässt sich durchaus erkennen: Während der eine Bruder auf die Reise geht, um die Welt zu retten, gerät der andere in die Fänge der Bedrohung und wird zum Werkzeug. Irgendwann treffen die beiden wieder aufeinander und es kommt zum Kampf.
Bedauerlicherweise ist die Geschichte so hölzern und unbeholfen erzählt, dass es eine wahre Tortur war, sie zu lesen! Nicht nur, dass Rokshan brav von Station zu Station reitet, um dort jeweils ein neues Bröckelchen Information aufzulesen, wie ein Huhn, dem man eine Spur Körner gestreut hat. Der ganze Ablauf diese Reise wirkt so unnatürlich steif, wie ich es nur selten erlebt habe. Rokshan erreicht eine Station, bekommt in einem kurzen Gespräch sein Häppchen serviert, denkt kurz nach und beschließt dann, genau das zu tun, was ihm aufgetragen wird, worauf er wieder aufbricht. Außerdem erwecken diverse Formulierungen den Eindruck von Flickschusterei, etwa, wenn Lianxang, nachdem sie eigentlich alle ihre Kräuter auf Befehl An Lushans verbrannt hat, plötzlich doch noch einen geheimen in ihren Kleidern eingenähten Vorrat auspackt, der vorher nirgends auch nur mit einem Wort erwähnt wurde.
Dazu kommt noch, dass die ganze Sache von dem alten Geschichtenerzähler aufgrund der Konstellation der Sterne und eines Rätsels ins Rollen gebracht wird. Beides wird mit absoluter Bestimmtheit auf eine gewisse Weise interpretiert, und niemand scheint auch nur eine Sekunde lang die geringsten Zweifel an der Richtigkeit dieser Interpretation zu haben. Was die Sterne angeht, wird ihre tatsächliche Konstellation nicht erwähnt. Das Rätsel dagegen ist wörtlich abgedruckt. Und was seine im Buch aufgeführte Bedeutung angeht, so muss ich sagen, dass sie mich nicht überzeugt hat. Für mich klangen diese Zeilen eher wie eine Sterbehymne der Kaiser, die – zumindest in dieser Geschichte – glaubten, nach ihrem Tode von Drachenpferden in den Himmel getragen zu werden. Aber nicht nach der Ankündigung einer ernsten Bedrohung, ganz gleich ob verschlüsselt oder nicht.
Zu guter Letzt hat mir auch der Hintergrund der Geschichte nicht gefallen. Sie beginnt im China des Jahres 818 in Marakanda, wie die Stadt bei den Griechen hieß. Und da fängt es schon an: Wieso sollte jemand in China eine Stadt bei ihrem griechischen Namen nennen? Tatsächlich hieß die Stadt im Jahr 818 Samarkand und lag nicht mehr in China, auch nicht in seinem teilautonomen Westteil, sondern im Reich der Abassiden, also in Persien.
Nun ist ein Mangel an Korrektheit in geschichtlichen Belangen selbst bei Historienromanen keine Seltenheit. Leider ist sie hier auch noch mit einem Mangel an Korrektheit in religiösen Belangen zusammengetroffen! Natürlich hat der Autor recht, wenn er im Nachwort äußert, die verschiedenen Religionen an der Seidenstraße hätten sich miteinander vermischt. Trotzdem mutet es seltsam an, wenn ein buddhistischer Mönch es als Strafe ansieht, wenn eine Seele aus dem Kreis der Wiedergeburt ausgeschlossen wird, denn eigentlich ist es ja das erklärte Ziel des Buddhisten, das Rad der ständigen Wiedergeburt irgendwann zu verlassen. Im Falle dieses Buches ist das allerdings tatsächlich nicht erstrebenswert, denn die der Wiedergeburt entrissenen Seelen landen in der Hölle, obwohl es die im Buddhismus gar nicht gibt. Die Absicht des Autors, alle an der Seidenstraße vertretenen Religionen in seine Geschichte einfließen zu lassen, führt zu einem unüberschaubaren Mischmasch, in dem der Schöpfungsmythos christliche Züge trägt, der oberste Gott jedoch Ahura Mazda heißt und die erschaffene Welt von taoistischen Göttern und chinesischen Mythenwesen belebt ist. Da ist der Leser fast erleichtert, dass Peter Ward auf die einzelnen Religionen gar nicht genauer eingeht, sondern größtenteils nur mit spezifischen Begriffen oder Persönlichkeiten um sich wirft.
Nun ist es ja nicht unbedingt verwerflich, die religiöse Vielfalt jener Region deutlich zu machen. Wenn der Autor sie denn auch deutlich gemacht hätte. Statt dessen verrührt er alles in einem großen Topf zu einer Megagesamtreligion, die jegliche Konturen verloren hat.
Zugegeben, an diesem Buch hatte ich eine Menge zu meckern. Und wenn ich schon mal dabei bin, muss ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass die Karte vorne im Buch grottenschlecht ist! Wie in aller Welt kommt der Baikalsee in den Westen des Pamirgebirges??
_Sagen wir es so:_ Wer dieses Buch tatsächlich lesen will, der darf sich keinesfalls an so unwichtigen Details stören wie dem, dass die chinesischen Drachen hier Flügel haben oder dass Personennamen aus einem chinesischen Familiennamen, einem chinesischen Vornamen und dann noch einem indischen oder persischen Familiennamen bestehen; er darf sich nicht daran stören, dass die sprachliche Gestaltung nicht nur von grammatikalischen Fehlern strotzt, sondern auch nahezu völlig leblos die einzelnen Ereignisse nacheinander herunter spult; dass die Figuren jegliches Eigenleben vermissen lassen, da selbst ihre gelegentlichen Gedanken an frühere Freunde oder Verwandte, Träume oder Ziele so marionettenhaft daher kommen wie ihre Ausdrucksweise in den Dialogen; und dass die Handlung nur deshalb nicht völlig vorhersehbar ist, weil der wilde Religionsmix und die seltsame Deutung des Rätsels so wirr daher kommen, dass man sie kaum nachvollziehen kann.
Na gut, ich will nicht ungerecht sein: Auf den letzten achtzig Seiten kommt dann doch zumindest ein wenig Spannung auf. Die konnte mich aber kaum dafür entschädigen, dass ich mich dafür zuvor vierhundert Seiten lang durch eine sprachliche und inhaltliche Wüste quälen musste. Sie hat lediglich dafür gesorgt, dass ich das Buch überhaupt fertig gelesen habe.
_Peter Ward_ hat einen Teil seiner Kindheit in verschiedenen asiatischen Ländern verbracht und von dort eine bleibende Faszination für östliche Kulturen, insbesondere China, mitgebracht. Nach einem Studium in Philologie und Religionswissenschaften war er in der Medienbranche tätig, ehe er mit „Der Rubindrache“ seinen ersten Roman verfasste. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in London.
|Gebundene Ausgabe: 496 Seiten
ISBN-13: 978-3570136546
Originaltitel:| Dragon Horse|
Übersetzt von Gerold Anrich|
Die Chronik der Weitseher
Band 1: „Der Weitseher“
Band 2: „Der Schattenbote“
Band 3: Der Nachtmagier
Zwar hat Fitz am Ende des ersten Bandes eine schwere Bewährungsprobe bestanden, doch scheint ihn das seine Gesundheit gekostet zu haben. Er ist schwach und hat immer wieder unvorhersehbare und unkontrollierbare Anfälle. Ein ziemliches Manko für einen Assassinen! Fast schon hat Fitz beschlossen, nicht in den Dienst des Königs zurückzukehren, da hat er einen bedeutungsschweren Traum. Und so kommt es, dass er sich trotz seiner Schwäche zurück nach Bocksburg schleppt, mitten hinein in die Höhle des Löwen …
Fitz ist tatsächlich ein bisschen reifer geworden, was man an seiner veränderten Beziehung zu Molly ablesen kann. Außerdem neigt er inzwischen dazu, ab und an die Initiative zu ergreifen, meist zur äußerst mäßigen Begeisterung von Chade, der danach die Dinge wieder ins Lot rücken muss. Auch sonst fehlt es Fitz gelegentlich noch an Selbstbeherrschung, was sowohl Molly als auch den jungen Wolf betrifft, den er auf dem Markt dem Tierhändler abkauft.
Dafür wird König Listenreich immer kränker und schwächer, so dass er als eigenständige Persönlichkeit zunehmend weg fällt. Gleichzeitig rückt dadurch der Narr etwas mehr in den Vordergrund, er taucht jetzt häufig bei Fitz auf, um mit ihm zu reden. Der geheimnisvolle und hochintelligente kleine Kerl ist seinem König mit Leib und Seele ergeben und tut alles, um Fitzens Aufmerksamkeit auf die Situation des Königs zu lenken. Er braucht dringend Verbündete, nicht nur für seinen König, auch für sich selbst.
Einen Teil der Aktivitäten Listenreichs übernimmt Kettricken. Die junge Frau ist jetzt mit Kronprinz Veritas vermählt, doch dieser hat kaum Zeit für sie. Dabei wünscht Kettricken sich so sehr, in die Sorge um das Reich mit eingebunden zu werden. Sie will nicht nutzlos herumsitzen und ihre Zeit mit sinnlosem Kleinkram wie Sticken vertun, das widerspricht völlig ihrer Auffassung von dem, was eine Königin für ihr Volk sein sollte, nämlich mehr als nur eine Zuchtstute, die den Thronfolger zur Welt bringt. Und schließlich ergreift sie die Initiative.
Veritas, der Trottel, dagegen merkt zunächst gar nicht, was für eine Perle er da zur Frau hat. Er reibt sich für sein Volk fast auf, aber anstatt seine Sorgen und Pläne mit seiner Gemahlin zu teilen, ist er blind für ihre Fähigkeiten und ihren Wunsch, ihn zu unterstützen. Erst als er sie durch Fitzens Augen sieht, erkennt er ihren Wert, aber da ist es schon fast zu spät.
Auch diesmal ist die Charakterzeichnung ausgesprochen gelungen. Einige Figuren werden intensiviert, wie zum Beispiel Molly, die aufgrund ihrer Rolle jetzt wesentlich häufiger auftaucht, und Fitz entwickelt sich nachvollziehbar und glaubwürdig zu einem jungen Mann. Na gut, einem sehr jungen Mann. Sehr gut gezeichnet ist auch Kettricken und ihr Bemühen, sich in ihrem neuen Leben zurecht zu finden und die Stellung auszufüllen, die sie nun inne hat.
Die Handlung lässt sich auch diesmal wieder eher träge an. Nachdem Fitz nach Bockburg zurückgekehrt ist, widmet sich die Autorin erst einmal dem Aufbau der neuen Situation: Veritas sucht nach Wegen, die roten Korsaren zu bekämpfen, und tatsächlich kann er ein paar Erfolge verzeichnen. Doch die Nachrichtenübermittlung ist mangelhaft, und letztlich muss gesagt werden, dass all seine Bemühungen ohnehin nur die Symptome bekämpfen. Keiner außer Chade hat bisher auch nur versucht, die Ursachen herauszufinden.
All das, Veritas‘ Kampf, Listenreichs Siechtum, Kettrickens Schwierigkeiten, aber auch Fitzens Beziehung zu Molly, sorgt dafür, dass sich der Anfang doch etwas zieht.
Fahrt nimmt das Ganze erst auf, als Veritas sich entschließt, sich auf die Suche nach den Uralten zu begeben. Edel fängt bei der Aussicht darauf, in Abwesenheit Veritas‘ endlich nahezu freie Hand zu haben, regelrecht an zu sabbern. Und tatsächlich sieht der Leser von Veritas‘ Abreise an, wie Fitz und seine Verbündeten hilflos und unaufhaltsam in die Katastrophe rutschen. Dabei ist so offensichtlich, was Edel da tut! Und es erstaunt mich doch sehr, wie lange Chade vor dem Offensichtlichen die Augen verschließt, eigentlich hatte ich ihn für intelligenter gehalten.
Natürlich ist auch die Bedrohung durch die Roten Korsaren noch immer vorhanden, obwohl die Autorin in dieser Hinsicht noch immer mit neuen Informationen geizt. Statt dessen nutzt sie ihre Andeutungen dazu, neue Rätsel aufzubauen, was die Neugierde gehörig schürt.
So wird es dann doch noch zunehmend fesselnd, vor allem gegen Ende, unter Anderem auch deshalb, weil Fitz sich durch seinen Rachefeldzug wirklich so richtig tief in die Patsche hineinreitet. Natürlich muss er überleben, schließlich gibt es noch einen dritten Band. Trotzdem fragt sich der Leser bis zur letzten Seite, wie Fitz sich da wohl herauswinden wird. Die Lösung ist dann überraschend und spektakulär. Und obwohl er mit dem Leben davon kommt, scheint alles andere in Trümmern zu liegen. Nun, wenigstens kann es dann im dritten Band eigentlich nur noch aufwärts gehen. Schade nur, dass ich darauf und auf die Antworten auf all die Rätsel und offenen Fragen noch bis März 2010 warten muss.
Robin Hobb war bereits unter dem Namen Megan Lindholm eine erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin, ehe sie mit der Weitseher-Trilogie erfolgreich ins Genre der Fantasy einstieg. Neben dem bereits erwähnten Zyklus der Zauberschiffe stammen aus ihrer Feder Die zweiten Chroniken von Fitz, dem Weitseher und die Nevare-Trilogie, sowie unter dem Namen Megan Lindholm der Windsänger– und der Schamanen-Zyklus. Derzeit schreibt sie an ihrem neuen Zyklus The Rain Wild Chronicles, dessen erster Band unter dem Titel „Dragon Keeper“ im Juni 2009 auf Englisch erschienen ist. Sie lebt mit ihrem Mann in Tacoma/Washington.
Taschenbuch: 960 Seiten
Originaltitel: Royal Assassin (Farseer 2)
Deutsch von Eva Bauche-Eppers
ISBN-13: 978-3453525207
http://www.robinhobb.com/index.html
http://www.randomhouse.de/penhaligon/index.jsp
Der Autor vergibt: 



