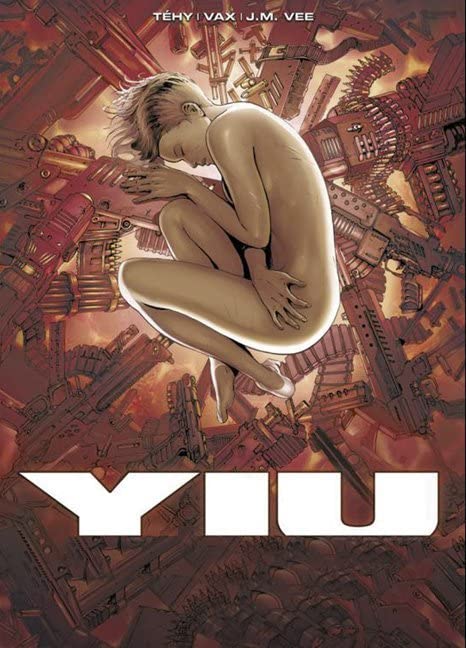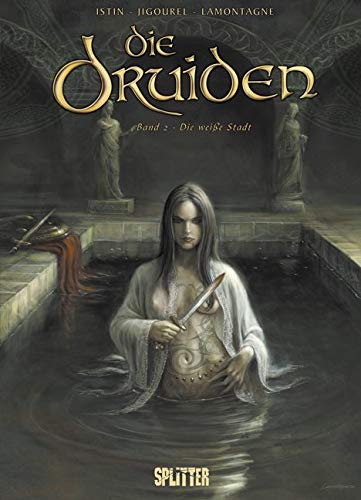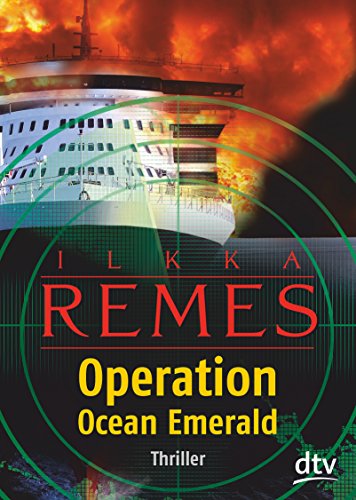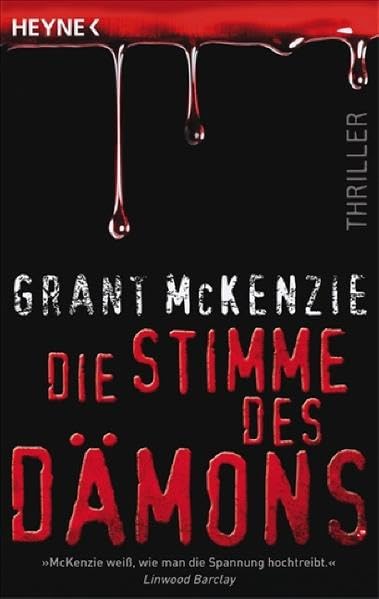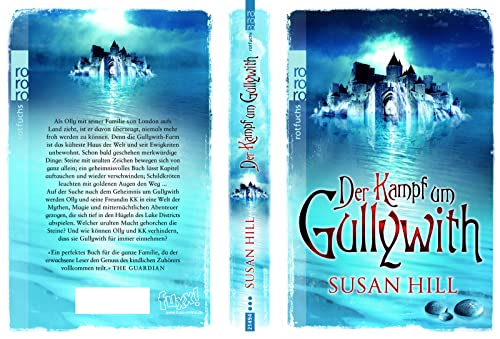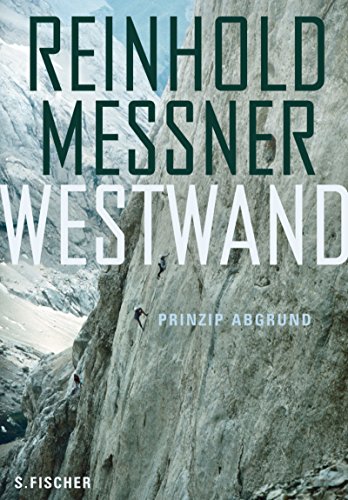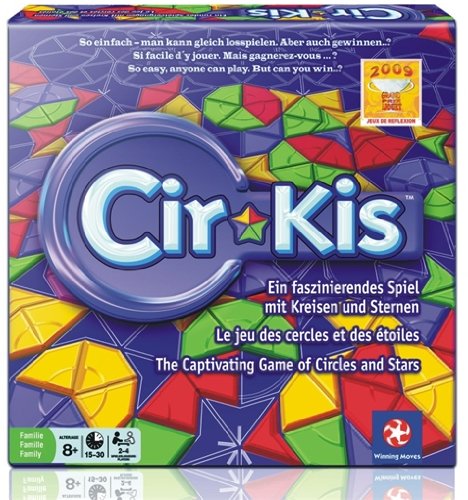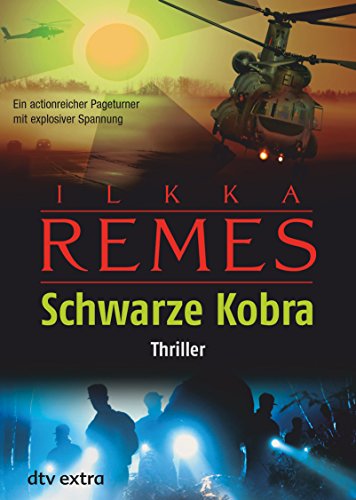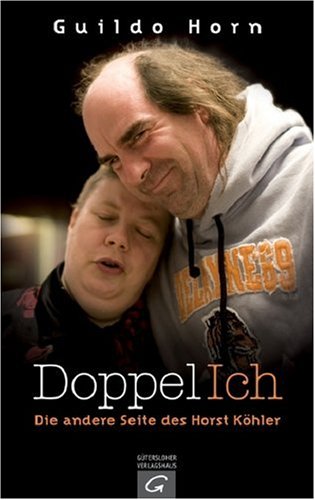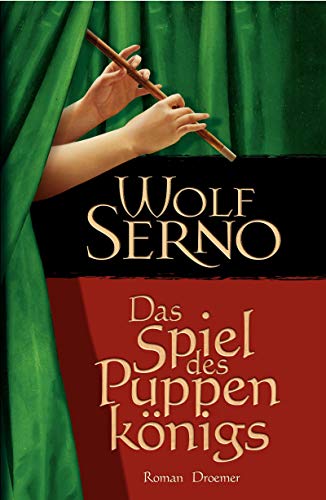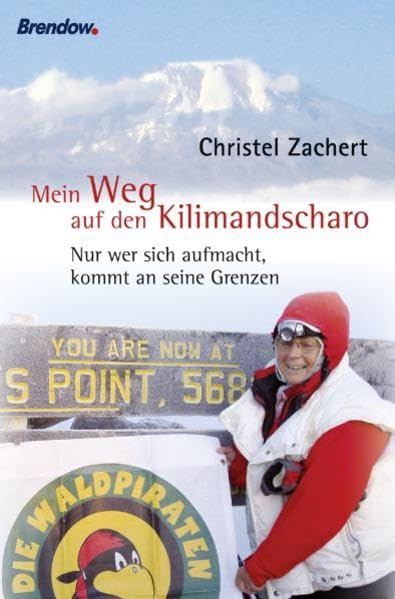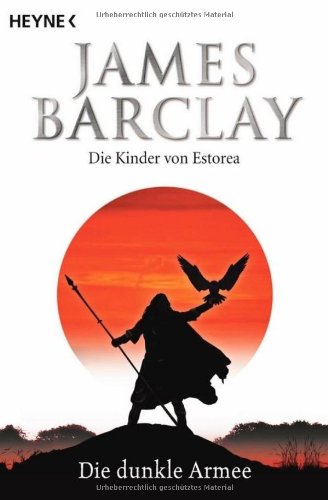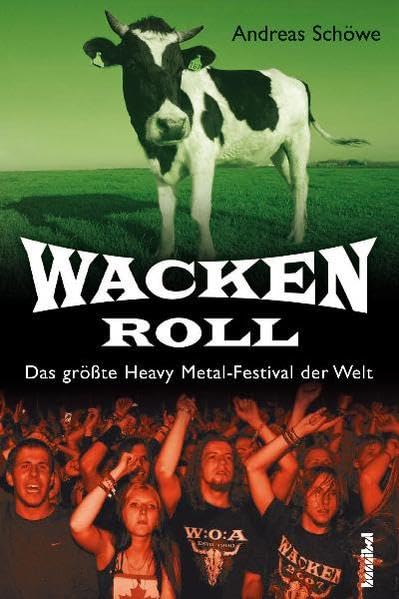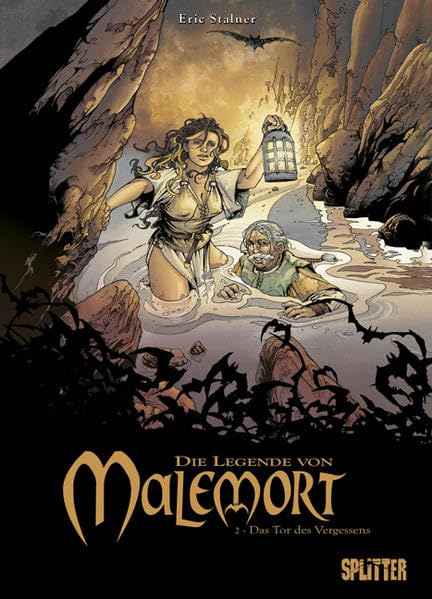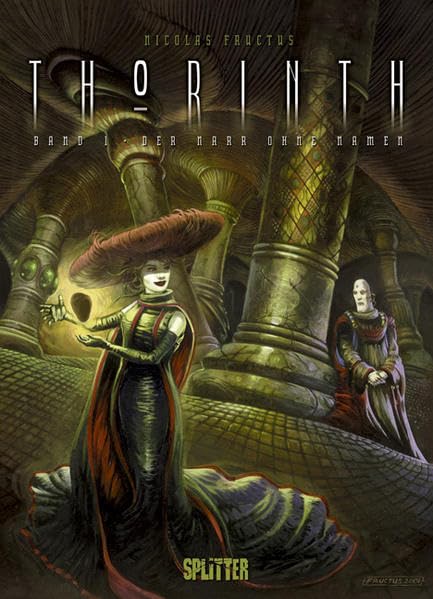Band 1: [„Das Geheimnis der Oghams“ 5607
Band 2: [„Die weiße Stadt“ 5972
_Story:_
Auf der Suche nach den Mördern der kopflosen Mönche scheint Gwenc’hlan schneller als erhofft fündig geworden zu sein. Über den Dächern der Stadt Ys stellt er einen verschleierten Flüchtenden, der offensichtlich Bruder Thomas auf dem Gewissen hat. Doch im Zweikampf gelingt dem Fanatiker erneut die Flucht, so dass Gwenc’hlan und sein Anhänger Taran weiter im Dunkeln tappen.
Doch Bruder Thomas ist den Druiden auch nach seinem Tod eine große Hilfe, da ein Manuskript preisgibt, was hinter den geheimnisvollen Artefakten des Ordens steckt und welche Bedeutung sie für die keltische Geschichte haben. Dabei findet Gwenc’hlan heraus, dass die Lanze des Lug sich direkt unter den Gemächern von Prinzessin Duhad verbirgt.
Diese weiß von dem geheimen Versteck und plant mit Gurvan, ihrem Geliebten, eine Palastrevolution. Doch Gurvans Avancen entpuppen sich als Schein: Der rücksichtslose Anhänger eines weiteren geheimen Ordens hintergeht nicht nur die Prinzessin und den König, sondern arbeitet geradewegs darauf hin, dass die Druiden zerstört werden. Noch während der Feierlichkeiten zum Jubiläum der Stadt schlägt Gurvan zu und stürzt seine einstigen Verbündeten kompromisslos ins Verderben …
_Persönlicher Eindruck:_
Die Geschichte wird komplexer, so viel steht schon nach den Eindrücken der ersten Seiten des neuen Bands von Istins und Jigourels Gemeinschaftswerk „Die Druiden“ fest. Ein neuer Mythos wird eröffnet, neue Figuren – allen voran Gurvan – nehmen einen entscheidenden Platz in der Handlung ein, und darüber hinaus wandeln sich auch die Positionen einiger wichtiger Figuren. Doch dazu soll an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten werden …
Inhaltlich macht der Plot weitere Fortschritte, unter anderem auch deshalb, weil die Distanz zum offenkundigen Vorbild „Die Name der Rose“ ausgebaut wurde und es keine entscheidenden Parallelen mehr gibt. Derweil ist die Rollenverteilung immer noch nicht gänzlich geklärt. Abgesehen von Taran und Gwenc’hlan, die unablässig für ihren Orden einstehen und die Mordserie zu ihren Gunsten aufklären wollen, ist kaum einer der tragenden Charaktere langfristig berechenbar. Doch diese mangelnde Transparenz heizt die Spannung an den gegebenen Stellen noch weiter an, denn bis zuletzt ist man sich beispielsweise nicht sicher, welche Position Prinzessin Dahud einnimmt, was genau Gwendole im Schilde führt und welche Intrigen von den vielen zwielichtigen Gestalten in den Nebenrollen noch gesponnen werden.
Es gibt noch recht viele unbekannte Elemente in der Story, was grundsätzlich auch sehr gut ist, da somit das Potenzial für die Fortsetzungen spielerisch gesichert wird. Doch das Autorenteam sollte Vorsicht walten lassen, denn auf Dauer wirkt es weniger glaubwürdig, mit völlig neuen Voraussetzungen in ein neues Kapitel zu starten. Völlig neue Schauplätze sind es zwar nicht, die in „Die Lanze des Lug“ Einzug halten, doch alleine schon durch die Artefakte, die bislang noch mit keinem Wort erwähnt wurden, nun aber mit einem Mal einen solch hohen Stellenwert zugesprochen bekommen, entsteht ein komplett überholter Background, der die Story wiederum ein wenig durcheinander bringt.
Doch bevor an dieser Stelle Panik ausbricht: Es besteht kein Grund, nervös zu werden, weil die beiden Schreiber die Geschichte immer wieder problemlos in die richtigen Bahnen lenken und die neuen Elemente sehr schön in das bestehende Konzept einbringen. Die Gefahr, das Ganze nun zu überladen, sollte jetzt in den Folgebänden umschifft werden. Bis dahin darf aber wenigstens eine gewisse Restskepsis bleiben, denn es sollte über kurz oder lang schon darauf hingearbeitet werden, auch einmal ein paar Punkte zu setzen bzw. generell auf den Punkt zu kommen. Bis hierhin sind die Ausschmückungen und die Detailverliebtheit in manchen Bereichen jedoch einer der wichtigsten und überzeugendsten Bestandteile von „Die Druiden“ – und mitunter auch das, was die Geschichte bis zu dieser Erzählphase zusammenhält!
Was soll uns dies nun zum Schluss sagen? Nun, in erster Linie, dass die Serie konsequent weitergeführt wird und die guten Ansätze und Entwicklungen des zweiten Kapitels bestätigt werden. Und dass die Atmosphäre nach wie vor berauschend ist. Vielleicht noch, dass das Tempo erhöht wurde. Aber eben auch, dass der schwere Einstieg doch noch nicht ganz vergessen ist, gerade in den Phasen, in denen die Entwicklung etwas undurchsichtiger ist. Aber alles in allem verdient „Die Lanze des Lug“ eine ganze Menge Lob, da die Spannung auf einem sehr hohen Level bleibt und der Inhalt letzten Endes makellos ist!
|Originaltitel: Les druides – La lance de lug
48 Farbseiten, gebunden
ISBN-13: 978-3-940864-42-0|
http://www.splitter-verlag.de