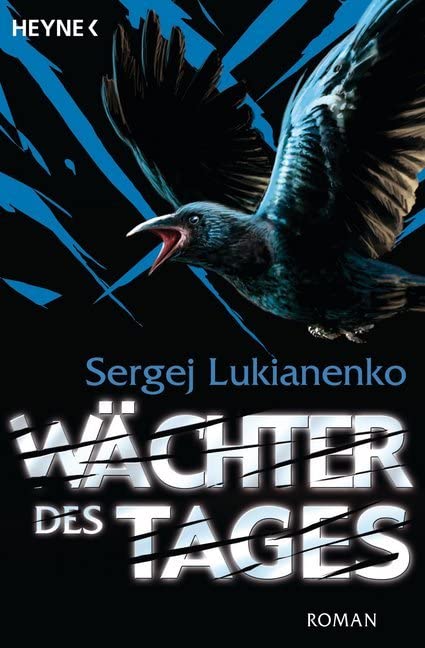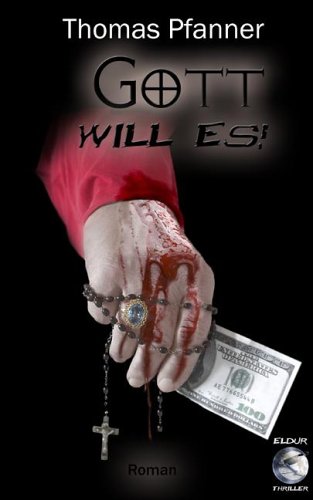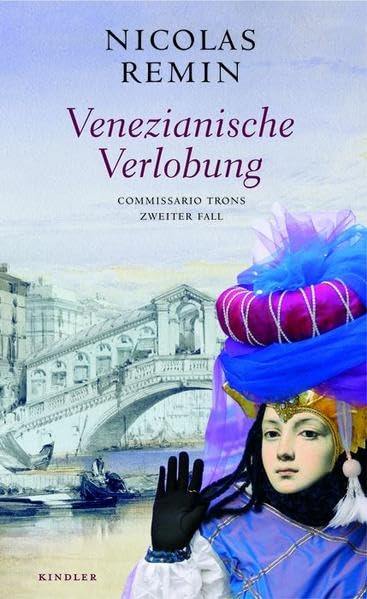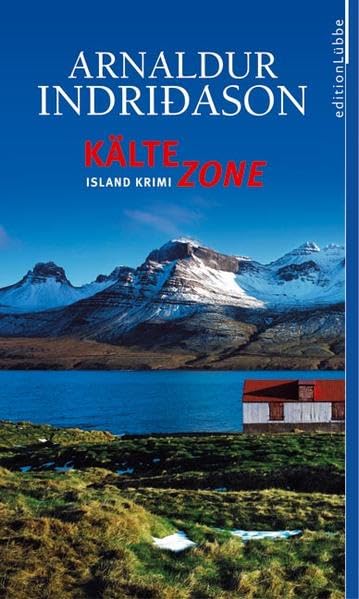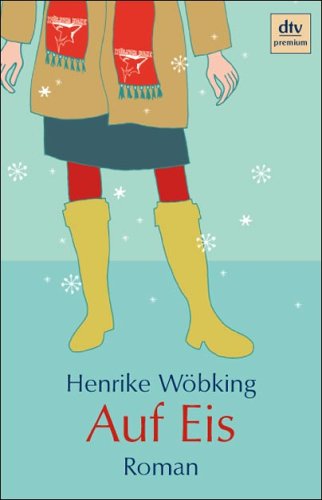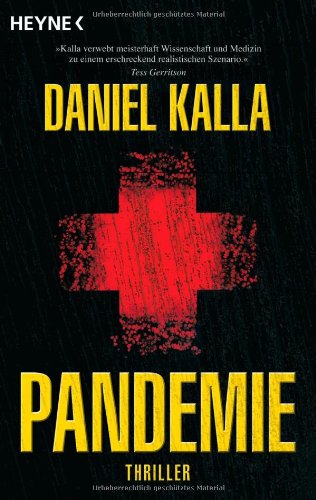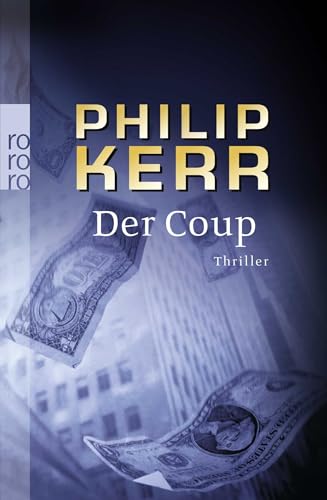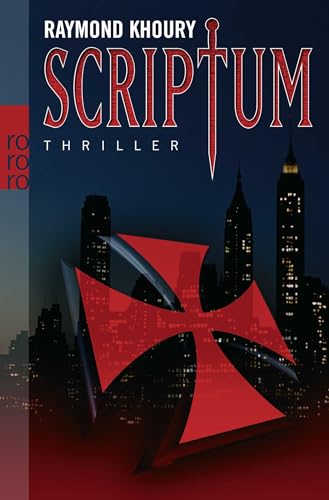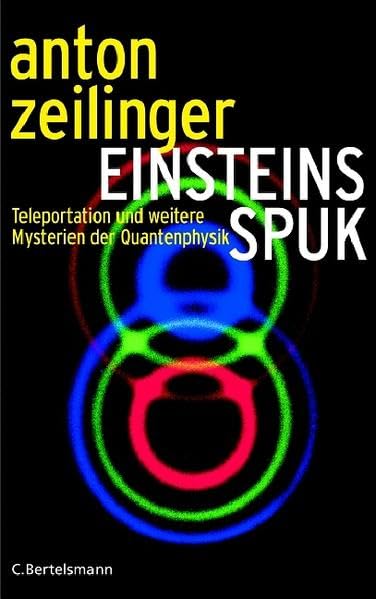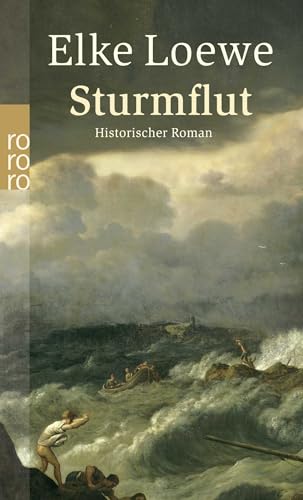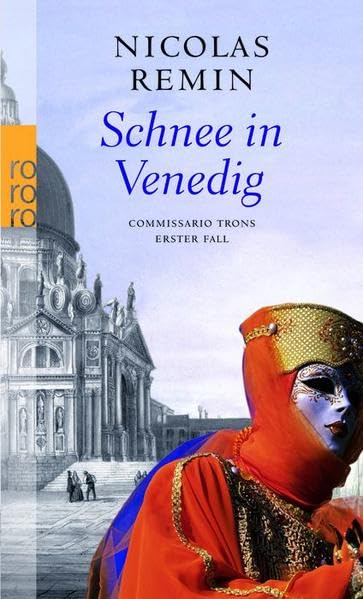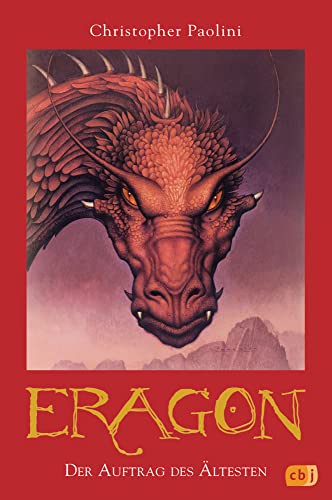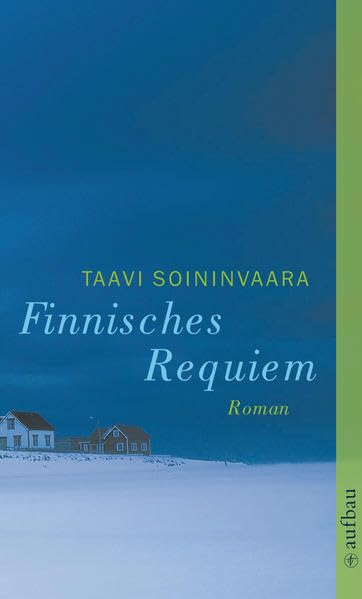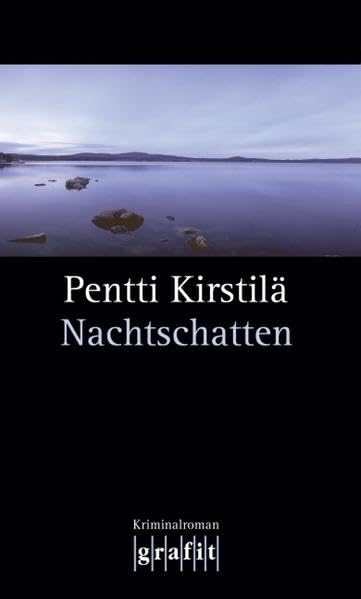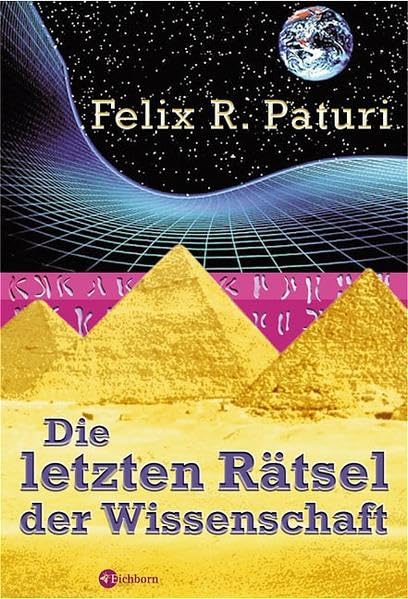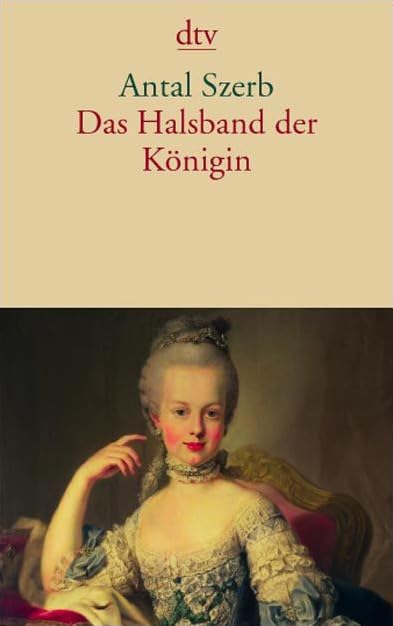Der Auftakt zu Sergej Lukianenkos Wächter-Trilogie schlug unter anderem dank großzügiger Kinowerbung ein wie eine Bombe, das Buch stand wochenlang in den Bestsellerlisten ganz weit oben und auch der Andrang am Kino war anfangs für eine russische Verfilmung sehr groß. Und auch wenn der Kinofilm vielleicht nicht den westlichen Massengeschmack getroffen hat, wurde die Fortsetzung in Buchform doch ungeduldigst erwartet. In [„Wächter der Nacht“ 1766 wurde ein düsteres Bild von Moskau gezeichnet; hier trafen wir auf den Lichten Magier Anton, der für die Nachtwache arbeitet und einige Abenteuer und Gefahren zu überstehen hat. Die beiden großen Magier Sebulon und Geser intrigieren gegenseitig und manchmal auch scheinbar gegen ihre eigene Wache, sodass nie klar war, wer in dieser Trilogie wirklich die Guten sind und wer die Bösen. Umso gespannter war ich auf die „Wächter des Tages“, die sich nun der Gegenseite widmen, sodass wir auch die Tagwache näher kennen lernen werden.
Zunächst treffen wir auf die dunkle Hexe Alissa, die einst Sebulons Geliebte war, nach dem Missbrauch des Kraftprismas beim Chef der Tagwache allerdings in Missgunst gefallen ist. Die erste Geschichte beginnt sogleich mit einem Kampf zwischen den Lichten und den Dunklen, bei dem eine Dunkle stirbt und Alissa alle magischen Kräfte verliert und nicht mehr ins Zwielicht eintreten kann. Doch dadurch rehabilitiert sie sich und gewinnt Sebulons Vertrauen zurück. Alissa wird zu einem Urlaub in ein Kindererholungsheim geschickt, um dort neue Kräfte zu tanken. In den Alpträumen der Kinder gewinnt Alissa ihre magischen Fähigkeiten zurück. Doch auch ein anderer Betreuer erhält Alissas verstärkte Aufmerksamkeit, denn sie beschließt, die Zeit im Erholungsheim zu einer kleinen Affäre zu nutzen. So verführt sie den gut aussehenden Igor und verbringt eine heiße Nacht am Strand mit ihm. Doch als sie ihre magischen Fähigkeiten zurückerlangt hat, muss sie erkennen, dass Igor ein lichter Magier ist, der ebenfalls zum Krafttanken in das Heim geschickt wurde. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden, der für einen der Widersacher tödlich endet.
Die zweite Geschichte widmet sich dem Lichten Witali, der sein Gedächtnis verloren hat und nicht weiß, wer er eigentlich ist. Nach und nach bemerkt Witali, dass er über große magische Kräfte verfügt, mit denen er sogar Geser und Swetlana überrumpeln kann. Gleichzeitig wird eine mächtige Kralle entwendet, woraufhin es zu einigen Morden auf Seiten der Dunklen kommt. Erst nach und nach wird klar, welche Rolle Witali im Gesamtgefüge der Wachen spielt, am Ende der Geschichte kommt es zu einem fulminanten Showdown, bei dem das Kräftegleichgewicht wieder hergestellt wird.
Erst in der dritten Geschichte jedoch verdichten sich die Geschehnisse, wir erfahren mehr über die Zusammenhänge innerhalb des zweiten Teils der Wächter-Trilogie, aber langsam durchschauen wir auch, welche Rolle Alissa und ihre Liebesgeschichte spielen, welchen Part Igor dabei einnimmt und welchen die gestohlene Kralle. Im Laufe dieser Geschichte gibt Sergej Lukianenko viele Geheimnisse preis und erklärt uns ansatzweise, welche düsteren Pläne die beiden Chefs der Tag- und Nachtwache verfolgen. Auch hier wird wieder mehr als deutlich, dass es keine Guten und Bösen im eigentlichen Sinne gibt. Doch leider endet auch diese Geschichte offen, sodass wir ungeduldig auf den bereits heiß ersehnten dritten Teil „Wächter des Zwielichts“ warten müssen, bis wir endlich hinter die Fassaden blicken können …
Sergej Lukianenko versteht es hervorragend, seine Wächter-Trilogie in diesem Mittelband fortzusetzen und weiter auszubauen. Er gönnt uns keine Ruhepause, sondern steigt direkt mit einem gefährlichen Kampf zwischen Licht und Dunkel ein, bei dem beide Seiten große Verluste wegzustecken haben. Doch wie schon im ersten Teil, dient auch diese Schlacht nur zur Ablenkung. Sebulon und Geser verfolgen beide ihre eigenen Pläne und setzen ihre eigenen Wächter wie Figuren in einem Schachspiel ein, sodass die eine oder andere Figur bei diesem Spiel auch geopfert werden muss. Nur ganz langsam lässt Lukianenko uns einige Zusammenhänge verstehen und erst am Ende von Band 2 erfahren wir, wessen Schicksal durch die Schicksalskreide in [„Wächter der Nacht“ 1828 eigentlich umgeschrieben wurde und zu welchem Zweck dies geschah. Dadurch baut Lukianenko kontinuierlich Spannung auf, doch ganz bewusst lässt er viele Fragen offen, die uns natürlich zum Kauf der Fortsetzung verleiten werden.
Während Sergej Lukianenko uns in seinem ersten Teil Anton als Bezugsperson an die Hand gegeben hat, aus dessen Sicht wir sämtliche Ereignisse geschildert bekommen haben, wechseln die Bezugspersonen in „Wächter des Tages“, sodass wir uns nicht so recht einfühlen können in die Welt der Tagwache. In dem Moment, wo uns die Hexe Alissa sympathisch wird und wir ihre widerstreitenden Gefühle nachvollziehen können, müssen wir uns von ihr bereits verabschieden, weil die Perspektive zu Witali wechselt, der für die zweite Geschichte unser Erzähler sein wird. Für die Sympathieverteilung bedeutet das, dass wir weiterhin eher mit den Wächtern der Nacht fühlen, da Anton für mich der Sympathieträger bleibt, der immer noch seiner Liebe Swetlana hinterher trauert, mit der er aufgrund ihrer großen magischen Kräfte keine glückliche Zukunft haben kann.
Meiner Meinung nach verschenkt Sergej Lukianenko durch den Wechsel der Bezugspersonen einiges Potenzial, da wir mit keiner handelnden Figur so recht warm werden können. Unsere Sympathieträger werden immer genau dann geopfert, wenn wir sie gerade besser kennen gelernt und uns mit ihnen angefreundet haben. Dadurch steht man als Leser etwas verloren da und vermisst eine Identifikationsfigur, die Anton im ersten Band repräsentiert hat. So war ich dann froh, als Anton in der dritten Geschichte dieses Bandes wieder eine wichtige Rolle übernahm und häufiger auftrat. In der dritten Geschichte schwenkt Sergej Lukianenko hin und her, im regelmäßigen Wechsel begleiten wir auf der einen Seite Anton und auf der anderen Seite den Dunklen Edgar, die beide allmählich die Pläne ihrer beiden Chefs durchschauen und uns dabei peu à peu die Antwort auf viele Fragen präsentieren.
Auch in diesem Band spielt Sergej Lukianenko seine Stärken aus; so gestaltet er seine Charaktere weiter aus und wir lernen neue Facetten der wichtigen Figuren kennen. Bei Lukianenko gibt es keine Schwarzweiß-Zeichnungen, er gibt all seinen Charakteren gute wie auch schlechte Wesenszüge mit, die die Grenzen zwischen Gut und Böse erfreulich verwaschen gestalten. So kann im Grunde genommen jeder Leser für sich entscheiden, mit wem er mitfiebern möchte, Lukianenko gibt uns keine Seite vor. Für mich ist und bleibt Anton Gorodetzki die Identifikationsfigur schlechthin, seine Gefühle für Swetlana sind nachvollziehbar, ebenso wie seine Zweifel und Frustration, weil er die Pläne seines Chefs nicht versteht und sich von Geser und Sebulon ausgenutzt fühlt. Anton ist nicht perfekt, auch in „Wächter des Tages“ muss er sich zwischen zwei Seiten entscheiden, um am Ende vielleicht doch eine Zukunft mit Swetlana haben zu können.
Sergej Lukianenkos Charaktere sind vielschichtig und authentisch, sie werden uns mit all ihren Vorzügen, Zweifeln, Intrigenspielen und in all ihrem Gefühlschaos vorgestellt. Aber es sind nicht nur die ausgefeilten Figuren, die offenbaren, dass Lukianenko ein sehr genaues Bild von seiner Zwielichtwelt vor Augen hat; es ist insbesondere die komplexe und schwer durchschaubare Handlung, die ein Zeichen dafür ist, dass Lukianenko noch viel vor hat in seiner Wächter-Trilogie. Er hat eine realitätsnahe Welt geschaffen, in der die Anderen in einem komplizierten Miteinander leben, das von Kämpfen, Intrigen und Vertragsbrüchen gekennzeichnet ist, die immer wieder das labile Kräftegleichgewicht ins Wanken bringen. In diesem Band werden uns zwar einige Zusammenhänge erklärt, doch wird unterschwellig deutlich, dass Lukianenko uns die entscheidenden Hinweise weiter verheimlicht. Bei den Anderen steckt hinter jeder Tat noch viel mehr, meist handelt es sich um Ablenkungsmanöver, nie können wir sicher sein, dass wir wirklich schon hinter die Fassade geblickt haben; Lukianenko lässt uns nur an der Oberfläche kratzen und fesselt uns dadurch nur umso mehr an seine Bücher.
So bleibt festzuhalten, dass „Wächter des Tages“ zwar mit den üblichen Problemen eines Mittelbandes zu kämpfen hat, da Anfang und Ende des Buches offen gestaltet sind, dennoch überzeugt Lukianenko erneut (fast) auf ganzer Linie. „Wächter des Tages“ ist atmosphärisch dicht geschrieben, düster, spannend, zwiespältig, es weckt unsere Neugier auf die Fortsetzung und bietet viel Potenzial für den ausstehenden Abschluss der Wächter-Trilogie. Viele Dinge sind noch ungeklärt, viele Schicksale stehen nicht fest, sodass Sergej Lukianenko in „Wächter des Zwielichts“ noch einiges aufklären muss. Mit nur winzigen Schönheitsfehlern wie der fehlenden Bezugsperson bleibt „Wächter des Tages“ ein klein wenig hinter dem ersten Teil der Trilogie zurück, doch bietet es auf der anderen Seite einen genaueren Blick in die Welt der Tagwache, sodass wir die Gefühle und Denkweisen der Dunklen viel besser nachvollziehen können, und es bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte, die Lukianenko hoffentlich in „Wächter des Zwielichts“ aufgreifen wird, um uns endlich verstehen zu lassen, was in der Welt der Anderen wirklich vor sich geht. Was will man mehr?