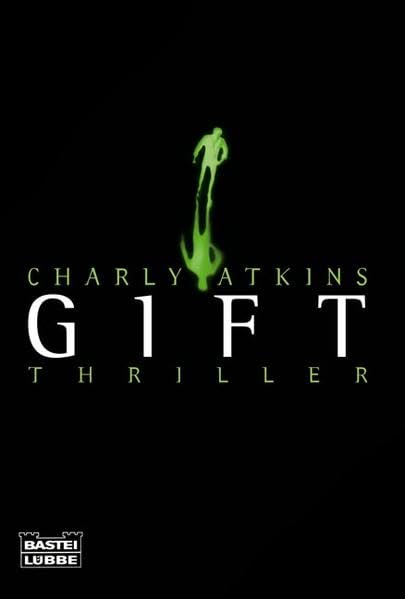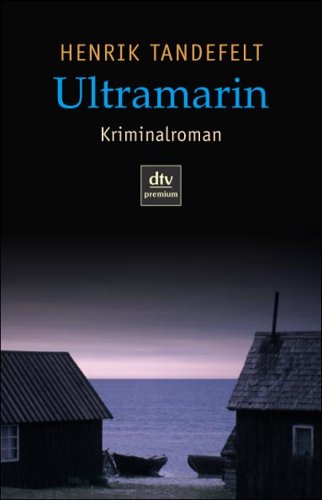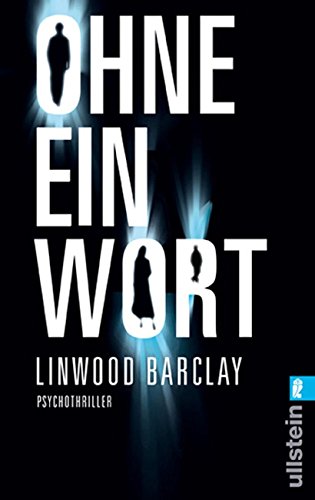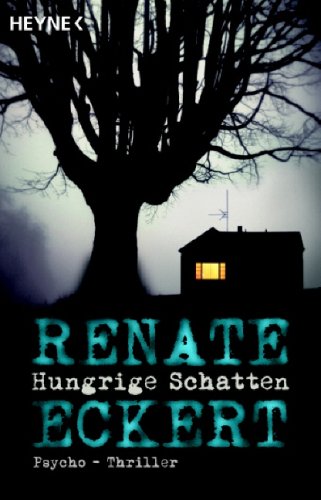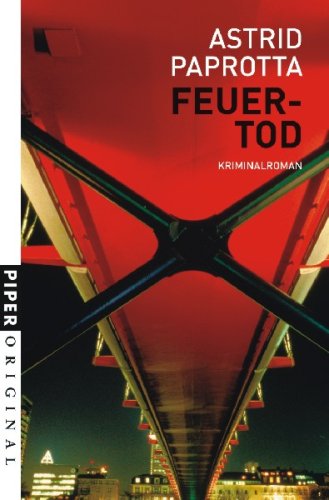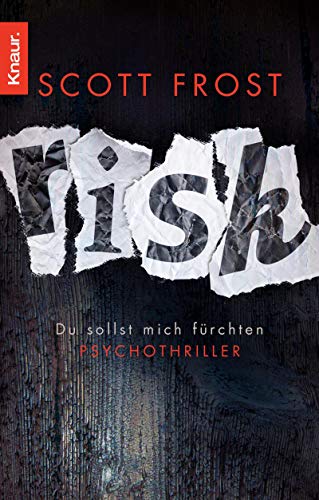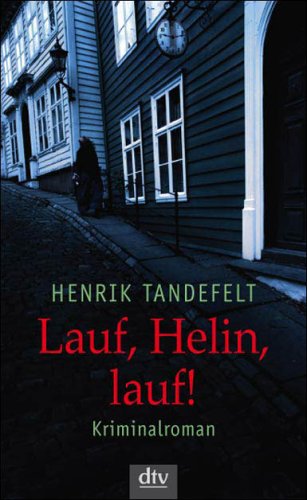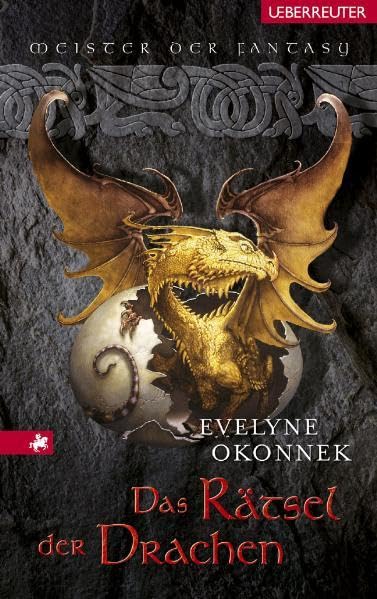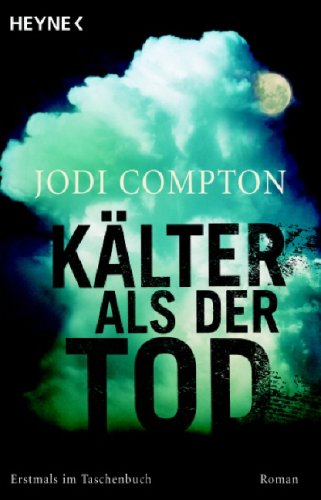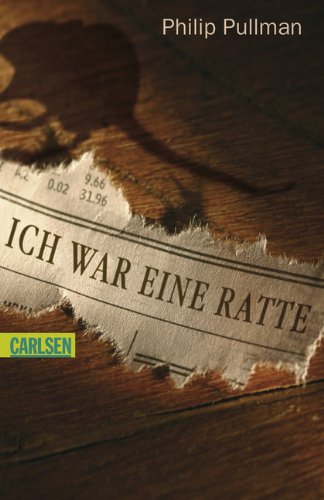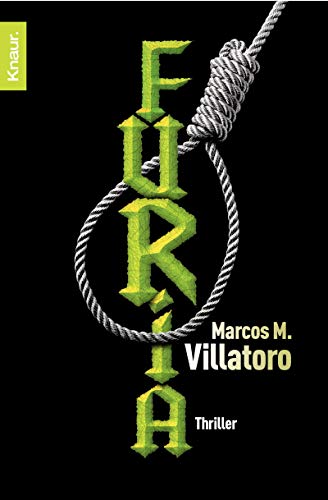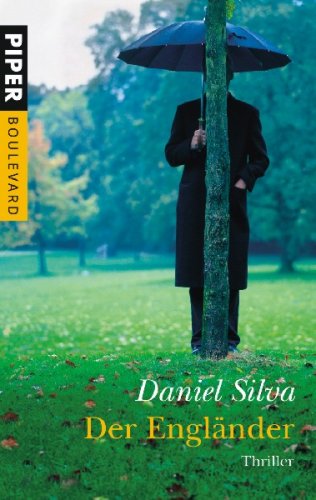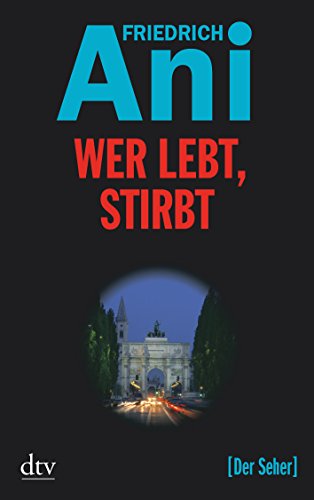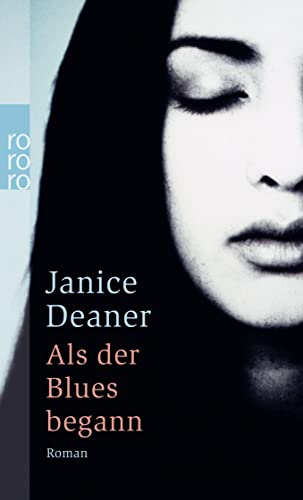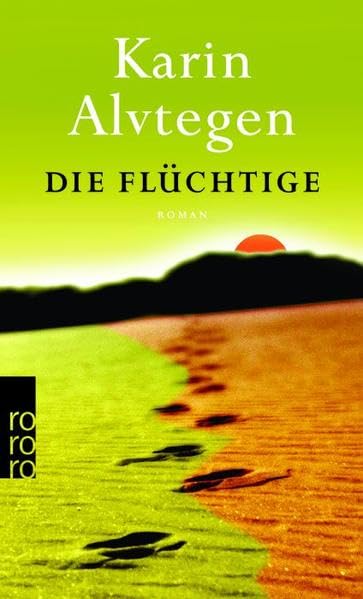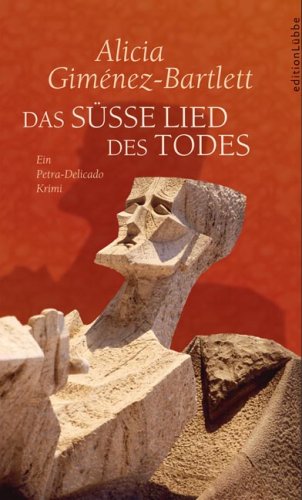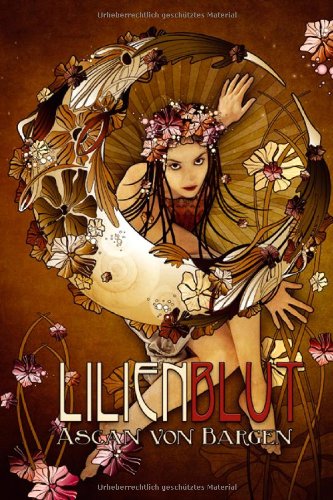Wenn man in der Taverne am Rande der Welten wohnt, kann man jeden Tag ein neues Abenteuer erleben. Nicht umsonst gibt es im Flur des Gasthauses eine Unmenge von Türen, die in alle möglichen Länder führen.
Das dreizehnjährige Findelkind Tobbs wohnt in der Taverne am Rande der Welten. Er arbeitet dort als Schankjunge und wundert sich den lieben langen Tag, wer seine Eltern sind und was der Wirt Dopoulos hinter der zugemauerten Tür versteckt. Nicht umsonst glaubt er, dass das Geheimnis der Tür etwas mit seiner Herkunft zu tun hat.
Eines Tages prescht ein dickes Botenpony mit einem von einem Pfeil durchbohrten Boten in die Taverne. Der Bote scheint an Gedächtnisverlust zu leiden, denn das Einzige, was er sagt, ist „Iwan!“ Nur Wanja, die starke Schmiedin in der Taverne, kann etwas mit dem Namen anfangen. Sie glaubt, dass ihre Tante Baba Jaga den Reiter geschickt hat. Das kann nur heißen, dass die Hexe, die in einem Haus mit Hühnerbeinen lebt, in Gefahr ist. Wanja sattelt ihr rotes Pferd Rubin und macht sich auf nach Rusanien – ohne zu wissen, dass Tobbs ihr folgt. Er hat sich das arbeitslose Botenpony gesattelt und reitet ihr hinterher, denn er hofft, auf diesem Weg etwas über seine Vergangenheit zu erfahren.
Damit liegt er nicht mal so falsch. Die Truhe, die Baba Jaga in ihrem Haus versteckt hatte, enthielt einen wichtigen Hinweis auf seine Herkunft, wie Wanja ihm erzählt. Doch die Kiste ist weg. Die Roten Reiter, die auch den Boten erschossen haben, haben sie mitgenommen und Baba Jaga ist ebenfalls verschwunden. Wanja und Tobbs finden sie in Tajumeer, einem Land, das an eine Südseetrauminsel erinnert. Dort lässt sich die Hexe die Sonne auf den Pelz scheinen. Als Wanja und Tobbs sie treffen, stellt sich heraus, dass ihr Schatz doch nicht den Roten Reitern in die Hände gefallen ist, sondern am Grund des Meeres liegt. Und das wird von den grausamen Haigöttern bewacht …
„Im Land der Tajumeeren“ ist in der Reihe |Die Taverne am Rande der Welten| erschienen. Wie im Vorgängerband [„Die Reise nach Yndalamor“ 3463 mischt Blazon auch dieses Mal heitere Fantasy mit alten Sagengestalten und ähnlichem.
Der eine oder andere mag den Namen Baba Jaga deshalb schon mal gehört haben. Es handelt sich dabei um eine mythologische Gestalt aus Russland, die in einem Mörser fliegen kann, wie Blazon im Anhang erzählt. Die Autorin, die slawische Sprachen studiert hat, orientiert sich aber nicht nur an diesem Kulturkreis. Ebenfalls mit von der Partie sind die Haselhexe aus Tirol und ein paar römische Gottheiten.
Nina Blazon mixt also alles wild durcheinander. Heraus kommt ein spritziges Fantasybuch, rasant erzählt und mit einem heiteren Unterton. Blazon schreibt leichtfüßig, treffsicher und humorvoll, was ihre Bücher auch für erwachsene Leser zu einem Genuss werden lässt.
Im Mittelpunkt steht wieder Tobbs, ein eher ängstlicher Junge, der auf der Suche nach einer eigenen Identität ist. Er ist kein richtiger Held, denn er hat Angst vor Pferden und kann nicht schwimmen. Ein tragischer Antiheld ist er aber auch nicht, denn er beweist sehr wohl Mut, wenn es brenzlig wird. Blazon stattet ihn mit einer Vielzahl verschiedener Wesenszüge aus und gestaltet ihn rund und anschaulich.
Ihm zur Seite stehen Freunde und Feinde, die durch ihre sauber ausgearbeiteten Charaktere und ihre Originalität bestechen. Blazon ist sich dabei nicht zu schade, ihre Figuren an der Grenze der Lächerlichkeit anzusiedeln. Baba Jaga zum Beispiel benimmt (und kleidet) sich bei den Tajumeeren so, wie man sich eine klischeehafte Seniorin auf einer Südseeinsel vorstellt. Durch solche mutigen Charaktere macht es besonders viel Spaß, das Buch zu lesen.
Die Handlung ist auch dieses Mal sehr rasant. Die Ereignisse passieren Schlag auf Schlag, und es werden nur wenige Absätze für gedankliche Ausschweifungen verschwendet. Blazons lobenswerter Einfallsreichtum ist verantwortlich dafür, dass man das Buch nicht aus den Händen legen möchte. Sie malt ihre Fantasywelt in den buntesten Farben und stattet sie liebevoll mit Details und Witz aus. Ab und an baut sie kleine Erinnerungen an die reale Welt ein, zum Beispiel auf Seite 32. Dort erzählt Dr. Dian von der neusten „Magie-Technologie“, dem „Magimnesie-Granulat“, das zu einer „magischen Amnesie“ führt.
Was Blazons Bücher, vor allem die aus der Reihe |Die Taverne am Rande der Welten|, besonders auszeichnet, ist ihre Leichtfüßigkeit in Bezug auf den Schreibstil. Sie tänzelt geradezu von einem Satz zum anderen. Sie benutzt ein einfaches Vokabular, dem sie mit ihrem heiteren Humor eine Menge Lebendigkeit einhaucht.
Allerdings ist das Lesevergnügen dieses Mal nicht völlig ungetrübt. An einigen wenigen Stellen benutzt Blazon Wörter, die für die angepeilte Zielgruppe ab elf Jahren noch etwas zu komplex sein dürften. |Salto mortale| (Seite 18) und |konspirativ| (Seite 29) dürften nicht gerade zum Wortschatz eines durchschnittlichen Fünftklässlers gehören.
Was auf der einen Seite amüsiert, auf der anderen aber leicht deplatziert wirkt, ist der Einsatz von Anglizismen. Die Begriffe |Drama-Queen| (Seite 26), |Cowboy| (Seite 49) oder |Playboy| (Seite 237) wirken ein bisschen fehl am Platze in der ansonsten sauber geschriebenen Geschichte.
Insgesamt hat die Wahlstuttgarterin Nina Blazon erneut ein entzückendes Fantasybüchlein für Kinder und Jugendliche abgeliefert. Die rasante Handlung, der heitere Schreibstil und vor allem die blühende Fantasie der Autorin sind Grund dafür, warum „Im Land der Tajumeeren“ ein einziges Lesevergnügen ist.
http://www.ravensburger.de
http://www.ninablazon.de