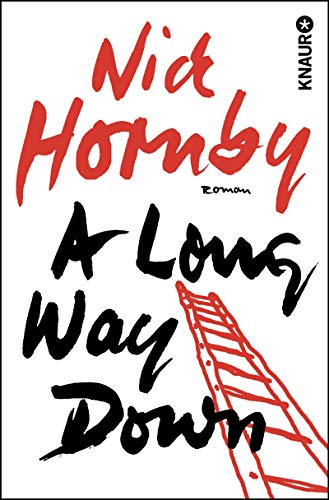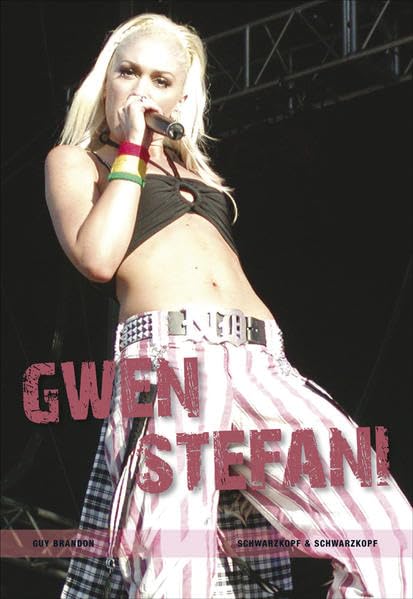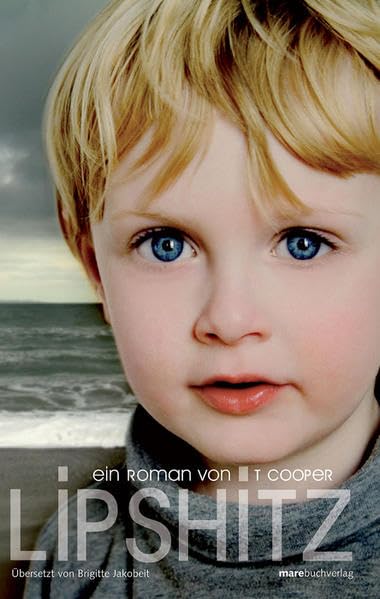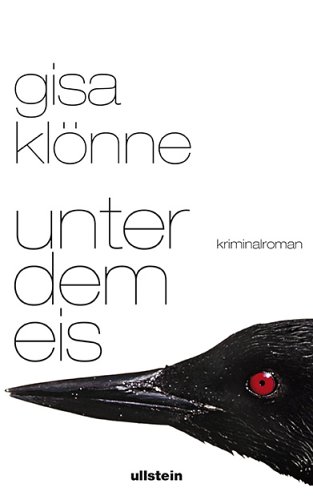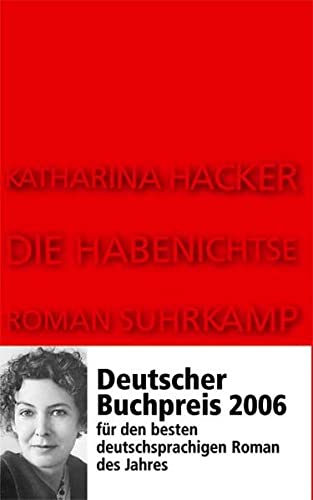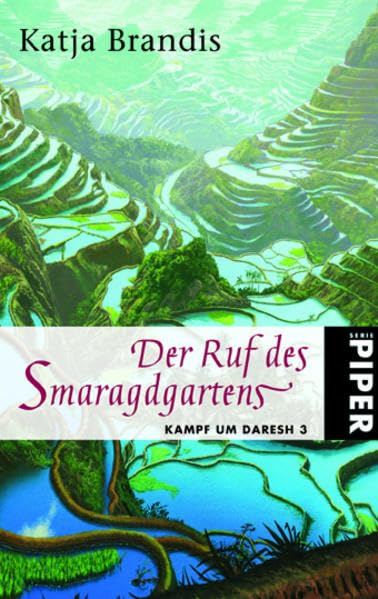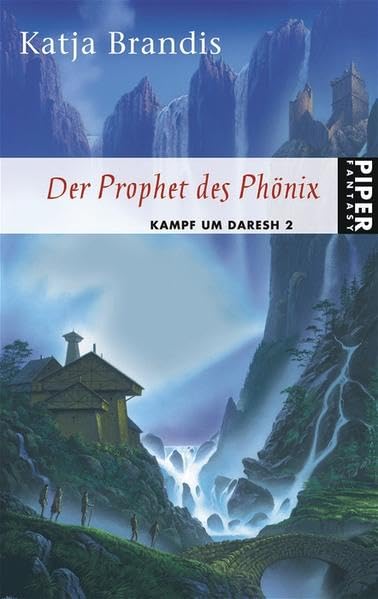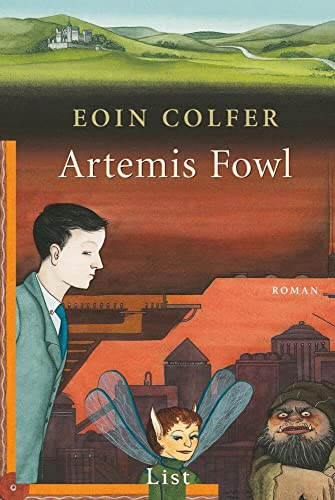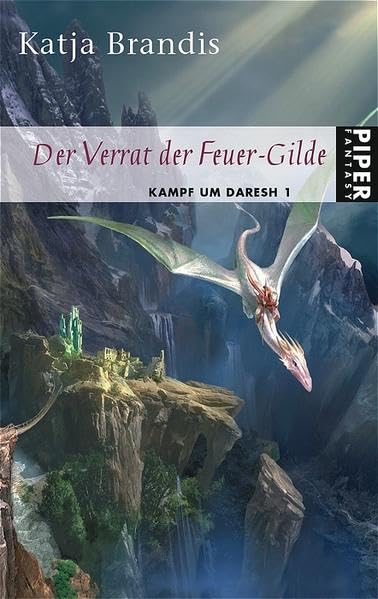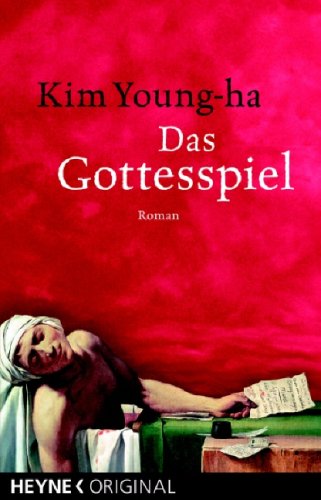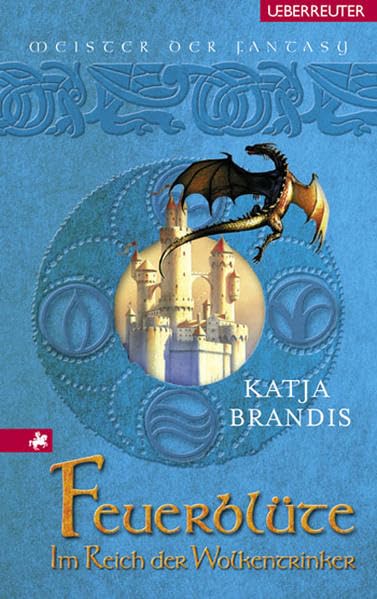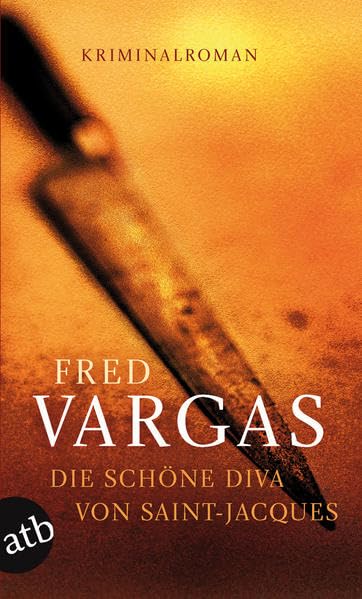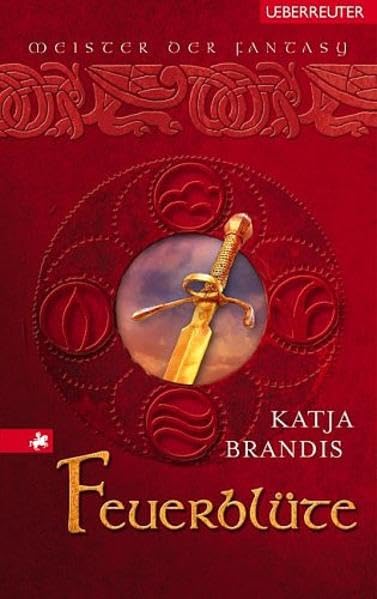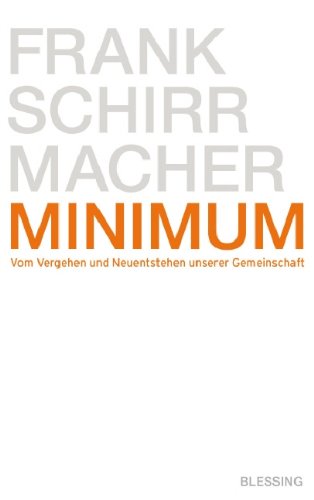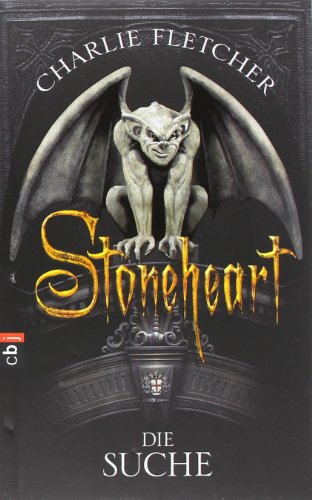Nick Hornby, der Autor mit Vorliebe für Listen und gute Musik, hat mit „A Long Way Down“ den literarischen Soundtrack für Silvester geschrieben.
Vier Menschen treffen sich an Silvester auf dem Dach des Topper’s House, das dank seiner Höhe ein beliebter Ort für Selbstmorde ist. Die vier sind fest entschlossen, sich umzubringen. Martin, ein bekannter Fernsehmoderator aus dem Frühstücksfernsehen, hat sein Leben in den Sand gesetzt, nachdem er mit einer Minderjährigen geschlafen hat und deshalb ins Gefängnis musste. Seine Frau hat ihn verlassen, mit seiner Freundin funktioniert es nicht so, wie es sollte, und seine Karriere findet momentan beim heruntergekommensten Kabelsender Englands statt. Maureen ist das klassische Hausfrauenmauerblümchen und hat aus ihrem Leben nichts gemacht – konnte nicht, denn die Sorge um ihren schwerbehinderten Sohn Matty, den sie ganz alleine pflegt, hat sie ans Haus gefesselt. Die siebzehnjährige Jess dagegen hat andere Probleme. Seit ihr Freund Chas sich aus dem Staub gemacht hat, wird sie ihres Lebens nicht mehr glücklich. Nicht, dass sie das vorher jemals war, seit ihre Schwester Jen vor Jahren einfach verschwunden ist und sie in ihrem versnobten Elternhaus, immerhin ist ihr Vater der Erziehungsminister, alleine gelassen hat. Jess widmet sich in ihrer Freizeit neben dem Versuch, Chas zu finden und ihn zu verprügeln, vor allem Drogen, Alkohol und ihrer aggressiven und direkten Art, mit der sie Leute gerne vor den Kopf stößt.
Der vierte im Bunde ist JJ, ein gescheiterter Rockmusiker, der wegen eines Mädchens von Amerika nach England gezogen ist. Nun ist nicht nur seine Band kaputt, sondern auch seine Beziehung und er weiß nicht so recht, wie er nun weitermachen soll. Für immer Pizza ausfahren? Oder dann doch lieber vom Dach springen?
Nun treffen sich unsere vier Helden in besagter Nacht auf diesem Dach, und anstatt zu springen, essen sie die Pizza, die JJ eigentlich hätte ausfahren sollen, und reden. Sie erzählen sich ihre Probleme, und als Jess zu Chas kommt, beschließen sie, den Jungen zu suchen und ihn zu einer Aussprache mit Jess zu zwingen.
Was harmlos anfängt, endet nicht nur damit, dass sie in allen Zeitungen sind dank Martins Bekanntheitsgrad und Jess‘ Vater, sondern auch beschließen, den Selbstmord bis zum Valentinstag hinauszuzögern und sich währenddessen regelmäßig zu treffen. Allmählich entsteht so etwas wie eine Freundschaft zwischen den vier unterschiedlichen Persönlichkeiten und am Ende kommt sowieso alles anders …
Dieses Buch ist durch und durch ein Hornby. Schräge Gestalten, die doch irgendwie normal sind, und ein tiefgründiger, humorvoller Schreibstil. Eine Handlung, die nicht wirklich eine ist, und trotzdem kann man das Buch nicht zur Seite legen.
Der englische Kultautor hat es geschafft, vier abwechselnd aus der Ich-Perspektive berichtende Charaktere zu schaffen, die sich voneinander unterscheiden und authentisch wirken. Gerade Ersteres kann sehr schwierig sein, da vier Perspektiven verhältnismäßig viele sind und es aufgrund der sparsamen Handlung notwendig ist, jeden Charakter bis in die Haarspitzen zu durchdenken und das Durchdachte wiederzugeben. Hornby umschifft diese gefährlichen Klippen vorbildlich, indem er aus dem Vollen schöpft. Verschiedene Altersgruppen, verschiedene Einkommensschichten, Lebensläufe – nur eines haben sie gemeinsam: Sie sind verzweifelt und kommen in ihrem Leben nicht mehr weiter.
Das wird unglaublich anschaulich in den einzelnen Perspektiven beschrieben, wobei wir hier natürlich auf den typischen Hornbyschreibstil stoßen, in dem sich jeder, der schon mal etwas von diesem Autor gelesen hat, sofort zuhause fühlt. Spritzig, sehr persönlich und prall gefüllt mit allerlei sinnlosen bis verschrobenen Überlegungen über Leben und Leute, erzählt Hornby von den vier Helden, die auszogen, um zu sterben. Es ist ihm dabei hoch anzurechnen, dass man selbst ohne die Angaben der Namen in den Überschriften sofort erkennen würde, welche Person gerade spricht, denn er verpasst jeder einen sehr eigenen Schreibstil. Maureen ist aufgrund ihres Alters eher etwas distanziert und konservativ, Martin legt einen gewissen Zynismus an den Tag, JJ ist ein lieber Kerl und Jess ist ein schwerpubertierendes Mädchen, dem dementsprechende Gedanken durch den Kopf gehen.
Mal abgesehen davon, dass diese Überlegungen auf die Dauer etwas ermüdend sein können – vor allem in Verbindung mit der spannungsarmen Handlung -, hat Hornby hier wirklich Großes geschaffen, denn ein Buch mit einem solchen Aufbau und noch dazu mit fast 400 Seiten ist nicht einfach zu schreiben.
Was man vielleicht als Einziges wirklich bemängeln kann, ist die fehlende Handlung. Im ganzen Buch geht es nur um die aufkeimende Freundschaft der vier und die Höhen und Tiefen dieser Verbindung. Selbst die Frage, ob man sich nun umbringen soll oder nicht, rückt in den Hintergrund.
Ansonsten ist Nick Hornby aber ein unterhaltsames Buch gelungen, das vor allem in Bezug auf seine Charaktere und den Schreibstil sehr gefällt.
http://www.knaur.de