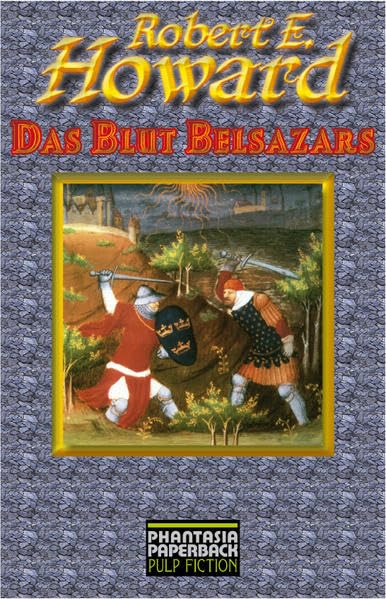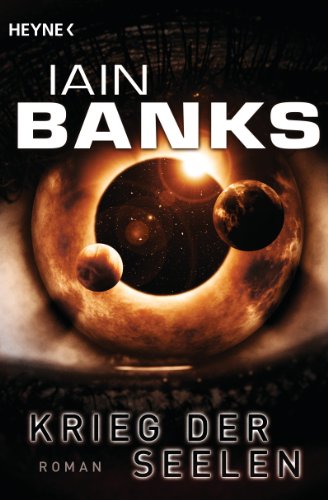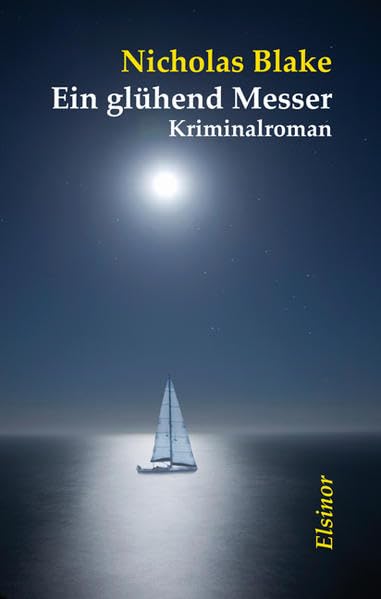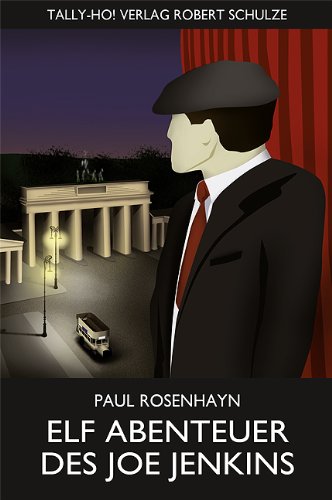_Das geschieht:_
Nach einem halben Jahrhundert im Filmgeschäft ist Tobe Hooper ein Veteran, der keinerlei Illusionen mehr über die Unterhaltungsindustrie hegt. Als man ihn als Stargast auf ein Film-Festival einlädt, wundert er sich deshalb nicht, dass dieses zwar in seiner alten Heimatstadt, dem texanischen Austin, jedoch nicht in einem modernen Kino, sondern in einer verrufenen Spelunke stattfinden wird. Hooper lässt sich dennoch locken, denn Veranstalter Dude McGee kündigt an, den Film „Destiny Express“ zu zeigen. 1959 war dies viele Jahre vor „Texas Chainsaw Massacre“ Hoopers Film-Erstling gewesen, der niemals öffentlich gezeigt wurde und als verschollen galt.
Hooper ist neugierig, zumal er sich an sein eigenes Werk nicht mehr erinnern kann; ein schwerer Unfall hat in jungen Jahren sein Gedächtnis geschädigt. Die verspätete Premiere enthüllt kein frühes Meisterwerk, ist aber ein bizarres Erlebnis, das den Zuschauern im Gedächtnis bleiben wird: Wer „Destiny Express“ gesehen hat, beginnt sich wenig später zu verändern, wird erst sexsüchtig, dann gewalttätig und fällt schließlich hungrig über seine Mitmenschen her, die sich nach solcher Attacke selbst wie beschrieben verwandeln.
Bis der Ausbruch dieser Zombie-Epidemie bemerkt wird, kann sie sich rasend schnell ausbreiten. Medizinisch ist ihr nicht beizukommen, landesweites Chaos droht. McGee hat „Destiny Express“ inzwischen als Auslöser von „The Game“, wie die Seuche genannt wird, erkannt. Er informiert Hooper, der sich mit einem schnell gefundenen Mitstreiter, dem Filmkritiker Erick Laughlin, um Aufklärung bemüht. Das Duo beginnt seine Recherchen mit der Rekonstruktion der Ereignisse von 1959 und stellt fest, dass McGee in der Tat richtig liegt. Diese Erkenntnis gipfelt in dem Plan, den alten Film als „Destiny Express Redux“ neu und in der Hoffnung zu verfilmen, der Zombie-Seuche auf diese Weise Einhalt zu gebieten …
_Ein Ventil für aufgestauten Frust_
Tobe Hooper: ein Kult-Regisseur, Vertreter eines ‚unabhängigen‘ Filmschaffens außerhalb der großen Hollywood-Studios, Galionsfigur des modernen Horrorkinos – und eine tragische Gestalt, der mehr interessante Projekte geplatzt sind als verwirklicht werden konnten. Seit Anfang der 1960er Jahre ist Hooper im Film- und Fernsehgeschäft. In diesen Jahren hat er unzählige TV-Auftragsproduktionen hinter sich gebracht, um ’seine‘ Filme drehen zu können. Nach vielversprechendem Auftakt und einer Karriere, die ihn bis an die Seite von Stephen Spielberg brachte, versank Hooper in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre im trüben Tümpel der eher obskuren B- und C-Movies.
Seit 2006 wollte man ihn nicht einmal mehr für TV-Horror engagieren. Einen Mann, der das Kino liebt, muss die aufgezwungene Untätigkeit zermürbt haben. Wie sonst ließe sich ein Roman wie „Midnight Movie“ erklären? Frustration und der daraus resultierende Wille, auf andere Weise schöpferisch tätig zu werden, wären außerdem eine gute Entschuldigung, denn Tobe Hooper, der Autor, ist definitiv ein noch schlimmerer Flop als beispielsweise Hooper als Regisseur von „The Mangler“ (1995); wer diesen Film kennt, weiß um die schreckliche Wahrheit dieser Äußerung.
2009 war Hooper jedenfalls soweit, sich als ‚Schriftsteller‘ zu versuchen. Obwohl er durchaus eigene Drehbücher verfasst hat – darunter allerdings auch das zu „The Mangler“ -, betrat er damit Neuland, weshalb er sich einen Profi zur Seite stellen ließ. Alan Goldsher ist zudem ein Lohnschreiber, dem das Honorar über die offizielle Autorenschaft geht; das Ergebnis ist freilich entsprechend, was Hooper in seiner Danksagung zwar leugnet, wir Leser aber nach der Lektüre von „Midnight Movie“ wissen.
|Worum gehts hier eigentlich?|
Obwohl es natürlich sein könnte, dass Hooper die Hauptverantwortung für eine Story trägt, die schwach beginnt, sich im Hauptteil in Horror-Routinen und irrelevanten Nebensächlichkeiten verzettelt und schließlich in einem gänzlich missratenen, eigentlich sogar ausgefallenen Finale mündet bzw. verendet.
Die Ähnlichkeit zu „The Ring“ spricht Hooper selbst an. Um eine Antwort auf die Frage, auf welche Weise die Sichtung eines Films Menschen in Zombies verwandeln kann, drückt er sich natürlich; eine kluge Entscheidung angesichts der nun folgenden Ereignisse. „Midnight Movie“ stoppt nach dem ersten Romandrittel, um in einen Mittelteil einzumünden, der die ohnehin dünne Handlungsstringenz endgültig zerfallen lässt.
Schon die ersten Kapitel bieten in erster Linie Ausschnitte aus fiktiven Tagebüchern der Protagonisten. Außer Hooper und Laughlin äußern sich die Studentin/Kellnerin Janine Daltrey oder der Schauspieler und Hooper-Freund Gary Church. Der Mittelteil bietet eine wirre Mischung aus Zeitungsartikeln, Websites, Blogtexten, Mails u. a. Informationsträgern. Die Handlung muss sich der Leser selbst zusammenpuzzeln, was allerdings einfach ist, weil sie den für den Zombie-Horror üblichen Vorgaben folgt und folgerichtig wenig spannend wirkt.
|Man hat ja einen Ruf zu verteidigen|
Da Tobe Hooper der Regisseur von „Texas Chainsaw Massacre“ ist, versucht er, die Ekel-Schraube anzuziehen, indem er ’seine‘ Zombies in zwangssexuelle Kreaturen verwandelt, die ihre Opfer nicht nur fressen wollen. Falls Hooper glaubte, in dieser Hinsicht Maßstäbe setzen zu können, hat er sich geirrt: In Sachen Horror plus (Ekel-) Sex haben ihn Autoren wie Tim Curran, Bryan Lee oder Edward Lee längst überholt bzw. weit in den Schatten gestellt. „Midnight Movie“ wirkt im Vergleich beinahe rührend altmodisch.
Mit aller Macht und letztlich krampfhaft ist Hooper bemüht zu beweisen, dass er auch im ‚modernen‘ Horror Maßstäbe setzen kann. Umso spektakulärer ist sein Scheitern, gerinnt „Midnight Movie“ doch zu einer endlosen Sammlung altmännerhafter Schweinigeleien, die den Leser sich fremdschämend eher grinsen lassen. Hinzu kommen (sanfte) Insider-Lästereien über ein Hollywood, das Freigeister wie Tobe Hooper nicht zu würdigen weiß und den Geldhahn nur für massenkompatiblen Kino-Brei aufdreht; die Frustspitzen seien ihm gegönnt.
Offen muss die Frage bleiben, ob sich Hooper & Goldsher auch im Original jener prollig saloppen, pseudo-‚jugendlichen‘ Ausdrucksweise befleißigen, deren Originalität sich im immer neuen Anzapfen der Vulgär- und Fäkalsprache erschöpft, wobei die Ergebnisse gern gemischt werden. Das Ergebnis ist weder authentisch noch schockierend, sondern als künstliches Konstrukt erkennbar sowie schlicht lächerlich.
|Zombies haben wenigstens ein Ziel!|
Es mag zwar nur darin bestehen, die Lebenden anzunagen, aber man versteht wenigstens, was sie umtreibt. Über „Midnight Movie“ bzw. seinen Verfasser lässt sich das nicht sagen. Anscheinend ging es Hooper nur darum, die Untoten geil und schmuddelig wüten zu lassen. Eine darüber hinausgehende Handlungsvision hatte er wohl nicht. Nachdem knapp 350 Seiten mit entsprechenden Ergüssen gefüllt waren, fiel Hooper auf, dass er seinem „Texas Zombie Massacre“ irgendwie ein Ende bereiten musste.
Das Erste ist ihm gelungen, das Zweite leider nicht. Die ‚Begründung‘ für den Schrecken, der durch „Destiny Express“ in die Welt gebracht wurde, ist mindestens so fadenscheinig wie das gegen die Zombie-Seuche entwickelte ‚Gegenmittel‘. Das daraus resultierende Finale ist eine Schande. Es erschöpft sich in kruden, willkürlich aus dem Autorenhirn gewrungenen Grusel-Effekten, was die völlige Abwesenheit von Logik nie ausgleichen kann. Selbstverständlich fehlt nicht der ‚überraschende‘ Schlusstwist, der zu allem Überfluss eine Fortsetzung androht. (Glücklicherweise wurde Hooper abgelenkt: Mit Geld aus den Vereinigten Arabischen Emiraten konnte er 2012 endlich einen neuen Film inszenieren.)
Wenigstens bleiben die meisten Hauptfiguren tot auf dem Schlachtfeld zurück. Es handelt sich unabhängig vom Geschlecht ausnahmslos um Widerlinge, Hohlköpfe und Drecksäcke, die es gar nicht früh genug erwischen kann. Richtig peinlich ist ein zwanghaft juveniler Hooper, der sich – ein Mittsechziger! – unter das ansonsten die Handlung bestimmende Jungvolk mischt. Ist diese Charakterzeichnung ironisch gedacht? Angesichts der akuten Humorlosigkeit dieses Romans scheint dies kaum wahrscheinlich. Faktisch reiht sich „Midnight Movie“ damit endgültig in die Liste der Hooper-Flops ein.
_Verfasser_
Der Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent _Tobias Paul Hooper_ wurde am 25. Januar 1943 in Austin, US-Staat Texas, geboren. Nach eigener Auskunft wollte er schon als Kind ins Filmgeschäft. Tatsächlich entstanden erste Kurzfilme bereits 1959 und 1963. Darüber hinaus drehte er mehr als 60 TV-Dokumentationen. 1969 realisierte er seinen ersten Spielfilm. Auf dem „Atlanta Film Festival“ wurde Hooper für „Eggshell“ ausgezeichnet, doch einen Verleih fand er nicht. Frustriert beschloss er einen Genrefilm zu drehen, der auf jeden Fall sein Publikum finden würde. Für weniger als 100.000 Dollar drehte Hooper 1974 „The Texas Chainsaw Massacre“ („Blutgericht in Texas“). Ihm gelang ein Sensationserfolg, doch wurde der Regisseur von seinen Produzenten ausgebootet und sah kaum etwas von den Millionen, die dieser Film in den nächsten Jahren einspielte.
Immerhin hatte sich Hooper einen Namen machen können. 1979 inszeniert er den erfolgreichen TV-Zweiteiler „Brennen muss Salem“ (nach einem Roman von Stephen King), 1982 heuerte ihn Stephen Spielberg als Regisseur für „Poltergeist“ an. Doch Hooper konnte den frühen Erfolg nicht nutzen, um sich nachhaltig in Hollywood zu etablieren. Spätere Filme wie „Lifeforce – Die tödliche Bedrohung“ (1985) oder ein Remake des SF-Klassikers „Invasion vom Mars“ (1986) waren alles andere als Kassenschlager. Hooper sank in die Obskurität eines ’selbstständigen‘ Filmemachers zurück. Die meisten Drehbücher blieben Entwürfe, Hooper inszenierte Filme mit knappen Budgets und arbeitete wieder für das Fernsehen.
_Alan Goldsher_ (geb. 1967) ist Produzent für Gebrauchsliteratur und fabriziert, was gerade Lese-Mode ist. Zwischen 2008 und 2010 belieferte er die Abverkaufs-Tische der Buch-Supermärkte mit „Chick-Lit“-Junkfood für pubertierende Mädchen. Derzeit konzentriert er sich auf sog. „Mash-up“-Horror und mischt Realhistorisches mit gruselwitzigen Fiktionen, in denen u. a. die „Beatles“ untot ihr Unwesen treiben.
Jenseits seiner ’schriftstellerischen‘ Aktivitäten arbeitete Goldsher mehr als zehn Jahre als Studiomusiker (Gitarre) und spielte für diverse Bands und Sänger auf Tournee-Bühnen. Er schreibt weiterhin Artikel für Fachzeitschriften. Darüber hinaus ist er Gastgeber von „Book it with Alan Goldsher“, der „ersten interaktiven Talkshow rund ums Schreiben, Lesen und Veröffentlichen“.
|Taschenbuch: 383 Seiten
Originaltitel: Midnight Movie (New York : Three Rivers Press/Crown Publishing Group/Random House, Inc. 2011)
Übersetzung: Diana Beate Hellmann
Deutsche Erstveröffentlichung: Oktober 2012 (Bastei Lübbe/Allgemeine Reihe 20669)
ISBN-13: 978-3-404-20669-8
Als eBook: Oktober 2012 (Bastei Lübbe)
ISBN-13: 978-3-8387-1562-9|
http://www.luebbe.de